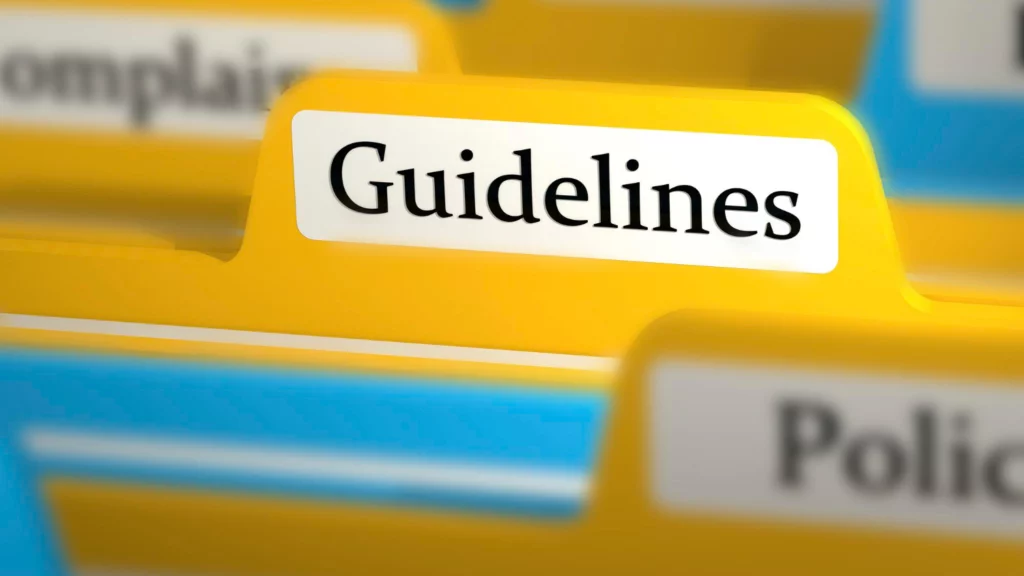„Ist gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewertbar? Und wenn ja, wie?“ – Mit ihren Ideen dazu hat ein deutsches Soziologenteam einen Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gewonnen. Ihr Ansatz: Ein vielfältiges Bewertungssystem mit unterschiedlichen Relevanzbegriffen.
Wissenschaft braucht ein ganzes Set von Relevanzbegriffen
Herr Kaldewey, Sie und Ihren Kolleginnen Julian Hamann und Julia Schubert haben mit Ihrem Beitrag die Preisfrage der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gewonnen. Was ist die Botschaft Ihres Beitrages?
Wir sagen, dass man gesellschaftliche Relevanz von Forschung definitiv bewerten kann. Darum sind wir recht schnell zu den Folgefragen übergegangen und haben diskutiert, ob man das tun sollte und auf welche Weisen dies geschehen könnte. Allem zugrunde liegt die grundsätzliche Spannung zwischen der Autonomie der Wissenschaft und dem Anspruch, dass Forschung auch jenseits der Wissenschaft anschlussfähig sein sollte. Es gibt immer wieder die Diskussion, ob solche Relevanzforderungen die Forschenden zu stark einschränken und ob am Ende Forschungsvorhaben von externen Akteuren wie der Politik oder Wirtschaft vorgegeben oder zumindest beeinflusst werden. Das betrifft alle Disziplinen der Wissenschaft.
Wie haben Sie und Ihre Kolleginnen diese Frage beantwortet?
Wir haben zunächst verschiedene Ansätze beschrieben, mit denen man sich bisher der Bewertbarkeit von Forschung annähert: historisch-narrative, standardisiert-administrative und demokratisch-partizipative Methoden. Hieraus ergibt sich auch direkt die erste Stolperfalle. Ein Fehler wäre sicherlich zu sagen: Es gibt das eine Bewertungsverfahren, den einen Modus der Evaluation für sämtliche Fächer und Bereiche der Wissenschaft. Das geht an der Realität von Forschung schlichtweg vorbei.
Was sind die kritischen Punkte der bisherigen Bewertungsansätze?

Historisch-narrative Verfahren arbeiten mit Beispielen und historischen Anekdoten. Sie fragen also, welche Forschungsergebnisse im Nachhinein wichtig waren oder große Auswirkungen hatten. Hier kann man die Entdeckung des Penicillins oder die Entwicklung der Atombombe als Beispiel nehmen. Diese Methode ist sehr selektiv. Man greift sich einzelne, wichtige Ereignisse der Wissenschaftsgeschichte heraus und viele andere bleiben unbeachtet. Davon unterscheiden wir den standardisiert-administrativen Bewertungsmodus. Auch dabei wird im Nachhinein über die Relevanz von Forschung entschieden, aber viel systematischer: mittels transparenter Kriterien, Indikatoren, Kennzahlen. Hier geht es darum, dass man zählen, messen und vergleichen kann, und dass eine solche Methode dann im Prinzip auf sämtliche Forschungsfelder und Disziplinen anwendbar ist. Gerade in der gegenwärtigen Wissenschaftspolitik ist das ein großes Thema, etwa beim britischen Research-Excellence-Framework. Hier sollen alle britischen Universitäten mit Fallstudien den Impact ihrer Forschung nachweisen.
Wie kann man ein System nach dem standardisiert-administrativen Bewertungsmodus schaffen, das für alle Disziplinen gleichermaßen gültig ist?
Das ist ein wichtiger Punkt: Man kann natürlich standardisierte Methoden anwenden, wird dann aber – je nachdem, welche Indikatoren und welche Kriterien man ansetzt – den meisten Disziplinen nicht gerecht. Man könnte etwa als Kriterium festlegen, dass die Forschung an die Gesellschaft und für Medien vermittelbar, also für die Wissenschaftskommunikation gut geeignet ist. Man kann auch ökonomische Kriterien ansetzen und beispielsweise die angemeldeten Patente und die damit erzielten Gewinne messen. Doch das ergibt in vielen Forschungsfeldern gar keinen Sinn. Unser Punkt ist also, dass Standardisierung problematisch ist, wenn sie für alle Disziplinen gleichzeitig angelegt wird.
Kann der demokratisch-partizipative Modus dieses Problem umgehen?
„Man kann viel bewerten, doch was bedeutet das am Ende in der Praxis?“
Welchen Ansatz schlagen Sie stattdessen vor?
Diversität. Wir sagen: Es gibt nicht den idealen Bewertungsmodus, sondern je nach Kontext, Disziplin oder Forschungsthema sind es ganz andere Verfahren, die die gesellschaftliche Relevanz dieser spezifischen Forschung sichtbar machen können. Bei anwendungsorientierten Feldern wie den Ingenieurwissenschaften kann ein administrativer Ansatz sinnvoll sein. Hier kann man etwa messen, ob nutzbare Produkte auf Basis dieser Forschung entstehen. Oder auch, wenn man will, wie viel Geld damit verdient wird. Für die Astronomie oder die Philosophie wird das hingegen schwierig.
Wie sehen die Bewertungsmethoden für die gesellschaftliche Relevanz von Forschung dann in einer idealen Welt aus?
Hier gäbe es ein ganzes Set an Verfahren und Forschende hätten die Möglichkeit, ihre Forschung vor dem Hintergrund verschiedener Relevanzkriterien zu gestalten. Man macht ihnen also keine Vorschriften, nach welchen Indikatoren sie die Relevanz ihrer Forschung messen sollen. Stattdessen arbeitet man von Anfang an mit einem möglichst breiten Spektrum von Relevanzbegriffen. Wenn Relevanz unterschiedlich ausgelegt wird, muss sie auch unterschiedlich gemessen werden. Diese Vielfalt ermöglicht der Wissenschaft, sich nicht an potenziell schiefen Kriterien zu messen. Denn das könnte am Ende der Wissenschaft schaden.
Wer entscheidet denn überhaupt über diese Relevanzkriterien?
Es gibt aber noch weitere Akteure, die eigene Relevanzbegriffe vorschlagen, wie Organisationen oder Stiftungen, die zu Nachhaltigkeitsthemen arbeiten. Hier gibt es viele Ideen etwa für die Transformative Wissenschaft, ein Konzept, bei dem davon ausgegangen wird, dass Wissenschaft stärker am Prinzip der Nachhaltigkeit orientiert sein sollte. Sehr viele Forschungsbereiche nutzen diesen Relevanzbegriff bereits. Aber auch er ist für die Breite der Forschungslandschaft wenig sinnvoll und wird auch durchaus kritisch diskutiert. Wenn also ein breiteres Verfahren zur Messung von Relevanz angelegt wird, wird auch die Gefahr der Einflussnahme geringer.
Was bedeutet das wiederum für die wissenschaftliche Praxis?
Den Forschenden würde es helfen, wenn Sie aus einem ganzen Set von Relevanzbegriffen wählen könnten, um ihre Forschung daran auszurichten. Damit hätten sie die Freiheit, verschiedene gesellschaftliche Relevanzen zu bedienen. Sie wären frei, spezifisch für sich auszuwählen und destruktive oder unpassende Relevanzbegriffe zu ignorieren. Das ist uns ein großes Anliegen und darum haben wir diesen Beitrag geschrieben.
Und was bedeutet es für Sie, dass Sie den Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften dafür bekommen haben?