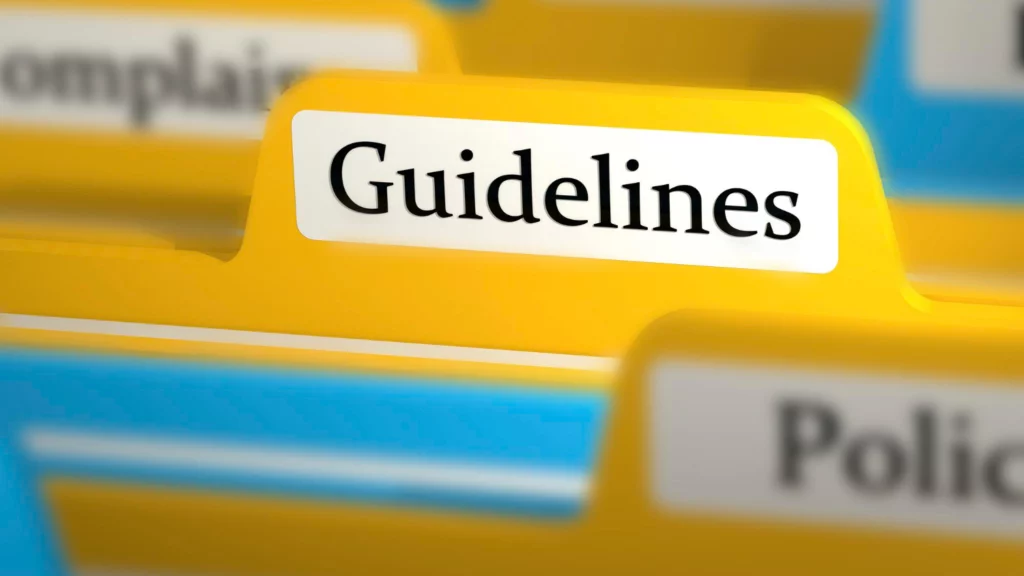Das BMBF kann sich nur erfolgreich für bessere Wissenschaftskommunikation einsetzen, wenn es stärker in Digitalkompetenz investiert. Ein Kommentar zum Grundsatzpapier, ein Appell – und ein Traum.
Mehr Mut zur Innovation
Gute Wissenschaftskommunikation braucht viele Ingredienzien: Sie muss so sichtbar sein, dass sie gefunden wird, und dafür muss sie auf viele Bedürfnisse antworten, und zwar nicht nur auf die Bedürfnisse der Sowieso-bereits-Wissenschaftsinteressierten. Sie muss so glaubwürdig sein, dass sie einen verlässlichen Anker im Informationsstrom bietet, und sie muss so debattierfähig sein, dass sie gesellschaftliche Vielstimmigkeit und Diversität leben, aber auch Angriffe parieren und Shitstorms aushalten kann.
Aber am allerwichtigsten ist: In Zeiten, in den Schülerinnen und Schüler (und nicht nur die) längst schon nicht mehr nur googlen, sondern youtuben, um sich zu informieren, zu orientieren und zu unterhalten, gilt es, sich an die digitalen Kommunikationsorte zu begeben. An die Orte also, an denen sich die Menschen aufhalten, die erreicht werden sollen. Außerdem muss man in diesen kompetent agieren.
Das müssen insbesondere die drei Gruppen beherzigen, die das BMBF in seinem Grundsatzpapier ganz besonders nennt (wobei es bei Gruppe zwei und drei bei Bekenntnissen bleibt und leider keine konkreten Maßnahmen mit ihnen verbunden werden):
- Forscherinnen und Forscher („es ist nötig, [sie] in den öffentlichen Diskurs einzubringen“);
- Wissenschaftsjournalistinnen („unabhängiger Wissenschaftsjournalismus stärkt durch seine kritische Beobachtung und Begleitung der Wissenschaft den evidenzbasierten öffentlichen Diskurs“);
- Kinder und Jugendliche („eine besonders wichtige Zielgruppe für das BMBF“).
Da die Öffentlichkeit digital gestaltet und algorithmisch strukturiert wird, gilt für alle drei Gruppen also: mehr Digitalkompetenz! Denn Folgendes ist festzustellen, wenn man das Kommunikations- und Medienkonsumverhalten der drei Gruppen betrachtet:
Diagnose 1: Kinder und Jugendliche sind intensiv digital unterwegs. Jedoch finden sie dort, wo sie sich bevorzugt bewegen, zu wenig hochwertige Wissenschaftskommunikation oder Angebote des Wissenschaftsjournalismus, die den eigenen Interessen entgegenkommen und ihrem Nutzungsverhalten entspricht. Sie suchen daher nach anderen Quellen.
Diagnose 3: Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten produzieren noch zu sehr an der digital aktiven Zielgruppe vorbei (siehe Diagnose 1), weil sie Innovationen in diesem Bereich scheuen oder weil sie – zu Recht – ahnen, dass innovative Arbeit Zeit kostet, die ihnen im Sparalltag der Redaktionen nicht zugestanden wird.
Was könnte das BMBF demnach – neben der Abfassung eines Grundsatzpapiers – tun? Denn an seinen Taten, sprich konkreten Förderungen, wird das BMBF gemessen werden, und erst die Ausbuchstabierung wird zeigen, wie gut die Vorschläge wirklich sind. Das Papier ist unkonkret genug, um hier Spielraum zu lassen, der, bei allem gut Gemeinten, vielleicht ins Schlechte führen könnte: Dann nämlich, wenn Forscherinnen und Forscher für Kommunikationsmaßnahmen Incentives bekommen – ohne, dass klar erarbeitet wurde, was eine gute und passende Kommunikationsmaßnahme ist, so dass munter über die Köpfe des Publikums hinweg kommuniziert wird. Oder wenn die Förderung sich allein auf die Forschung beschränkt, aber den eminent wichtigen Wissenschaftsjournalismus außen vor lässt. Das Grundsatzpapier ist erstaunlich wenig mutig und innovativ, wenn es um Perspektiven auf gute Wissenschaftskommunikation in der Zukunft geht. Insbesondere für den Bereich des Digitalen erlaube ich mir daher ein paar Ideen zu formulieren:
Algorithmen- und digitale Kommunikationskompetenz müsste für die genannten Zielgruppen spezifisch in die universitären Curricula aufgenommen oder dort verstärkt werden. Das gilt insbesondere für das Lehramtsstudium, aber auch für Fachstudiengänge. Das BMBF kann hier mit entsprechenden Förderlinien konkrete Impulse setzen oder vorhandene intensivieren. Insbesondere Lehrerinnen und Lehrer ohne Digitalverständnis dürfte es eigentlich heutzutage nicht mehr geben. Schließlich sind sie die Multiplikatoren für gekonntes digitales Recherchieren, Kommunizieren und Publizieren. In einer idealen Welt thematisierten sie täglich das Digitale, von Bildrechten über das Hinterfragen von Quellen bis zu Hatespeech. In der heutigen Welt sind sie dafür noch lange nicht gerüstet.
Für den Journalismus und insbesondere den Wissenschaftsjournalismus gilt, dass er, wie das BMBF ganz richtig konstatiert, der Garant für unabhängige, evidenzbasierte Berichterstattung ist. Ohne ihn können Demokratien einpacken – ohne „Anwälte des Lesers“, ohne die externen Beobachterinnen und Beobachter werden wir Einordnung, Orientierung und Kritik verlieren, die wir dringendst brauchen. Doch für ihre Aufgaben müssen Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten heute noch viel besser gerüstet sein als noch vor der Zeit der sozialen Medien, Big Data und Deep Web. Dies betrifft insbesondere den Umgang mit Daten, aber auch Verständnis und Umgang mit Netzdiskursen. Zudem werden immer noch händeringend digitale Geschäftsmodelle gesucht. Das Ministerium stellt hier keine konkrete Förderung in Aussicht. Es ist für ein Bundesministerium schwierig, die „vierte Gewalt“ direkt zu fördern, ohne in den Geruch zu kommen, sich in die journalistische Freiheit einzumischen (ein Punkt, auf den die Ministerin in der Pressekonferenz verwies).
Warum also nicht auch hier den Weg über die Institutionen gehen, die schon länger Orte der Nachwuchsförderung und Innovation im Journalismus sind – Hochschulen. Hochschulen sollten für digitalen Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaftskommunikation noch viel mehr als bisher Lernlabore und Inkubator-Zonen darstellen, in denen Ideen getestet werden können, an die sich in der freien Wildbahn (noch) niemand herantraut.
Wenn das BMBF ganz mutig ist, dann engagiert es sich für die Entwicklung eigener, vielleicht europäischer, digitaler Diskursräume. In einer breiten Allianz aus Informatik- und Gesellschaftsforschung, Medienunternehmen, öffentlich-rechtlichem Rundfunk und gesellschaftlichen Gruppen könnte es sich dafür einsetzen, gemeinwohlorientierte Plattformen mit integrierten sozialen Netzwerken zu entwickeln. Das Gefühl, gegen Facebook, Google und Co. sowieso nicht ankommen zu können, weil „dort doch eh schon alle sind“, gehört mit eigenen guten Ideen konterkariert. (Allerdings müssen, bis es so weit ist, Facebook und andere soziale Netzwerke noch genutzt werden, um diese nicht den Hassrednern und Wissenschaftsleugnern zu überlassen.) Sich die digitale Souveränität zurückzuholen, die Algorithmen transparent zu gestalten und diese nicht dem Kommerz, sondern dem Gemeinwohl zu widmen, wäre ein zutiefst demokratischer Akt, der auch der Wissenschaftskommunikation dient. Die digitalen Diskursorte müssen nicht nur sehr gut (und sehr schnell!) besser verstanden werden, sondern sie müssen auch weiterentwickelt und verbessert werden, damit sie beispielsweise diskriminierungsfrei arbeiten.
Die Rolle des BMBF könnte hier sein, die Kompetenzen aus Forschung, Medien und Gesellschaft zu stärken, die innovativ und zukunftsgewandt denken und arbeiten. Das wäre eine wirklich gute Idee. Ist sie auch realistisch? Man wird ja mal träumen dürfen.
Mehr zum Grundsatzpapier des BMBF auf Wissenschaftskommunikation.de:
- Interview mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek
- Kommentar von Josef Zens vom GFZ Potsdam
- Kommentar von Mike Schäfer von der Universität Zürich
Weitere Beiträge zum Thema: