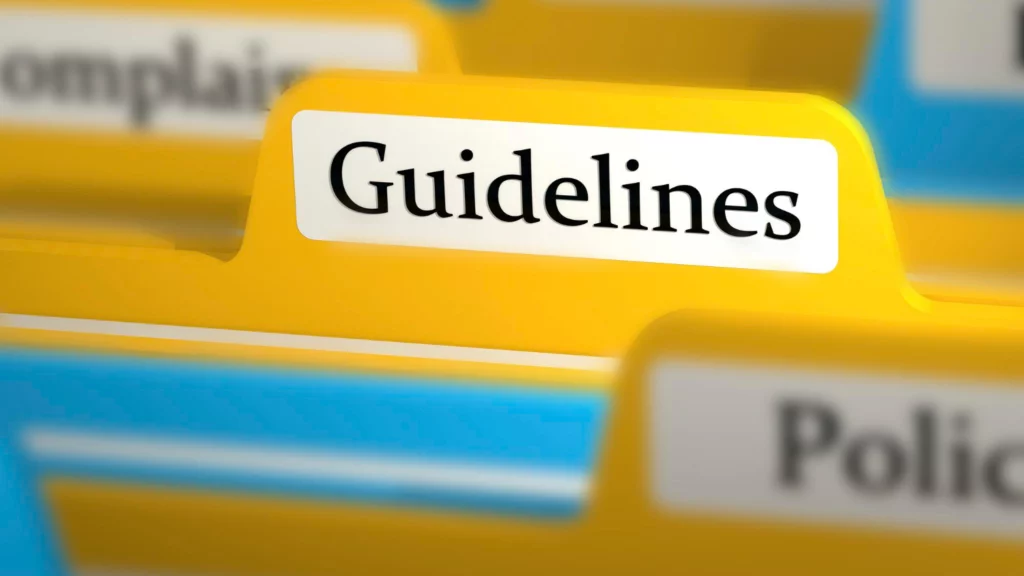Die von der DFG ins Leben gerufene „Kommission für Pandemieforschung“ veröffentlichte eine Stellungnahme mit Schlussfolgerungen zur Corona-Pandemie und Empfehlungen für künftige Krisen. Welchen Stellenwert Wissenschaftskommunikation darin einnimmt, erzählt Britta Siegmund im Interview.
„Kommunikation sollte ein abgestimmter, klarer Prozess sein“
Frau Siegmund, Sie sind selbst Medizinerin und als Mitglied der Kommission für Pandemieforschung an der Herausgabe der Stellungnahme „Wissenschaften in der Coronavirus-Pandemie“ beteiligt. Warum wurde diese Stellungnahme erarbeitet?
In den letzten zwei Jahren ist so viel passiert, dass wir an einem Punkt waren, an dem wir festgestellt haben: Wir müssen reflektieren was die Pandemie eigentlich mit dem Wissenschaftssystem gemacht hat. Was war gut, was war schlecht? Was ist unser Fazit? Was kann das System bei der nächsten Krise besser machen und wie können wir uns vielleicht auch besser vorbereiten? Daraufhin sind viele Diskussionen erfolgt und das Resultat dieser Diskussionen ist das vorliegende Papier.
Die Kommission besteht aus 21 Mitgliedern aus allen Wissenschaftsgebieten. Warum wurde so viel Wert auf Interdisziplinarität gelegt?

Ich glaube, das war ein natürlicher Prozess: Am Anfang der Pandemie dachte man, es wird nur die Expertise von Virolog*innen, Immunolog*innen und ein paar Kliniker*innen benötigt. Im ersten Winter der Pandemie hat man allerdings gemerkt, dass auch die Expertise vieler anderer Fächer wichtig ist, zum Beispiel mit Blick auf das Bildungssystem oder die ökonomischen Auswirkungen. Die DFG hat früh erkannt, dass es sich lohnt, alle Fächer einzubeziehen. Wir hatten im Herbst letzten Jahres einen virtuellen Workshop, bei dem tatsächlich alle Projekte, die einen Bezug zu COVID-19 haben, miteinander in den Austausch getreten sind. Diese Projekte umfassten das gesamte Fächerspektrum der DFG. Und im Rahmen dieses Workshops wurden erste Punkte gesammelt, was zukünftig besser laufen sollte. Wenn man jetzt das Papier durchliest, sind es Empfehlungen, die nicht fachspezifisch sind, sondern das Wissenschaftssystem als Ganzes betreffen.
Was sind Ihrer Meinung nach besonders wichtige Punkte die erarbeitet wurden?
Wichtig war zu reflektieren, was die Forschung geleistet hat und was herausfordernd war. Die Bedeutung von Kooperationen beispielsweise, die über das eigene Fach hinaus gehen, sind besonders in der frühen Phase der Pandemie sehr deutlich geworden. Zudem ist es wichtig hervorzuheben, dass der Zugang zu Daten aufgrund der fehlenden Digitalisierung in Deutschland – und das wird auch im aktuellen Digitalisierungspapier des Wissenschaftsrats hervorgehoben – ein klares Defizit ist. Hier müssen wir aufholen, um schneller mit Gesundheitsdaten arbeiten zu können. Darüber hinaus ist im Rückblick klar geworden, dass es eine Benachteiligung von jungen Wissenschaftler*innen gab, weil die Kinderbetreuung nicht immer gesichert war. Dies waren jetzt nur drei Punkte, die ich hervorgehoben habe, aber wir haben natürlich noch viele weitere Punkte erarbeitet, die in der Stellungnahme nachgelesen werden können.
Das Papier befasst sich in einem kompletten Abschnitt mit Wissenschaftskommunikation. Was wurde hier festgehalten?
Die Wissenschaftskommunikation und ebenso auch die Beratung von Politik und Verwaltung – das sind Themen, die uns ziemlich beschäftigt haben. Um die Implementierung von Wissen zu verbessern und Falsch- und Desinformationen entgegenzuwirken, brauchen wir bei der Kommunikation in die Öffentlichkeit eine zentrale Kommunikationsstruktur, die dringende Fragen nach dem aktuellen Wissensstand beantworten und Informationen öffentlich und verständlich zugänglich machen kann. Ein Prozess, der es den Bürger*innen erlaubt zu verstehen, was wirklich vor sich geht. Die Meinung der Kommission ist, dass es mehr wissenschaftliche Begleitarbeit geben muss, um solch eine Kommunikation besser durchzuführen.
Kommission für Pandemieforschung
Im Juni 2020 wurde die interdisziplinäre Kommission für Pandemieforschung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ins Leben gerufen. Sie ist mit insgesamt 21 Mitgliedern aus allen Wissenschaftsgebieten besetzt. Vorsitzende der Kommission ist Katja Becker, Professorin für Biochemie und Molekularbiologie und Präsidentin der DFG. Ziel der Kommission ist, Wissen rund um das Thema „Pandemien und Epidemien“, im speziellen zu Corona, zu vergrößern. Im September 2022 wurde die Stellungnahme „Wissenschaften in der Coronavirus-Pandemie“ veröffentlicht, wo die Kommission bisherige Erkenntnisse im Verlauf der Coronavirus-Pandemie ausgewertet hat. In dieser Stellungnahme wurden Schlussfolgerungen formuliert, die Empfehlungen für die Vorbereitung auf künftige Pandemien geben.
Es funktioniert nicht zu sagen: Wir haben eine Pandemie, ab sofort müssen wir verstärkt kommunizieren. Eine zentrale Kommunikationsstruktur muss bereits etabliert sein, weil sie nur dann glaubwürdig ist. Es sollte eine transparente Kommunikation sein, in deren Rahmen nicht heute eine Meinung vertreten wird und morgen eine andere. Die Kommunikation der Wissenschaft sollte ein abgestimmter klarer Prozess sein, der Erkenntnisse der psychologischen und kommunikationswissenschaftlichen Forschung nutzt. Und das ist beispielsweise in Dänemark erfolgt. Wir hatten einen dänischen Kollegen in der Kommission, der uns berichtet hat, warum die Kommunikation in ihrem Land gut lief. Überspitzt gesagt: Für die dänische Bevölkerung war klar, wenn die Regierung sagt, „alle sollten sich impfen lassen“, dann lassen sich alle impfen. Aber das ging nur, weil bereits zuvor klar und einheitlich kommuniziert worden ist. Deswegen ist, so hat es uns der dänische Kollege geschildert, die Impfkampagne auch so gut von der dänischen Bevölkerung aufgenommen worden. Das sind Strukturen, die uns momentan in Deutschland fehlen und die wir langfristig aufbauen müssen.
Die Bevölkerung würde also besser damit zurechtkommen, wenn nicht viele kommunizieren, sondern diese Kommunikation gebündelt über eine Institution laufen würde?
Es sollte natürlich keine totalitäre Kommunikation sein. Es geht darum, um beim Beispiel Impfen zu bleiben, klar zu kommunizierten, was ist der Nutzen? Transparent mit Pro und Kontra zu argumentieren und klar zu erklären, warum man eine Verhaltensweise empfiehlt. Die Fakten herauszustellen und nicht jede Woche eine andere Meinung zu präsentieren. Und auch deutlich zu machen, warum nun welche Expertin oder welcher Experte zu einem Thema befragt wird. 
Ein Punkt empfiehlt, die Grenzen wissenschaftlicher Evidenz in der Kommunikation deutlich zu machen. Es sollten Unterschiede deutlich gemacht werden, was wissenschaftliche Erkenntnis, was Vermutung und was gesunder Menschenverstand ist. Wie könnten Journalist*innen und Wissenschaftler*innen diese Empfehlung umsetzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ein Problem in der Coronavirus-Pandemie war, dass über Preprints berichtet wurde und vielen gar nicht bewusst war, wie umfangreich Artikel häufig noch im darauffolgenden Peer Review-Prozess überarbeitet werden. Das ist ein Problem. Dieser Prozess muss richtig kommuniziert werden. Ein weiteres Problem ist die Kommunikation zwischen Wissenschaftler*innen und Journalist*innen. Wie klar kann die eine Seite von Ergebnissen sprechen und wie nimmt die andere Seite das wahr? Wie einigt man sich darauf, was am Ende geschrieben wird? Wie werden Dinge nicht dem Kontext entzogen? Ich glaube, beide Seiten können noch viel voneinander lernen, um eine gemeinsame Sprache zu finden.
In der Stellungnahme werden auch mehr Ressourcen für Wissenschaftskommunikation gefordert. Neben finanziellen Aspekten, was könnte Wissenschaftler*innen bei Ihrer Kommunikation unterstützen?
Ich glaube, dass Wissenschaftler*innen gar nicht so unmotiviert sind, anderen zu erzählen, woran sie forschen. Die meisten sind begeistert von dem, was sie machen. Das Problem ist, dass in den letzten zwei Jahren Wissenschaftskommunikation für viele unattraktiv wurde. Viele Forschende haben Angst, etwas zu sagen, was unvorhersehbar falsch aufgenommen wird. Sie wissen nicht, ob die Universität sie in solchen Fällen unterstützt und weiter hinter ihnen steht. Und ob es eine Presseabteilung gibt, die das unter Umständen wieder auffängt. Wichtig ist auch, dass Wissenschaftskommunikation bereits in die Graduiertenprogramme aufgenommen wird. Wissenschaftler*innen sollten früh lernen, wie sie ihre Projekte in Laiensprache gut verständlich erklären können.
Es muss auch kommuniziert werden dürfen – und damit meine ich erkenntnisorientierte Forschung, – wenn bei Projekten nicht gleich erkennbar ist, was das mal für Nutzen bringt. Nicht alles was wir machen ist nutzenorientiert ausgerichtet, sondern auch von Neugierde gesteuert. Und das ist wichtig und muss erlaubt sein.
Wie geht es mit der Kommission weiter?
Mittlerweile könnte man sich fragen: Brauchen wir die Kommission überhaupt noch? Im Sommer haben wir über diese Frage diskutiert, aber beschlossen, dass wir die Arbeit der Kommission noch bis zum Ende des nächsten Jahres fortführen. Wir denken nicht, dass uns die Pandemie noch so lange so intensiv beschäftigen wird, wie die ersten beiden Jahre, aber für die Wissenschaft sind auch die späten Phasen der Pandemie interessant. Neben der akuten Phase gibt es viele Themen, die nachträglich das System verändern, wie die Ökonomie, die Bildung und auch die Frage, welche weiteren gesundheitlichen Probleme aus der Pandemie entstehen. Diese Veränderungen sollten wir weiter beobachten.