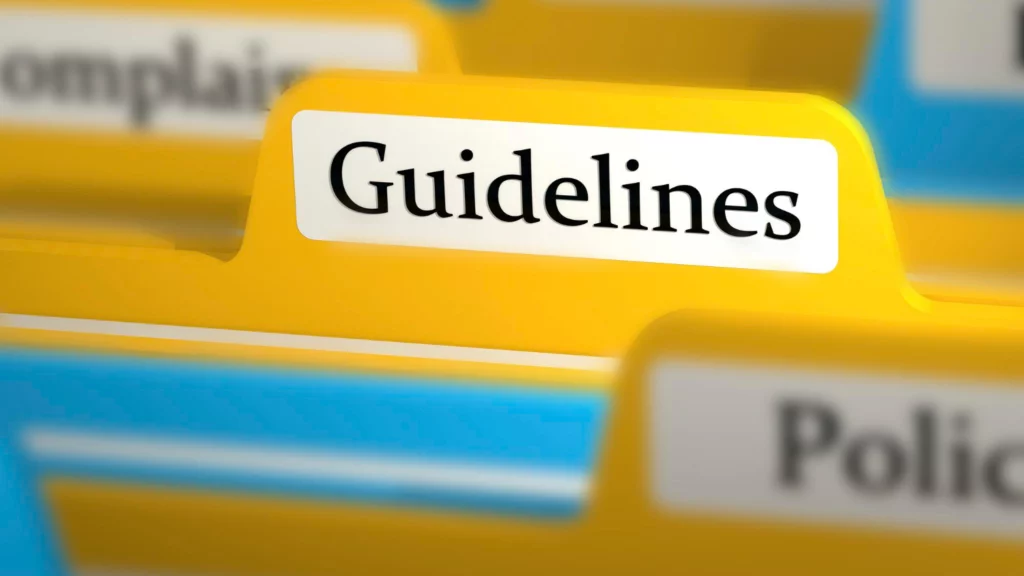Das Projekt „Trilaterale Partnerschaften“ der Volkswagenstiftung fördert seit sieben Jahren grenzüberschreitende wissenschaftliche Projekte zwischen der Ukraine, Deutschland und Russland. Wie der Krieg die Zusammenarbeit änderte und wann Wissenschaftsdiplomatie an Grenzen stößt, erzählt Matthias Nöllenburg im Interview.
„Wissenschaftsdiplomatie funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt des politischen Konfliktes“
Herr Nöllenburg, laut einer Definition der Leopoldina kann Wissenschaftsdiplomatie „ein einflussreiches Instrument sein, um Brücken zwischen Gesellschaften zu bauen und gemeinsame Strategien zur Überwindung globaler Herausforderungen zu entwickeln“. Mit diesem Ziel fördert das Programm „Trilaterale Partnerschaften“ seit 2015 wissenschaftliche Projekte zwischen Russland, der Ukraine und Deutschland. Was ist ihr Fazit?
Wissenschaft ist international. Daher ist es wichtig, grenzüberschreitende Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten um Türen offen und Brücken begehbar zu halten. Dies ist wichtig für Annäherung, Vertrauensbildung und Verständigung. Das war auch das Ziel der trilateralen Partnerschaften. Mittlerweile kann man aber darüber streiten, ob Wissenschaftsdiplomatie im Russland-Ukraine-Konflikt gescheitert ist oder nicht. Es stellt sich die Frage, ob im Krieg bereits ein Kipppunkt überschritten wurde, der Kooperationen zwischen ukrainischen und russischen Wissenschaftler*innen derzeit unmöglich macht. Ich bin pessimistisch und denke ja.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine erreichte auch in der Vergangenheit kritische Punkte wie 2014 die Annexion der Krim. Warum denken Sie, dass nun ein Kipppunkt erreicht ist?
Nach der Annexion der Krim war die Situation noch anders, weil der militärische Konflikt dort und im Donbass noch begrenzt war. Auch dort gab es natürlich schon ukrainische Wissenschaftler*innen, die unmittelbar oder mittelbar betroffen waren, aber das Land war nicht großflächig zerbombt oder komplett im Krieg. Es war möglich, in anderen Landesteilen einige trilaterale Kooperationen aufzubauen. Wobei es damals nicht einfach war, die ukrainische Politik davon zu überzeugen – was ich verstehe. Es gab sehr große Widerstände vom Wissenschaftsministerium, was teilweise dazu führte, dass Kooperationen nicht zustande kamen, weil Partner*innen in der Ukraine weggebrochen sind.
Inzwischen hat sich die Situation fundamental geändert. Einerseits sind in der Ukraine alleine im Wissenschaftsbereich viele Universitäten, Akademie-Institute und die dazugehörige Infrastruktur teilweise oder ganz zerstört. Zudem unterstützen inzwischen viele Russen diesen Krieg, auch die russische Rektorenkonferenz hat eine entsprechende Erklärung unterschrieben. Man kann nun nicht mehr unbedarft weitermachen, weil diese Wissenschaftler*innen ebenso einem Land angehören, das die Ukraine mit einem Krieg überzieht, der mit Zerstörung, Tod, Folter und Vergewaltigung verbunden ist. Wissenschaftsdiplomatie funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt des politischen Konfliktes. Ich verstehe, wenn ukrainische Forschende kategorisch nicht mehr mit russischen zusammenarbeiten möchten.
Wie lief die Zusammenarbeit der Länder vor dem Krieg ab?
Auf staatlicher, institutioneller Ebene gab es teilweise Probleme bei der Akzeptanz für das Programm, aber auf persönlicher Ebene zwischen den Forschenden lief die Zusammenarbeit meist unproblematisch. Schade war, dass in vielen Projekten keine Dreiecksbeziehung entstanden ist, weil es oft sowohl für Russen schwierig war, in die Ukraine zu reisen als auch umgekehrt. Die Zusammenarbeit lief dann V-förmig ab, Deutschland war also in der Mitte und russische und ukrainische Forschende haben über Deutschland kooperiert. In Deutschland konnten sie sich immer treffen und da liefen die Kooperationen sehr pragmatisch und erfolgreich.
Wie sind Sie als Förderer damit umgegangen, wenn es doch mal zu Konflikten zwischen Projektpartner*innen kam?
Es gab durchaus Schwierigkeiten, dass eine Partei beispielsweise nicht zusammen mit der anderen publizieren wollte. In diesen Fällen haben wir auf gemeinsame Publikationen gedrungen, denn Wissenschaftsdiplomatie funktioniert nicht, wenn eine Partei sich nicht dazu bekennt. Wir haben uns klar positioniert und gesagt, dass wir den Antrag sonst nicht akzeptieren. Einige sind daraufhin abgesprungen, wir hatten aber trotzdem über 200 Anträge, viel mehr, als wir fördern konnten.
Wie viele Projekte wurden und werden noch gefördert?
Wir haben insgesamt 59 trilaterale Projekte gefördert, 39 davon sind bereits abgeschlossen und 20 laufen noch mit Verlängerung bis mindestens Ende des Jahres. Wir lassen die trilateralen Projekte mittlerweile aber als bilaterale, also als deutsch-ukrainische weiterlaufen. Wir haben uns da der Linie der deutschen Wissenschaftsorganisationen angeschlossen, die keine staatlichen russischen Institutionen mehr fördern wollen. Es gab Projekte, wo russische Partner*innen sich gegen den Krieg aussprachen und ihren Teil des Geldes zur Verfügung stellten. Das fand ich ein sehr schönes Signal. Wir würden in den Projekten aber durchaus noch geflohene russische Wissenschaftler*innen unterstützen, die ihre Arbeit hier in Deutschland individuell weiterführen möchten. 
Wie könnte Wissenschaftsdiplomatie an den Krieg anknüpfen?
Ich kann mir vorstellen, dass es in einigen Fällen funktionieren könnte, Kontakte, die es bereits gab, wiederzubeleben. Beispielsweise mit russischen Forschenden, die geflohen sind und sich klar gegen den Krieg positionieren. Essenziell hierfür ist das Grundverständnis darüber, dass der Krieg gegen die Ukraine ein Verbrechen ist. Wichtig wäre es, beim Beleben solcher Verbindungen den Fokus auf das Thema der Forschung zu legen und so eine neutrale Kommunikationsbasis zu finden. Es gibt große internationale Kooperationen, wie beispielsweise beim CERN, wo Russland nun nicht mehr dabei ist. Solche Projekte wird man vermutlich als erstes wiederbeleben können. Was aber natürlich davon abhängt, wie man von deutscher oder europäischer Seite Russland und russischen Institutionen gegenüber nach dem Ende des Krieges auftreten möchte.
Trilaterale Partnerschaften
Seit 2015 werden mit dem Programm Trilaterale Partnerschaften der VolkswagensStiftung wissenschaftliche Projekte aller Fachdisziplinen zwischen der Ukraine, Russland und Deutschland gefördert. Insgesamt wurden dafür bisher 15,4 Millionen Euro ausgegeben. Jedes Projekt konnte mit bis zu 300.000 € gefördert werden. Das Antragsbudget sollte hierbei möglichst gleich zwischen den Antragsländern aufgeteilt werden. Im Mai 2019 kamen 180 der beteiligten Forscher*innen in Radebeul zu einem Statussymposium zusammen, um die wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Projekte sowie Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung ihrer Zusammenarbeit zu diskutieren.