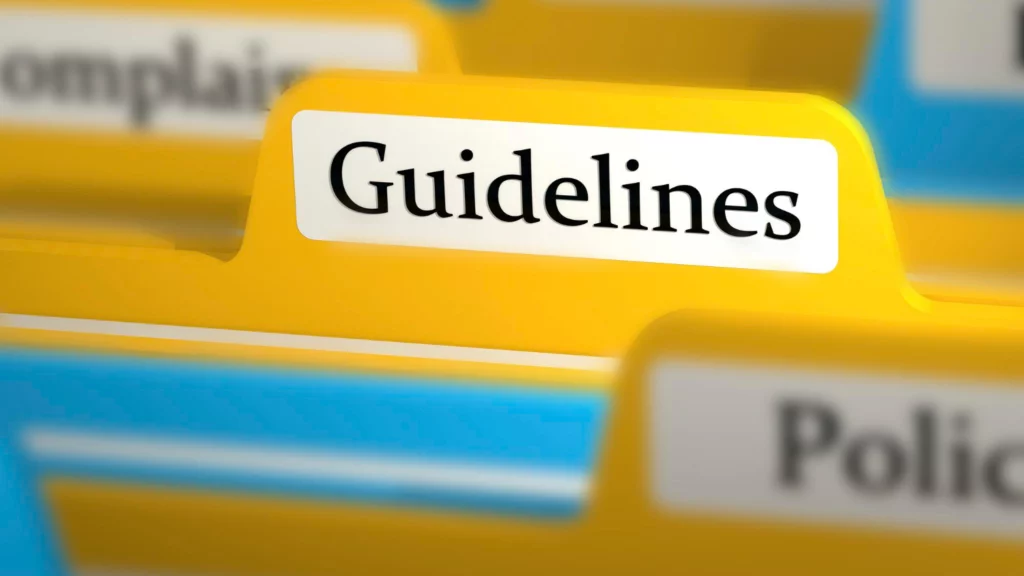Kommunizierende Wissenschaftler*innen in den sozialen Medien und Kommunikation über die Kanäle der Hochschulen und Forschungseinrichtungen müssen kein Entweder-oder sein. Beide Seiten können sich ergänzen, schreiben Tabea Steinhauer, Matthias Fejes und Julia Wandt vom Bundesverband Hochschulkommunikation im Gastbeitrag.
Twittern für die Wissenschaft!
Twittern für die Wissenschaft? Wir als Kommunikator*innen an Hochschulen finden: Ja, unbedingt! Nicht nur, weil es bereits längst gelebte Praxis ist. Sondern vor allem auch, weil es eine Vielzahl an Möglichkeiten und Chancen bietet, sowohl mit den eigenen Forschungsthemen als auch mit der eigenen Haltung dazu sichtbar zu werden.
Ähnlich positiv argumentieren eigentlich auch Hannah Schmid-Petri und Mara Schwind in ihrem Artikel in „Forschung und Lehre“, Ausgabe 8/21. Darin führen sie an, dass Forscher*innen über soziale Netzwerke über ihre Ergebnisse und Konferenzbeteiligungen berichten und so in den Austausch kommen. Das könne die Forscher*innen inhaltlich weiterbringen, aber auch Kooperationen entstehen lassen und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der wissenschaftlichen Gemeinschaft stärken. Sie erklären, wie Wissenschaftler*innen – unter anderem die Politik und die Medien – durch Social-Media-Kommunikation auf sich und ihre Arbeit aufmerksam machen und dadurch ihre Expertise in diesen Bereichen sichtbar wird. Schmid-Petri und Schwind zeigen zudem auf, wie die Öffentlichkeit über soziale Netzwerke in direkten Austausch mit den Forscher*innen kommen kann.
So viele tolle Gründe für Forscher*innen in sozialen Netzwerken aktiv zu werden. Und es gibt noch mehr. Selten wurde die Bedeutung von kommunikativen Forscher*innen so klar wie im Jahr 2020. Und dabei spielt nicht nur eine gewichtige Rolle, dass sie sich zu Wort melden und wissenschaftliche Erkenntnisse in den gesellschaftlichen (und vor allem auch den politischen) Diskurs einbringen, sondern auch, dass sie öffentlich miteinander diskutieren, durchaus auch mal wissenschaftlich streiten. So erlebt die Gesellschaft, wie wissenschaftlicher Fortschritt aussieht und wie das Ringen um Positionen im sachlich-konstruktiven Dialog funktioniert. Indem Forscher*innen selbst im öffentlichen Raum sprechen und ansprechbar sind, signalisiert die Wissenschaft authentisch, dass sie sich auf Augenhöhe mit allen anderen Gesellschaftsteilen bewegt – sowohl mit Entscheider*innen als auch mit Bürger*innen. Als Einzelpersonen können Wissenschaftler*innen mit ihrer Expertise Druck ausüben und sich mit ihrer Meinung einbringen.
Dennoch kommen Schmid-Petri und Schwind zu dem Fazit, dass Forscher*innen mit eigenen Accounts lieber aus sozialen Netzwerken zurücktreten und sich stattdessen gebündelt über die Kanäle ihrer Institutionen an die Öffentlichkeit wenden sollten. Für uns greift das „Bündelungsargument“ durchaus, aber nur in Bezug auf institutionelle Accounts: Beim Vergleich von kleinen institutionellen Accounts gegenüber großen institutionellen Accounts. In der ganzen Diskussion sollte somit auch zwischen persönlichen Accounts (von Wissenschaftler*innen) und institutionellen Accounts (von Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen) unterschieden werden. Wir kennen aus der Praxis Beispiele, in denen sich beide Account-Arten und damit auch Perspektiven – die persönlichen und die institutionellen – wunderbar ergänzen. Zum Beispiel, wenn wir für unsere Hochschulen Meldungen twittern und sich eine Diskussion um Detailfragen entwickelt, in die die Forscher*innen mit ihren Accounts einsteigen können. Das erfordert ein gewisses Maß an Zeit und Energie. Doch letztlich profitieren alle Seiten: Die Forschung wird sichtbarer, Interessierte können den Forschungsprozess besser verstehen und Wissenschaftler*innen erhalten ein direktes Feedback zu ihrer Arbeit.
Alles in allem sollte die Entscheidung gar kein Entweder-oder sein. Die großen Accounts von Hochschulen und Forschungseinrichtungen haben in der Regel mehr Reichweite und sind ausgestattet mit personellen Ressourcen sowie kommunikativer Expertise. Diese Ressourcen können und sollen Forscher*innen gern nutzen und damit ihre eigene Kommunikation in sozialen Netzwerken weiter vorantreiben. Und sie können von der Expertise profitieren, falls sie vor kommunikative Herausforderungen gestellt werden.
Solche Herausforderungen sind, laut Schmid-Petri und Schwind, ein großes Risiko für alle Forscher*innen in sozialen Netzwerken. Das können wir aus der Praxis nicht bestätigen. Hin und wieder eine sachlich-kritische Nachfrage, die jede*r Wissenschaftler*in aus der Forschung gewohnt ist und händeln kann. Hier und dort schaut ein Troll um die Ecke, der sich leicht ignorieren oder entfernen lässt. Im Gegensatz zu institutionellen Accounts kommt es bei persönlichen Accounts nur bei wenigen und nur selten zu einem echten Shitstorm. Bei diesen seltenen Fällen sollten die Forscher*innen dennoch um starken Rückhalt wissen. Sie sollten sich auf ihre eigene Expertise und die Validität ihrer Forschung und Ergebnisse als starkes Rückgrat verlassen und sie sollten auf die helfenden Hände der Kommunikationsprofis der Hochschulen und weiteren Forschungseinrichtungen vertrauen können. Nicht nur dann, wenn der Sturm losgebrochen ist, sondern auch schon vorbereitend durch Schulungen und Beratungen.
So kann an dieser Stelle das Fazit nur sein: Forscher*innen, die für sich die Frage „Twittern für die Wissenschaft?“ beantworten möchten, sollten sich länger und differenzierter mit sozialen Netzwerken beschäftigen – ohne dass dies kompliziert oder aufwändig sein muss. Sie sollten vor allem in die Praxis eintauchen (auch hierbei bieten die Kommunikationsprofis an wissenschaftlichen Einrichtungen Beratung und Unterstützung an). Dort würden sie die enorm vielen Möglichkeiten entdecken, die der Dialog in sozialen Netzwerken ihnen bietet. Und sie würden den Gewinn entdecken, der sie für den Dialog sein könnten. Erst recht in solchen Gefilden, in denen destruktive Stimmen das Feld dominieren.
Professionelle Wissenschaftskommunikation kann und muss Forscher*innen dabei unterstützen und begleiten. Aber sie kann und möchte ihren Dialog nicht ersetzen.
Weitere Beiträge zum Thema
Berichterstattung auf Wissenschaftskommunikation.de
- Hannah Schmid-Petri, Mara Schwind: Für die Vermittlung von Evidenz ist eine Aggregation des Forschungsstandes wichtig
- Lambert Heller: Das nächste Level geht nur gemeinsam
Hintergrund
- Hannah Schmid-Petri, Mara Schwind in Forschung & Lehre, Ausgabe 8/21: Twittern für die Wissenschaft?
Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wider.