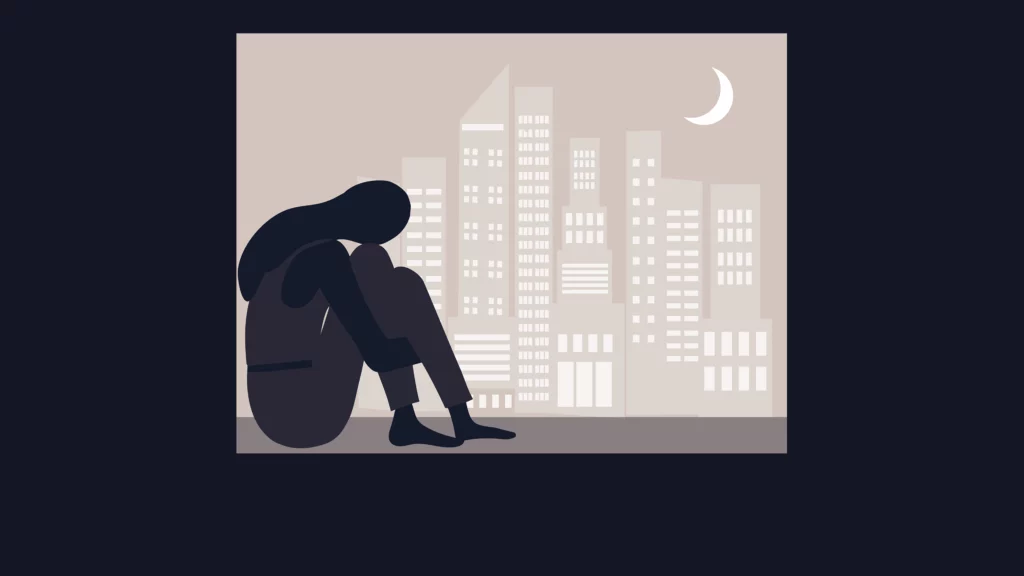Das Projekt „Infect-Net“ will Infektionsforscherinnen in Deutschland sichtbarer machen. Ein Gespräch mit der Professorin für Infektionsbiologie und Projektverantwortlichen Gabriele Pradel über die angestrebten Maßnahmen, die Empfehlungskultur und Frauen in der Wissenschaft.
„Frauen müssen sich viel besser vernetzen“
Frau Pradel, Sie verantworten das neu gegründete Projekt „Infect-Net“, ein Netzwerk deutscher Infektionsforscherinnen. Was ist das Ziel?
Das Konzept entstand im ersten Jahr der Coronapandemie. Sehr schnell hat sich herausgestellt, dass die Regierung Expert*innen brauchte, um mit dieser plötzlich aufgetretenen Krise umzugehen. Zuerst kamen vor allem männliche Experten zu Wort – Christian Drosten, Hendrik Streeck – auch weil sie die ersten Studien geleitet haben. Im zweiten Jahr haben immer mehr Frauen wie beispielsweise Melanie Brinkmann oder Sandra Ciesek angefangen, mit der Gesellschaft zu kommunizieren und wurden dadurch sichtbarer. Wir haben gesehen, dass Frauen als Expertinnen wichtig sind: nicht nur in der Wissenschaft, auch in der Gesellschaft. Dennoch werden sie zu oft noch zu wenig gesehen. Es geht uns deshalb darum, ein Netzwerk von Infektionsforscherinnen aufzubauen. Ziel ist es, einen Verband zu gründen.

Worin lagen die Hürden für Infektionsforscherinnen, bereits am Anfang der Pandemie sichtbarer zu sein?
Die Probleme sind sicherlich vielfältig. Es gibt mehr Infektionsforscher, besonders auf Ebene der Projektleitung oder Professuren, die häufig als Experten herangezogen werden. Der Frauenanteil bei Professuren liegt in Deutschland bei unter 30 Prozent. Außerdem haben gerade die klassischen Medien für Medizin- oder Wissenschaftsthemen ihre „üblichen Verdächtigen“ – drei, vier bekannte Experten der Wahl wie beispielsweise Alexander Kekulé – die sie immer wieder heranziehen. Erst später in der Pandemie wurden „neue“ Expertinnen herangezogen, die viel tiefer in das Thema eingearbeitet sind. Viele Frauen aus dem Feld hat man anfangs noch nicht gekannt.
Sandra Ciesek wurde Teil des NDR-Podcasts „Coronavirus-Update“, Melanie Brinkmann war häufiger Gast in Talkshows und Marylyn Addo trat in vielen Medien als Interviewpartnerin auf. Braucht es überhaupt noch eine Initiative, die Infektionsforscherinnen sichtbarer macht?
Ja, damit das kein vorübergehendes Phänomen bleibt. Die Coronapandemie hat sich hoffentlich in den nächsten zwei Jahren erledigt. Aber es wird die nächste Krise kommen. Dann laufen wir wieder in dasselbe Problem: erst sind die Männer sichtbar, später rücken die Frauen nach. Und dies erfolgt oft artifiziell, um den Gleichstellungsaspekten in den Medien nachzukommen, oder auch, weil ihnen bestimmte Männer helfen. Geschlechterparität sollte aber automatisch passieren. Es gibt nicht nur männliche Experten, auch Frauen sind Expertinnen auf ihrem Feld. Deren Sichtbarkeit ist in Deutschland noch nicht verwurzelt.
Die Infektionsforschung umschließt viele verschiedene Fachbereiche. An wen richtet sich das Netzwerk?
Die Gründungsgruppe umfasst 30 Mitglieder, die vorwiegend aus der Bakteriologie, Virologie und Parasitologie kommen, sodass wir die Forscherinnen zu verschiedenen Krankheitserregern abgedeckt haben. Wir planen, das Netzwerk um Immunologinnen, Epidemiologinnen und Modelliererinnen zu erweitern, um eine breite Expertise zu haben. Gerade die Mathematikerinnen oder Physikerinnen, die die Pandemieentwicklung modelliert haben, hatten viele am Anfang der Pandemie gar nicht auf dem Schirm, aber wir haben gesehen, wie wichtig ihre Arbeit ist.
Warum ist Vernetzung wichtig für die Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen?
Ich selbst habe eine klassische Hochschullaufbahn durchlaufen mit allen Hürden, die es gibt, bis man bei der Professur angelangt ist. Viel läuft über Netzwerke und Empfehlungen – sei es die Besetzung von Gremien, Professuren oder Beiräten. Dabei geht es auch um Machtpositionen. Ich bin dadurch der Meinung, dass wir Frauen uns viel besser vernetzen müssen. Nur wenn wir gesehen und gehört werden, können wir auf das wissenschaftspolitische Geschehen Einfluss nehmen.
Christian Drosten wurde sehr schnell medienbekannt, weil er zum einen an Coronaviren forscht, zum anderen das Nationale Konsiliarlaboratorium für Coronaviren leitet. Natürlich ist er da der erste, der einem als Experte ins Auge springt. Sandra Ciesek kam ins Licht der Bekanntheit durch den Podcast mit ihm, zu dem sie eine Einladung von Christian Drosten erhielt. Der Anstoß war also wieder eine Empfehlung.
Wie unterstützt das Projekt „Infect-Net“ die Infektionsforscherinnen dabei, mehr Sichtbarkeit zu erlangen?
Erst einmal müssen wir zueinander finden und uns besser kennenlernen. Wir alle arbeiten häufig in unseren eng abgesteckten Forschungsbereichen. Das ist schon zeitraubend genug. Man muss sich aktiv Zeit nehmen für Vernetzung. Wir werden also in der Kerngruppe Treffen abhalten und definieren, was wir wichtig finden, um als Expertin wahrgenommen zu werden und auch proaktiv in die Gesellschaft hinein zu kommunizieren.
Wie sieht die Unterstützung konkret aus?
Wir unterstützen die Infektionsforscherinnen zum Beispiel, indem wir sie als Keynote-Sprecherinnen innerhalb unseres Netzwerks vorschlagen. Solches Engagement ist wichtig für die Förderung der wissenschaftlichen Karriere. Außerdem werden Wissenschaftler*innen sehr an ihren Publikationen gemessen. Es gibt weitreichende Studien, die zeigen, dass wissenschaftliche Artikel als relevanter wahrgenommen werden, wenn der verantwortliche Autor ein Mann ist. Deshalb ist es für Frauen schwieriger, in gute Journale zu kommen – aber auch andere Personen aus nicht-westlichen Ländern oder ethnischen Minderheiten werden oft strukturell benachteiligt. Wir vertreten die Infektionsforscherinnen und möchten ihnen dabei helfen, ihre Studie in guten Fachzeitschriften zu publizieren.
Welche Rolle spielt Wissenschaftskommunikation im Netzwerk – immerhin geht es auch darum, in der Gesellschaft und in den Medien als Expertin sichtbarer zu werden?
Die sozialen Medien haben mittlerweile eine große Macht und sind daher eine Eintrittspforte. Um auf den Kanälen sichtbar zu sein, braucht es erst einmal Reichweite. Das ist für viele herausfordernd. Wir bieten daher eine Social-Media-Koordinierungsstelle für das Netzwerk an. Es soll auch die Möglichkeit für die Infektionsforscherinnen geben, auf einem Blog über sich und ihre Forschung zu schreiben. Ich selbst habe eine Wissenschaftskolumne – „Wissensdrang“ – in der Rheinischen Post, in der ich gesellschaftlich relevante Themen aus der Wissenschaft behandele. Wir planen auch andere Formate wie beispielsweise einen Podcast. Für die Sichtbarkeit in klassischen Medien erarbeiten wir eine Expertinnendatenbank, um passgenau zum Thema Infektionsforscherinnen finden zu können.
Schließt die Koordinierungsstelle auch eine Form von Kompetenzförderung ein?
Ja, wir haben Geld für Medien-, Social-Media- und Netzwerkworkshops eingeworben. Sandra Ciesek und Melanie Brinkmann haben uns immer wieder rückgespielt, wie wichtig Medientraining ist. Die Koordinierungsstelle ist aber auch als Ansprechperson bei Fragen da, stellt Kontakt zu den Medien her oder berät bei der Formatwahl.
Warum ist das Netzwerk als Verband organisiert?
Der Verband ist wichtig, damit das Netzwerk verstetigt und am Leben gehalten wird. Wenn das nur ein loses Netzwerk wäre, befürchte ich, dass es nach Ablauf der Förderung wieder zerbröselt. Als Verband hat man die klassischen Verbandsstrukturen einschließlich der Mitgliedsbeiträge, sodass ein größeres Commitment entsteht. Wenn man in etwas Geld investiert, möchte man davon auch etwas haben. Und wir haben wiederum eine größere Spielmasse, die geplanten Maßnahmen umzusetzen.
Wie ist das Projekt aktuell finanziert?
Das „Infect-Net“ ist ein Verbundprojekt, das gefördert wird über die Maßnahme „Innovative Frauen im Fokus“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Mit den Geldern sollen die wissenschaftlichen Leistungen von Frauen sichtbarer gemacht werden. 
Das Projekt steht in den Startlöchern. Wie geht es nach der Findungsphase weiter? Können sich Interessierte bei Ihnen melden?
Wir müssen jetzt die Vernetzung aufbauen und langsam die Fühler ausstrecken in Richtung der Forschungsförderung, Wissenschaftspolitik und Gesellschaft. Ich bekomme auch erste Anfragen, das Netzwerk wächst.