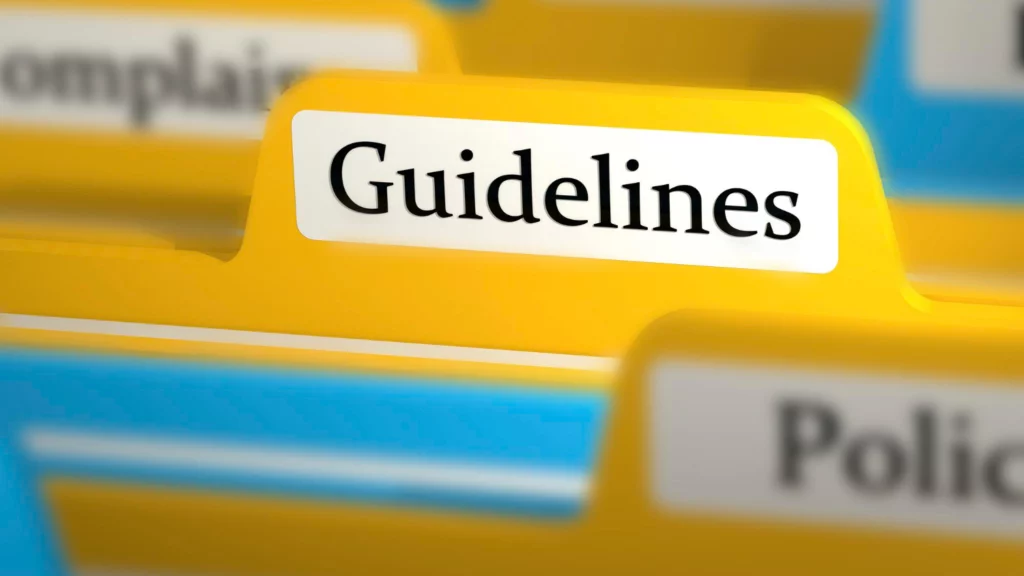Lars Fischer ist Blogger und Wissenschaftsjournalist – was er vom zweiten Teil zur „Kommunikation zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Medien“ hält? Sein Kommentar.
Die Arbeitsgruppe hat zwar viel zu „Media“ geschrieben, aber den Teil mit „Social“ vergessen
Ich hätte mir das nicht zugetraut. Die Arbeitsgruppe „Social Media und digitale Wissenschaftskommunikation“ stellt zwölf Empfehlungen vor, wie Wissenschaftskommunikation im digitalen Raum funktionieren kann – basierend auf einer Analyse, die das Autorenteam bereits im Vorwort als bestenfalls vorläufig bezeichnet hatte. Sie kann auch nichts anderes sein, natürlich. Die – in den Worten der Präsidenten der beteiligten Institutionen – „außerordentliche Dynamik der Entwicklung im Bereich von Digitalisierung, Internet und Social Media“ würde dazu führen, dass schon in einem Jahr sehr vieles anders sein wird.
Die Erkenntnis, dass sich die Medienwelt in einer womöglich jahrzehntelangen Phase des Übergangs befindet, scheint die Autorinnen und Autoren der Stellungnahme in eine Art Schockstarre versetzt zu haben. Das heißt nicht, dass die Analysen und Empfehlungen in der Stellungnahme durch die Bank falsch wären. Man findet viel Richtiges unter anderem in den Forderungen nach Transparenz, Unabhängigkeit und nicht zuletzt Selbstreflexion in der Wissenschaftskommunikation.
Auffällig an den Empfehlungen ist allerdings, wie wenig davon tatsächlich mit Internet und Sozialen Netzwerken zu tun hat: Lediglich die Hälfte der Vorschläge bezieht sich tatsächlich spezifisch auf digitale Wissenschaftskommunikation. Die Stellungnahme liest sich in weiten Teilen wie ein Thesenpapier darüber, wie sich die Wissenschaft am besten vor dieser fremden und überwiegend bedrohlichen Welt schütze.
Die unterschwellige Furcht zieht sich durch Analyse und Empfehlungen. Deswegen ist es wohl auch nicht verwunderlich, dass bedeutende und für die Wissenschaftskommunikation relevante Entwicklungen schlicht nicht auftauchen: Diskutiert werden bestehende Institutionen, seien es abstrakte wie der Journalismus oder konkrete Akteure aus der Wissenschaft. Zentrales Kennzeichen der Digitalisierung ist aber gerade die Stärkung des Individuums und dessen sozialen Umfelds gegenüber ebensolchen Institutionen.
Was es jedoch mit dem „social“ in „Social Media“ auf sich hat, scheint nicht Gegenstand der Untersuchung gewesen zu sein. Das wäre aber unbedingt nötig gewesen, denn eben dies ist der Schlüssel einerseits zur Macht der zu Recht als problematisch empfundenen großen Social-Media-Plattformen, andererseits zur wahrgenommenen Fragmentierung der Öffentlichkeit.
Die Digitalisierung stärkte das Individuum samt seiner mehr oder minder qualifizierten Meinung einst durch den Wegfall hoher Kosten für reichweitenstarkes Publizieren. Das findet nun seine Fortsetzung in den sozialen Netzwerken, deren Mechanismen das Geschmacksurteil des einzelnen Menschen und seines Umfeldes zur zentralen Instanz machen. Zurecht identifiziert die Stellungnahme die Markt- und Meinungsmacht der neuen kommerziellen Plattformen als ein großes Problem, aber Facebook und Co. sind nicht Ursache dieser Entwicklung vielmehr setzt sich hier ein gesellschaftlicher Trend zur Individualisierung aus der vor digitalen Zeit fort.
Deswegen ist es einerseits vollkommen richtig, auf die notwendige medienrechtliche Regulierung im Netz zu pochen. Andererseits: An der Bedeutung der Plattformen wird das nichts ändern, weil sie einfach ein Bedürfnis nach einer bestimmten Art von Kommunikation bedienen. Diejenigen, die schon jetzt unwissenschaftlichen Unfug lesen, würden es also auch dann weiterhin tun, wenn ihre Plattformen medienrechtlich reguliert werden.
Bemerkenswert ist in dem Kontext, dass die Autorinnen und Autoren die originär im Netz entstandenen, extrem vielfältigen und meist nicht kommerziellen Gegenkulturen zu den großen Plattformen kaum würdigen. Dabei sind gerade Communities wie Wikipedia oder Foren ein spannender Ansatzpunkt, mit glaubwürdiger Wissenschaftskommunikation in der digitalen Welt zu reüssieren. Diese zentrale Frage, wie die Wissenschaftskommunikation – und der Journalismus – mit den fundamentalen Veränderungen im Konsum und in der Verbreitung von Inhalten umgeht, scheint mir in der Analyse als auch den Empfehlungen allgemein deutlich zu kurz zu kommen.
Womit wir beim zweiten befremdlichen Aspekt des Berichts sind, nämlich der sehr ambivalent skizzierten Rolle des Journalismus. Der nämlich scheint schon als Abhilfe für fast alle Missstände festzustehen und soll deswegen mit einem warmen Geldregen bedacht werden. Das finde ich als Journalist natürlich erst einmal sehr löblich. Wenn aber der Journalismus eine so zentrale Rolle in der Wissenschaftskommunikation einnehmen soll, dann muss man sich auch mit der Frage befassen, wie er im modernen Mahlstrom der digitalen Veränderung besteht. Zumal sich gerade der Journalismus in der bisherigen Internet-Ära über weite Strecken nicht mit Ruhm bekleckert hat.
Aber keine Bange, Rettung naht! Und zwar in Form der Wissenschaft selbst, die „unterstützend“ für die „Durchsetzung“ – was für eine Wortwahl! – des öffentlichen Interesses an „zuverlässiger und faktentreuer Information“ sorgen soll. Unwillkürlich frage ich mich, was mit Kolleginnen und Kollegen passieren wird, die nicht in genehmer Weise „zuverlässig und faktentreu“ schreiben? Man sehe mir mein Misstrauen nach, aber skeptisch sein, ist schließlich mein Job.
Aber auch wenn man dieses Ansinnen wohlwollend interpretiert, fehlt mir nach wie vor die Antwort auf die entscheidenden Fragen. Die vorgeschlagenen Lebenserhaltungsmaßnahmen für einen – so liest sich zumindest der Bericht – im Niedergang befindlichen Journalismus ändern ja nichts an dem in der Stellungnahme diagnostizierten Bedeutungsverlust als Gatekeeper: Der Journalismus bestimmt nicht mehr, was wichtig und richtig ist.
Bei aller berechtigter Kritik an bestimmten Entwicklungen bleibt den Wissenschaftsorganisationen so oder so nichts anderes übrig, als einen digitalen Fuß in der Tür zu behalten. Denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind in sozialen Netzwerken aktiv, weil sich Leben und soziales Umfeld dort abspielt. Und das beinhaltet auch Wissenschaft: Im Netz bilden sich seit geraumer Zeit Netzwerke von Fachleuten und Laien, die, unabhängig vom Status, Wissenschaft als etwas Verbindendes entdecken, die eine Meinung haben und die diese auch öffentlich äußern: ihr Recht und ihre Pflicht in unserer Demokratie.
Dieses soziale Netzwerk, das sich dank digitaler Technologien rund um Wissenschaft geformt hat, ist gerade dabei, sich selbst zu finden. Jüngster Ausdruck dieses Selbstfindungsprozesses war der March for Science. Zwar war dieser katalysiert unter anderem durch politische Ereignisse, doch ist auch er das Ergebnis eines langfristigen gesellschaftlichen Prozesses, eine Reaktion auf den antiwissenschaftlichen Trend in Teilen der Bevölkerung.
Dieser Trend und das komplementäre Entstehen einer vielfältigen Wissenschaftsöffentlichkeit ist vermutlich die bedeutendste Entwicklung, mit der die Wissenschaftskommunikation im digitalen Zeitalter konfrontiert ist. Beides sind zutiefst soziale Phänomene, in allen Bedeutungen des Begriffs. Es wäre Aufgabe einer Stellungnahme zu Social Media gewesen, diese Prozesse zu benennen. Und vor allem, der institutionellen Wissenschaftskommunikation Wege aufzuzeigen, den Menschen in diesen informellen, nicht institutionellen Netzwerken wissenschaftliche Inhalte auf angemessene Weise anzubieten. Das fehlt. Die Arbeitsgruppe hat zwar viel zu „Media“ geschrieben, aber den Teil mit „Social“ vergessen.
Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider.
Weitere Beiträge zu WÖM2 auf dieser Plattform:
- „Weniger Kanalarbeiten, mehr Kreativität!“ von Annette Leßmöllmann
- „Großakkord mit Dissonanzen“ von Beatrice Lugger
- „Guter alter Journalismus oder PR über Social Media – ist das hier die Frage?“ von Markus Weißkopf
- „Ein Denkanstoß für eine weitergehende fruchtbare Diskussion“ von Martin Schneider
- „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, nutzt soziale Medien!“ von Mareike König
- „Ein kontroverses Thema darf auch kontrovers diskutiert werden“ von Ulrich Marsch und Julia Wandt
- „Worin liegen die Spezifika von Wissenschaftskommunikation in sozialen Medien?“ von Julia Metag
- Rückblick der Redaktion
WÖM:
- Teil 1: Zur Gestaltung der Kommunikation zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und den Medien
- Teil 2: Social Media und digitale Wissenschaftskommunikation (PDF)
Weitere Beiträge zu WÖM2 stellte Marcus Anhäuser in einer Linkliste auf seinem Blog zusammen.