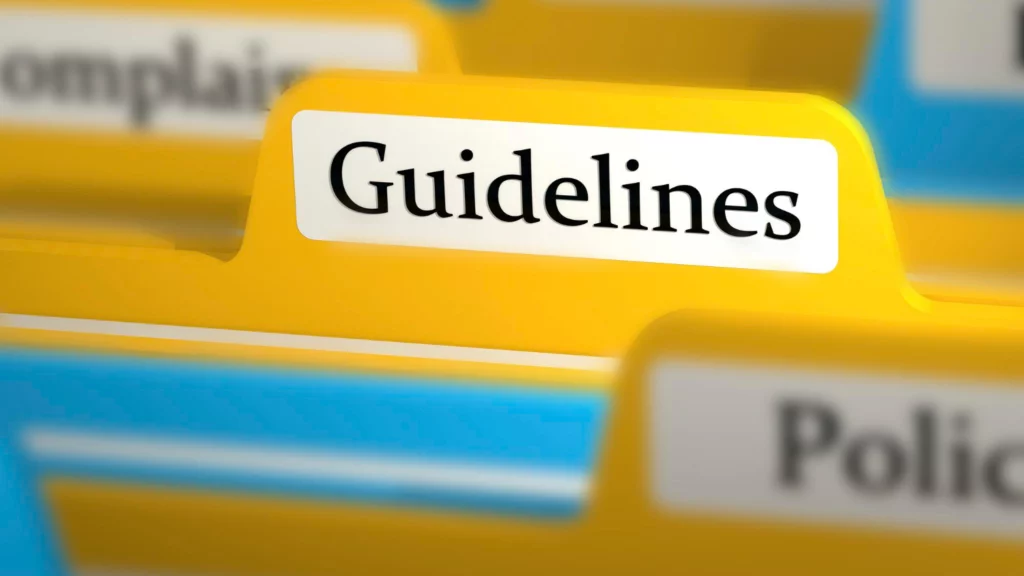Seit 30 Jahren berichtet das Laborjournal „wohlwollend kritisch“ über die Biowissenschaften. Im Interview spricht Gründer Kai-Uwe Herfort über die mühsamen Anfänge und die Herausforderungen des Magazins, als Mittler zwischen Unternehmen und Forschenden zu stehen.
Zwischen Wissenschaft und Wirtschaft – 30 Jahre „Laborjournal“
Herr Herfort, herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen Jubiläum des „Laborjournals“. Sie haben die Zeitschrift damals zusammen mit Hanspeter Sailer gegründet, was war Ihr Antrieb dafür?
Wir waren beide Doktoranden in der Biochemie in Freiburg. Uns hat damals gestört, dass wir oft spannende Vorträge von Forschenden aus unserem Fachgebiet verpasst haben, weil solche Vorträge nur spärlich angekündigt wurden. Das Internet gab es ja noch nicht. So entwickelten wir die Idee eines Journals, um Wissenschaft besser zu vernetzen.
Die erste Idee war eine Art Vortragskalender mit ein paar redaktionellen Beiträgen. Daraus wurde dann über die Jahre ein umfangreiches Nachrichtenmagazin rund um den Laboralltag, mit Erfahrungsberichten von Forschenden, Tipps zu Methoden und Porträts von Biotech-und Pharmafirmen. Wir richten uns damit an Forschende aus den Lebenswissenschaften, aber auch an die Industrie.

Besonders mit diesen Porträts von Biotech-Unternehmen oder Forschenden, die selbst ein Start-up gründen, steht das Laborjournal an der Schnittstelle zwischen Wissenschaftler*innen im Labor und Unternehmen. War das von Anfang an ein Ziel?
Das war eines von vielen Zielen. Aus unserer Sicht ist die Anwendbarkeit eine Besonderheit der Biowissenschaften. Die schnelle Entwicklung von Impfstoffen während der Corona-Pandemie ist ein perfektes Beispiel dafür. Wir möchten mit diesen Porträts zeigen, welche Innovationen, welche neuen Ideen, aber auch mit welchen Schwierigkeiten diese Unternehmen und Start-Up-Gründer*innen umgehen müssen. Dies soll als Inspiration und Hilfestellung für Forschende dienen, die vielleicht selbst mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen. Im Studium und auch in der wissenschaftlichen Arbeit wird solches Wissen viel zu selten vermittelt.
Wir möchten diesen Übergang von der Bioforschung zum Produkt wohlwollend kritisch begleiten. Das heißt, dass wir grundsätzlich den Fortschritt in diesem Feld befürworten, ohne dabei jedes neue Produkt gleichermaßen positiv einzuschätzen. Auch das thematisieren wir.
Häufig wird ja nicht gerne darüber geredet, was nicht gut läuft. Sprechen die Unternehmen sehr offen über die Schwierigkeiten, die sie bei der Unternehmensführung oder -gründung erlebt haben?
Natürlich ist der Umgang mit Firmen immer schwierig, weil sie nicht über alles sprechen möchten, oder die Interviewpartner*innen nicht wissen, über was sie sprechen dürfen. Manchmal reden sie über etwas und möchten es hinterher wieder zurücknehmen, weil die Vorgesetzten verärgert darüber waren.
Bei Start-ups ist es einfacher, das sind häufig junge motivierte Menschen, die etwas unbedarfter und ehrlicher sind und selbst den Antrieb verspüren, anderen mit ihren Erfahrungen zu helfen.
Wenn Sie Unternehmen porträtieren, werben Sie indirekt auch für diese. Entstehen dadurch manchmal Interessenkonflikte für Ihre Redaktion?
Wirkliche Konflikte gibt es nicht. Aber es ist natürlich immer eine Abwägungsfrage. Im Vordergrund muss dabei immer der Mehrwert für die Leser*innen stehen. Es gibt tatsächlich immer wieder Versuche von Unternehmen, redaktionelle Inhalte bei uns zu lancieren. Die wehren wir aber ab. Wir entscheiden selbst über die Inhalte und Werbung wird bei uns immer gekennzeichnet.
Wir wollen aber auch von der Industrie gelesen werden. Das ist für uns wichtig, um Anzeigenkund*innen zu bekommen, damit wir die Zeitung kostenlos anbieten können.
Die Zeitschrift kostenlos zur Verfügung zu stellen, war eine wichtige Entscheidung. Zum einen war es eine wirtschaftliche Überlegung, denn für einen Vortragskalender mit etwas redaktionellem Inhalt – wie es unsere erste Ausgabe noch war – hätten wir wahrscheinlich nicht genügend Abonnent*innen gefunden. Zum anderen erreicht ein kostenloses Magazin natürlich viel mehr Menschen. Deshalb haben wir uns damals für eine hohe Auflage entschieden und sind dieser Strategie bis heute treu geblieben. So erreichen wir eine größere Sichtbarkeit und können die Zeitschrift über Anzeigen finanzieren.
Wie haben die Universitäten und Forschungsinstitute damals reagiert, als Sie ihnen zum ersten Mal Ihre kostenlose Zeitschrift anboten?
Zuerst gar nicht. Am Anfang war es mühsam, einen Verteiler aufzubauen, wie gesagt, es gab ja noch kein Internet. Es fing damit an, dass wir unsere gedruckten Zeitschriften – das waren damals dreieinhalbtausend in der ersten Ausgabe –ins Auto gepackt haben und alle Labore in Freiburg abgefahren sind und gefragt haben, wer Interesse hat. Das waren tagelange Ausflüge durch die Institute. Wenn dann die neuen Ausgaben erschienen sind, haben wir sie in den Laboren auf den Tisch gelegt. Das war unser erster Verteiler. Nach diesem ersten Erfolg haben wir die Verteilung ausgeweitet. Ich habe mit den Sekretariaten aller Institute in Deutschland telefoniert. Das war auch mühsam, aber so konnten wir den Verteiler weiter vergrößern. In Spitzenzeiten hatten wir eine Auflage von 26.000 Stück. 
Was denken Sie, waren wichtige inhaltliche Veränderungen in den letzten 30 Jahren?
Eine wichtige Veränderung war, dass wir auch Missstände thematisiert haben. Wir waren damals unter den Ersten, die Fälschungsfälle in der Forschung aufgedeckt haben. Der Forschungsbetrug von Herr Hermann und Frau Brach in den 90ern war so ein Fall. Darüber hinaus sind wir immer mehr zu einer Anlaufstelle für die Community geworden. Menschen haben sich an uns gewandt, wenn sie Missstände an Universitäten oder Forschungseinrichtungen bemerkt haben, zum Beispiel wenn Kollegen strategisch gemobbt wurden.
Darüber zu berichten, war für uns natürlich extrem schwierig, weil wir solche Vorwürfe immer rechtlich prüfen und genau abwägen mussten, ob wir darüber berichten, weil wir als Medium auch instrumentalisiert werden können. Deshalb konnten wir viele solcher Fälle nicht veröffentlichen. Wir hatten damals auch einige Rechtsfälle. Aber letztlich ist es uns gelungen, uns damit einen Namen zu machen, die Biowissenschaften kritisch, aber wohlwollend zu begleiten und das möchten wir auch künftig tun.