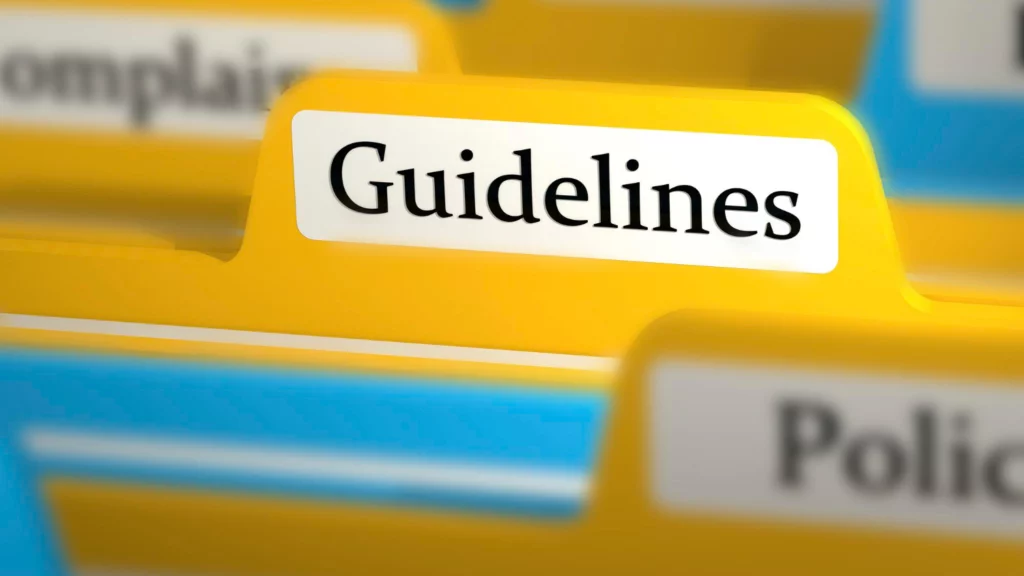Beteiligungs- und dialogorientierte Formate gelten als Goldstandard der Wissenschaftskommunikation. Damit einhergehende Herausforderungen werden jedoch zum Teil wenig erforscht und selten diskutiert, sagt Niels Mede. Im Gastbeitrag blickt der Kommunikationswissenschaftler kritisch auf den Diskurs um Public Engagement.
Partizipative Wissenschaftskommunikation: Promises and Pitfalls
„There is much to say […] on the shift of need from the mere reporting of science to the good reporting of science”1, bemerkte bereits 1947 der amerikanische Neurowissenschaftler Ralph W. Gerard in einem Kommentar im Fachmagazin Science. Er hatte recht: Nach wie vor wird intensiv diskutiert – nicht nur über Merkmale „guter Wissenschaftsberichterstattung“, sondern auch über Kriterien „guter Wissenschaftskommunikation“ im Allgemeinen. Als „Goldstandard“2 der Wissenschaftskommunikationspraxis werden dabei heute oftmals Kommunikationsformate verstanden, die Partizipation und Dialog zwischen Forschenden und der Bevölkerung fördern. Zweifellos glänzen diese Formate, um weiter in der Goldmetapher zu sprechen, durch ihr Potenzial, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und Wissenschaft mithin demokratischer zu gestalten. Doch auch an partizipativer und dialogorientierter Wissenschaftskommunikation kann Kritik geübt werden – zumindest insofern, als sie mit Herausforderungen einhergeht, die zum Teil wenig erforscht und selten diskutiert werden.
Von „Public Understanding“ zu „Public Engagement“
Debatten über die Gütekriterien von Wissenschaftskommunikation liegt die normative Frage zugrunde, was Ziele von Wissenschaftskommunikation sein sollten3. Wenn man in dieser Frage einen Konsens erreiche, ließe sich schließlich recht einfach ableiten, was Merkmale „guter Wissenschaftskommunikation“ sind. Jenen Konsens schien man durchaus mehrmals gefunden zu haben: Lange Zeit herrschte Einigkeit, dass Wissenschaftskommunikation primär dem Austausch unter Forschenden diene – im sprichwörtlichen Elfenbeinturm spielte die nicht-wissenschaftliche Öffentlichkeit kaum eine Rolle. Spätestens in den 1980er-Jahren sorgten sich politische Entscheidungstragende allerdings um die öffentliche Legitimation der Wissenschaft, die sie durch Wissens- und Akzeptanzdefizite in der Bevölkerung gefährdet sahen. Primäres Ziel von Wissenschaftskommunikation sollte es fortan sein, das Public Understanding of Science zu fördern und so jene Defizite zu beseitigen. Dabei sei „gute Wissenschaftskommunikation“ vor allem solche, die umfangreiches wissenschaftliches Fachwissen in die Gesellschaft transportiere und Wissenschaft dabei möglichst in gutem Licht dastehen ließe. Einer angeblich uninformierten Bevölkerung sollte also gewissermaßen „science du chef“ serviert werden, wie Massimiano Bucchi es ausdrückte4.
Nach der Jahrtausendwende verbreitete sich jedoch die Auffassung, dass Wissenschaftskommunikation nicht nur Wissen transportieren, sondern auch Partizipation und Dialog zwischen Wissenschaft und Bevölkerung fördern und zu Public Engagement with Science and Technology anregen sollte. Dieses Umdenken fand nicht zuletzt deshalb statt, weil wissenschaftspolitische Programme zur Förderung des Public Understanding kaum zu Wissensdefizitabbau und Akzeptanzsteigerung beizutragen schienen5 und die Digitalisierung nunmehr neue Medienkanäle und Kommunikationsformen hervorbrachte, die Partizipation und Dialog vereinfachten6.
Die Potenziale partizipativer Wissenschaftskommunikation
Partizipative und dialogische Wissenschaftskommunikation wird seither oft als „Goldstandard“ beschrieben. Denn im Gegensatz zu Ansätzen, die Wissenschaftskommunikation vorrangig als erzieherische Vermittlung von Fachwissen an ein passives Lai*innenpublikum verstehen, orientiere sie sich stärker an den Kompetenzen, Bedürfnissen und Kommunikationsroutinen einer mündigen Bevölkerung. So will sie Bürgerbeteiligung ermöglichen (beispielsweise in Partizipationsformaten wie dem Ideenlauf), Informations- und Kommunikationshürden zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit reduzieren (beispielsweise durch Open-Science-Praktiken wie Open Access), Einblicke in den Prozess wissenschaftlicher Wissensproduktion geben (beispielsweise in Citizen-Science-Projekten), mediale Interaktionsangebote machen (beispielsweise in dem Twitter-Kanal „Real Scientists“), wissenschaftskritische Vorbehalte berücksichtigen (beispielsweise Skepsis und Anfeindungen in sozialen Medien), und auch nicht-rationale, subjektive, narrative und emotionalisierende Kommunikation erlauben (beispielsweise in Unterhaltungsmedien wie Netflix-Serien oder Science Games).
Wissenschaftskommunikation, die auf Public Engagement abzielt, kann somit demokratischer, inklusiver und transparenter sein als jene, die sich am Public-Understanding-Modell orientiert. Sie bettet Wissenschaft stärker in die Gesellschaft ein, verschafft ihr damit stärkere öffentliche Legitimation – und kann ihr nicht zuletzt auch als Feedback-Kanal zur Selbstreflexion dienen. Ist dialog- und partizipationsorientierte Wissenschaftskommunikation also „gute Wissenschaftskommunikation“?
Limitationen und Herausforderungen des Public-Engagement-Ansatzes
So etabliert das Public-Engagement-Modell in der wissenschaftlichen Forschung auch ist, so groß die Wertschätzung für partizipative Kommunikationsformate unter Wissenschaftskommunikator*innen auch sein mag, und so sehr die Politik für jene Formate auch Anreize setzt – partizipations- und dialogfördernde Wissenschaftskommunikation lässt sich dennoch kritisieren7: Bürger*innenbeteiligungsformate erreichen oftmals nur jene Bevölkerungsgruppen, die ohnehin schon wissenschaftsaffin sind8 – und sind damit womöglich weniger demokratiestiftend als beabsichtigt. Der Abbau von Informationsbarrieren zwischen Forschung und Öffentlichkeit durch Open-Access-Strategien ist in vielerlei Hinsicht äußerst wünschenswert. Gleichwohl wurde kritisiert, dass Open-Science-Praktiken durch westliche Normvorstellungen geprägt und eine Luxuspraxis finanzstarker Exzellenz- und Eliteinstitutionen seien9. Ob sie Inklusion und Transparenz also im erwarteten Maße fördern, kann aus diesem Blickwinkel hinterfragt werden. Unterdessen gibt es zu den (langfristigsten) Effekten partizipativer Wissenschaftskommunikation kaum empirische Evidenz. Ob sich Citizen-Science-Formate etwa nachhaltig auf Wissenserwerb und Einstellungen der Teilnehmenden auswirken, ist somit unklar. Ebenso sind die Wirkungen interaktiver Kommunikationsformate in Onlinemedien kaum erforscht – sowohl zu Effekten auf User*innen als auch zu Rückwirkungen auf Wissenschaftskommunikator*innen gibt es wenig robuste Evidenz10. 
Insgesamt könnte man dialog- und partizipationsorientierter Wissenschaftskommunikation also vorwerfen, dass sie oft nur ein bereits wissenschaftsaffines Publikum adressiere und somit gewissermaßen ein „engaging with the converted“ sei, insofern also wissenschaftskritische Zielgruppen kaum erreiche, zudem empirisch schwach abgestützt ist, und praktische Konsequenzen, ethische Implikationen und normative Standpunkte zu wenig diskutiert. Aus dieser Perspektive muss Public Engagement with Science and Technology also nicht notwendigerweise „gute Wissenschaftskommunikation“ sein.
Größere gesellschaftliche Kontexte berücksichtigen
Partizipative und dialogorientierte Wissenschaftskommunikation ist also mit einigen Herausforderungen und offenen Fragen verbunden. Gleichwohl hat sie bereits viel zu einer besseren Einbettung von Wissenschaft in die Gesellschaft beigetragen. Insofern sollte sie weiterhin praktiziert und gefördert werden. Zugleich muss sie jedoch auch weiter erforscht, evaluiert und kritisch diskutiert werden: So sollten weitere Wege zur Ansprache wissenschaftskritischer Zielgruppen erschlossen, mehr empirische Evidenz gesammelt, Wissenschaftskommunikator*innen besser beim Umgang mit Anfeindungen unterstützt, ethische Implikationen stärker berücksichtigt und normative Standpunkte häufiger reflektiert werden. Dies mag denn auch erfordern, Wissenschaftskommunikation nicht nur als Interaktion zwischen Wissenschaft und Bevölkerung zu verstehen, sondern sie vor einem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund zu betrachten13. „Gute Wissenschaftskommunikation“ sollte also nicht nur auf Wissensvermittlung fokussieren und öffentliche Teilhabe befördern, sondern auch politische Kontroversen, mediale Dynamiken und ethische Streitfragen mitdenken14.
Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider.