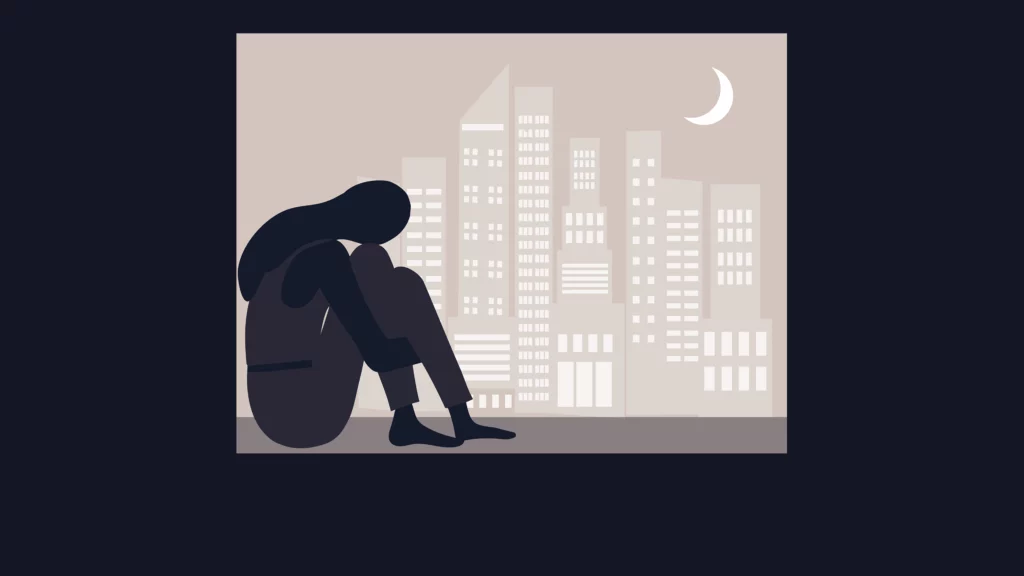Sollten sich Forschende in ihrer Kommunikation mehr auf Evidenz und weniger auf Storytelling fokussieren? Das fordert ein Beitrag auf Nature.com und stellt fünf Regeln für Evidenzkommunikation vor. Mike S. Schäfer erklärt im Kommentar, warum das kein Gegensatz sein muss und eine „One size fits all“-Kommunikation nicht geeignet ist.
Evidenz statt Story? Evidenz und Story!
Die „Five Rules for Evidence Communication” von Michael Blastland und Team thematisieren eine Kernfrage der Wissenschaftskommunikation: Soll diese vornehmlich die wissenschaftliche Evidenz zu einem Thema aufbereiten, sie dem Publikum sachlich und forschungsadäquat darlegen, dabei auf die Qualität des entsprechenden Wissens und etwaige Unsicherheiten hinweisen – und mögliche Interpretationen, Folgerungen und Handlungsempfehlungen dem Publikum selbst oder gar anderen, weniger kenntnisreichen oder gar böswilligen, Akteurinnen und Akteuren überlassen?
Oder soll sie versuchen, das Publikum von bestimmten Interpretationen oder Folgerungen zu überzeugen, strategisch und persuasiv zu kommunizieren, um eine gewünschte Wirkung zu erzielen?
Unter den Forschenden zu Wissenschaftskommunikation gibt es beide Positionen, die Hans Peter Peters in seinem Kommentar zusammenstellt. Die Antwort des Teams um Blastland vom Winton Centre for Risk and Evidence Communication der britischen Cambridge University ist jedenfalls klar: „Evidenzkommunikation“ solle das Publikum „informieren, aber nicht überzeugen“ („inform but not persuade“). Sie solle Storytelling und „neat narratives“ vermeiden, sich auf die Darstellung von Evidenz fokussieren, diese angemessen darstellen, in ihrer Robustheit einordnen und Unsicherheiten offenlegen. Dies müsse durch kommunikative Maßnahmen flankiert werden: Es sei wichtig, nicht nur die fachliche Expertise von Forschenden darzulegen, sondern auch ihre Ehrlichkeit und ihre Orientierung am Gemeinwohl zu demonstrieren. Zugleich solle man das Publikum gegen persuasive Kommunikation von „bad actors“ – etwa COVID-Skeptikerinnen und Skeptikern, Impfgegnerinnen und Impfgegnern oder Klimaskeptikerinnen und Klimaskeptikern – so gut wie möglich immunisieren („ inoculation“), indem man es beispielsweise mit den argumentativen Strategien dieser Akteurinnen und Akteure vertraut mache.
Aber ich würde vor einer Verabsolutierung des Argumentes von Blastland und Co. warnen. Zwar räumen die Autorinnen und Autoren eingangs ein, dass auch „persuasive Kommunikation“ erfolgreich und in bestimmten Situationen angemessen sein könne. Aber sie verstehen „persuasive“ und „Evidenzkommunikation“ letztlich doch als Gegensatzpaar, bei dem Evidenzkommunikation vorzuziehen sei.

Dabei geraten – nicht untypisch für psychologische Forschung, die überwiegend mit experimentellen Forschungsdesigns arbeitet und Unterschiede zwischen Personen als vermeintliche Störvariablen auszuschließen versucht – soziale Strukturierungen aus dem Blick. Es wird letztlich ein „One Size Fits All“-Modell von Kommunikation vorgeschlagen, das für alle Publikumssegmente gleichermaßen geeignet sei.
Weitere Kommentare zum Thema
Hans Peter Peters: „Wahrheit oder Wirkung?
Martin W. Bauer: „Die Ironie des Regelsets“
Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider.