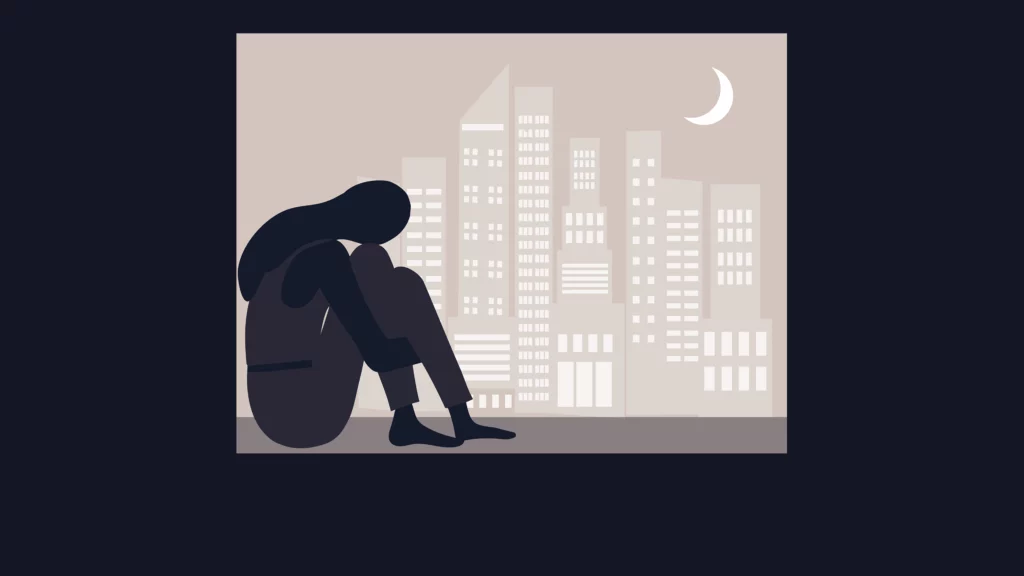Wie verändert der digitale Raum die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen? Medienwissenschaftlerin Christina Schachtner ist dieser Frage in ihrem Buch „Das narrative Subjekt“ nachgegangen. Im Interview berichtet sie von besonderen Merkmalen digitaler Geschichten und davon, wie wir alle stets darum bemüht sind, gesehen zu werden.
Erzählen im Zeitalter des Internets
Frau Schachtner, welche Funktionen haben Geschichten heute für die Menschen?
Beim Geschichtenerzählen spielen heutzutage gesellschaftliche Veränderungen wie Individualisierung, Enttraditionalisierung und Pluralisierung eine Rolle. Damit verbunden sind viele Herausforderungen für uns einzelne Menschen. Die Individualisierung bietet neue Freiheiten und Chancen. Sie birgt jedoch zugleich die Gefahr des Alleinseins, des Nicht-Verbundenseins mit anderen. Enttraditionalisierung bedeutet, dass traditionelle Werte und Lebensmodelle an Gültigkeit verlieren und damit Orientierungsmuster verschwinden, an denen man Lebenspläne festmachen konnte. Die einzelnen Menschen sind bei der Suche nach neuen Werten auf sich selbst geworfen. Die Pluralisierung der Gesellschaft führt dazu, dass sich die Lebensräume vervielfältigen, in denen wir unterschiedliche Aufgaben erfüllen und Rollen spielen müssen. Erzählungen dienen dazu, sich mit diesen Herausforderungen auseinanderzusetzen und sie zu meistern.
Wie wird damit umgegangen?

In einer Gesellschaft wie der unsrigen kann es zu bestimmten Themen konkurrierende Narrationen – also Erzählungen – geben. Ein aktuelles Beispiel ist das Thema Flüchtlinge: Medien präsentieren verschiedene Narrationen, politische Parteien generieren teilweise andere Narrationen, im Gespräch mit Freunden und Nachbarn stoßen wir auf wieder andere Narrationen. Hier muss der Einzelne entscheiden, welche Narrationen oder Narrationsstücke er aufnimmt und miteinander verbindet, um sich zu positionieren. Darauf läuft es hinaus: Wir wollen durch unsere Narrationen ein Verhältnis zur gesellschaftlich-kulturellen Realität gewinnen. Wir wollen in ihr einen sicheren Platz haben und im Austausch mit anderen sein. Narrationen dienen auch dazu, Kontakte und Verbindungen zu anderen herzustellen. Sie helfen darüber hinaus, für sich selbst Klarheit zu finden, darüber, wer man ist und was man will. Das Erzählen ist eine existenzielle Aktivität, die im menschlichen Leben unverzichtbar ist.
Wir erzählen in Worten, aber auch in Bildern und in unseren Handlungen. Das ist nichts Neues, aber es wird durch die digitalen Möglichkeiten forciert. Auch knappe, scheinbar belanglose Erzählungen wie Statusmeldungen in den sozialen Medien haben ihre Bedeutung. Sie dokumentieren die Sorge, dass man verloren gehen könnte, dass man nicht gesehen wird. Sie entspringen dem Wunsch, präsent zu sein und dazuzugehören. Solche Ängste und Wünsche sind eingebettet in die angesprochene gesellschaftlich-kulturelle Entwicklung, die das Risiko der Vereinsamung oder des Alleinseins enthält.
Was ist dann das Besondere am Erzählen im Internet?
Das Internet ist ein neuer Erzählraum, der über ganz spezifische Merkmale verfügt, die sowohl die Form als auch die Inhalte des Erzählens prägen. Es ist ein interaktives Medium. In dieser Hinsicht unterscheidet es sich deutlich von den bisherigen audiovisuellen Medien. Die Interaktivität sorgt dafür, dass wir überhaupt zu Erzählerinnen und Erzählern im Netz werden. Wir können selbst das Wort ergreifen, wenn wir über Schreibkompetenz und die nötigen Geräte verfügen, was wir in anderen Medien zum Beispiel im Fernsehen nicht ohne Weiteres können. Das Medium Internet zeichnet sich zudem durch seine Netzstruktur aus, die dafür sorgt, dass die Erzählungen ins Laufen kommen, sich verbreiten, und zwar in einem rasanten Tempo. Außerdem haben wir es mit einem multimedialen Medium zu tun, das uns eine Vielzahl an Ausdrucksmitteln bietet. Das führt zu ganz neuartigen Erzählformen, bei denen diese verschiedenen Ausdrucksmittel miteinander verbunden werden. So entstehen bisher nicht gekannte Text-Bild-Sound-Narrationen.
Die digital gestützten Erzählungen haben meist kein Ende; sie werden häufig abgebrochen und zu einem anderen Zeitpunkt oder in einer anderen Situation wieder aufgenommen. Es entwickeln sich dynamische Erzählungen, die Widersprüche enthalten können und bei denen Gesagtes auch wieder zurückgenommen werden kann.
Liegt hierin der Unterschied zwischen digitalen und analogen Geschichten?
Genau, die Erzählungen folgen nicht der klassischen Vorstellung, dass Erzählungen immer einen Anfang und ein Ende haben. Für unsere Studie „Kommunikative Öffentlichkeiten im Cyberspace“1 haben wir Jugendliche und junge Erwachsene zu ihrem Kommunikationsverhalten im Netz befragt. Dabei haben wir festgestellt, dass die Interviewten keine zusammenhängenden Geschichten erzählen, sondern vielmehr Episoden und Szenen. Man könnte von einem fragmentarischen Erzählen sprechen. Erst durch die systematische Auswertung dieser Episoden im Forschungsprozess erschließt sich eine Narration. Sie ist den Erzählern und Erzählerinnen nicht notwendigerweise bewusst. Man kann sich die im Forschungsprozess identifizierte Narration als ein unterirdisches Gespinst vorstellen, dem die erzählten Episoden entspringen und das diesen Episoden ihren Sinn gibt.
Der Anfang der Narrationen bleibt oft vage, das Ende fehlt, wie erwähnt, immer. So können die Narrationen endlos fortgesetzt werden. Die losen Enden erlauben zudem, die eigene Narration mit anderen Narrationen zu verknüpfen. Das haben wir zum Beispiel bei einem arabischen Interviewpartner festgestellt, der in Form von Fotoserien erzählt, die er mit Fotoserien anderer Fotografen verknüpft, woraus kollektive Erzählprojekte entstehen.
Und diese vielen Erzählfragmente stehen dann alle gleichwertig nebeneinander?

Ist das Internet besonders geeignet für diese Art Erzählungen oder ist es dieser virtuelle Raum, der die Notwendigkeit zum Erzählen erst hervorbringt?
Ich glaube, es handelt sich um ein Zusammenspiel zwischen dem einzelnen Menschen, den gesellschaftlichen Entwicklungen und dem virtuellen Raum: Die gesellschaftliche Entwicklung fordert durch ihre Provokationen nicht nur das Erzählen heraus, sie fordert auch dazu auf, sich sichtbar zu machen, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken – die Konkurrenz ist groß. In den virtuellen Räumen haben wir nicht nur einen neuen Ort, um diese Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, sondern auch neue Mittel dazu. Zudem sichert uns der virtuelle Raum als Netzmedium sowohl lokale als auch potenziell weltweite Aufmerksamkeit.
Für die Erzähler und Erzählerinnen ist die Wirkung auf andere bedeutsam. In unserer Studie, die ich auch in dem Buch „Das narrative Subjekt“ beschrieben habe, sprachen die Teilnehmenden stets – obwohl wir gar nicht danach gefragt hatten – über ihre Follower. Für die Befragten sind die Follower ein wichtiges Indiz dafür, dass sie gelesen, gesehen und gehört werden. Reaktionen der Follower sind erwünscht, vor allem positive; Kritik soll nur in „sanften Dosen“ erfolgen. Spannend finde ich, dass wir uns alle so unheimlich anstrengen mit unserer eigenen Netzpräsenz, obwohl wir oft gar nicht wissen, ob sie von anderen wahrgenommen wird und was sie bei ihnen auslöst. Wir investieren viel Zeit und Ideen trotz dieser Ungewissheit. Das zeigt, wie stark unsere Wünsche nach Anerkennung und Zugehörigkeit sind.