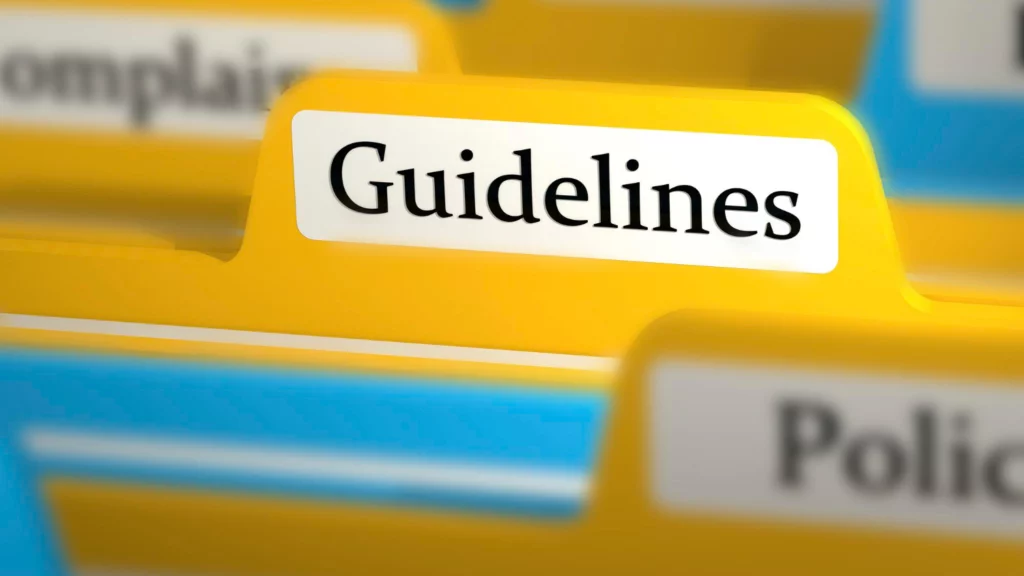Eine verständliche Sprache ist Voraussetzung für erfolgreiche Kommunikation. Wie man sich klar ausdrückt, erklären die Kommunikationswissenschaftler*innen Frank Brettschneider und Claudia Thoms im Gespräch.
„Wissenschaftskommunikation sollte klar sein in dem, was sie mitteilt“
Herr Brettschneider, welche Idee steckt hinter der Klartext-Initiative und welche Ziele verfolgt sie?

Brettschneider: Wir haben die Initiative vor zehn Jahren an der Universität Hohenheim gegründet. Die Idee dahinter war, dass die Universität zahlreiche Stakeholder und Zielgruppen hat, mit denen sie kommuniziert: Intern die Student*innen, Mitarbeiter*innen in der Verwaltung und den wissenschaftlichen Abteilungen und extern Wissenschaftler*innen und die Öffentlichkeit. Wir betreiben Wissenschaft nicht im luftleeren Raum und nicht für den Elfenbeinturm, sondern auch für die Bevölkerung. Sie soll verstehen, was alles in der Welt vor sich geht und daraus Handlungsoptionen ableiten. Und da gilt der alte Satz: „Nur wer verstanden wird, kann auch überzeugen.“ Diesen Satz haben wir als Leitsatz der Klartext-Initiative genommen und uns gefragt: Wie gelingt es, dass unsere Botschaften auch bei den Empfänger*innen ankommen, wie es beabsichtigt war? Dabei haben wir Defizite wahrgenommen und uns Gedanken gemacht, wie man diese Hürden abbauen kann.
Frau Thoms, was zeichnet klare Sprache aus?
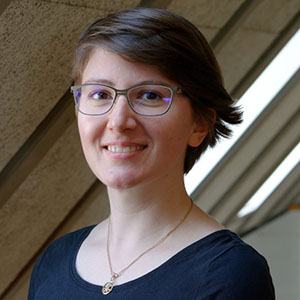
Thoms: Ganz grundlegend: die Klarheit der Gedanken. Die Struktur eines Textes hilft den Leser*innen, meinen Gedanken zu folgen. Das gelingt, indem ich meinem Text einen klaren Aufbau gebe. Zwischenüberschriften helfen, den Text zu strukturieren. Und es gelingt, indem ich nicht zu viel in einen einzelnen Satz hineinpacke. Es gilt: ein Gedanke, ein Satz.
Auch das Vokabular ist entscheidend. Wenn ich ein Wort benutze, das die Leser*innen nicht verstehen, steht es erst einmal im Weg, wie eine Blockade. Sie verstehen eventuell den Satz nicht, und dann womöglich auch die Aussage des Textes nicht. Natürlich lassen sich bestimmte Begriffe – gerade in der Wissenschaft – manchmal nicht vermeiden. Dann kann ich sie erklären oder umschreiben.
Bei der Wortwahl oder der Satzstruktur kann teilweise Software dabei unterstützen, Texte verständlicher zu gestalten. Beim klaren Aufbau, dem roten Faden eines Textes, ist das schon schwieriger. Denn dafür muss ich im Blick haben, was ich schreiben möchte und welches Ziel ich mit meinem Text verfolge.
Was sind die größten Hürden, die Ihnen aufgefallen sind?
Brettschneider: Früher waren Schreiben an Studierende beispielsweise sehr juristisch. Zu Beginn wurden die ganzen Rechtsquellen aufgelistet, bevor man zur zentralen Botschaft kam, nämlich „Sie sind zugelassen für das Studienfach“ – oder eben nicht. Wir haben der Verwaltung geraten, den Text anders zu gliedern und mit der entscheidenden Aussage zu beginnen. Eine Kleinigkeit, die viel Wirkung hatte.
Auch auf der sprachlichen Ebene gibt es immer wieder Hürden. Im Deutschen sind zusammengesetzte Wörter sehr beliebt. Der Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitänsmützenhalter ist das prominenteste Beispiel, aber auch darüber hinaus ketten wir oft viele Worte aneinander, was der Lesbarkeit schadet. Außerdem schleichen sich immer wieder Passiv-Formulierungen, zu lange Sätze und Schachtelsätze ein. Auch Substantivierungen anstelle von Verben zu verwenden, macht einen Text weniger verständlich.
Frau Thoms, Sie sprachen Software an. Sie setzen die Software „TextLab“ ein, um Texte auf ihre Verständlichkeit zu analysieren. In welchen Bereichen findet sie Anwendung?
Thoms: Wir setzen sie neben anderen Tools in der Forschung ein, bei unseren Analysen beispielsweise zu Wahlprogrammen oder Reden von CEOs. Aber auch in der Verwaltung oder bei Abschlussarbeiten wird sie verwendet.
Brettschneider: Die Software funktioniert sehr einfach. Sie packen Ihren Text hinein und erhalten Hinweise, wie verständlich er ist. „TextLab“ zeigt auch Verständlichkeitshürden an. Die Software funktioniert ähnlich wie ein Rechtschreibprüfprogramm, quasi ein Verständlichkeits-Prüfprogramm. Sie liefert eine Orientierung, den Text umschreiben müssen die Redakteur*innen dann immer noch selbst.
Welche Verständlichkeitshürden hat die Software beispielsweise bei der Analyse der Wahlprogramme aufgezeigt?
Warum sind Wahlprogramme unverständlich geschrieben?
Thoms: Die Ursachen liegen meist in den sehr spezifischen Inhalten und daran, wie sie zustande kommen. Die unterschiedlichen Parteistränge müssen beispielsweise zu einem Kompromiss gelangen. Dieser Aushandlungsprozess wird im Text sichtbar.
Es gibt auch Studien dazu, dass Populist*innen eher auf eine einfache Sprache zurückgreifen, damit ihre Ideen auch vom „einfachen Volk“ verstanden werden können und um sich von der vermeintlich abgehobenen politischen Elite abzugrenzen. Und: Wenn Parteien Kritik an der Regierung üben oder eigene Erfolge betonen, ist das häufig verständlicher geschrieben als die eigenen Misserfolge.
Ist Sprache dabei auch ein Werkzeug, um bestimmte Aspekte zu verschleiern?
Brettschneider: Eine Arbeit an unserem Lehrstuhl hat einmal die Verständlichkeit der großen Regierungserklärungen unter die Lupe genommen. Sie werden von einem großen Team von Redenschreiber*innen verfasst und durchlaufen zahlreiche Abstimmungsschleifen. Da ist kein Wort Zufall.
In der Studie wurde die Regierungserklärung in thematische Abschnitte unterteilt und mit Umfragedaten zum jeweiligen Thema verglichen. Passagen zu populären Themen waren verständlich, unpopuläre Aussagen unverständlich. Das ist kein Zufall, sondern taktische Unverständlichkeit.
Sie haben auch die Pressemitteilungen der Regierung zur Coronapandemie und den damit verbundenen Schutzmaßnahmen analysiert. Wie sieht in diesem Fall Ihr Urteil aus?
Woran liegt es, dass diese wichtigen Informationen unverständlich sind?
Brettschneider: Ein Grund ist, anders als bei den Wahlprogrammen, der enorme Zeitdruck. Oft sind die Presseinformationen in der Nacht der Bund-Länder-Beschlüsse verfasst worden. Unter Zeitdruck verfällt man in Routinen, und in der Behördensprache sind das lange Sätze, Schachtelsätze und Passivkonstruktionen. Dazu kommt, dass Gesundheitsexpert*innen beteiligt sind, die im Stress vergessen, wer ihre Zielgruppe ist und ihre Aussagen nicht für Lai*innen übersetzen. Wir nennen das den „Fluch des Wissens“.
Was sind die größten Herausforderungen, wenn man wissenschaftliche Themen verständlich kommunizieren möchte?
Brettschneider: Für Wissenschaftler*innen ist das sicherlich, die Vorstellung zu überwinden, dass das eigene sehr komplexe, detaillierte Wissen genauso komplex kommuniziert werden muss. Das muss es nicht. Dass das geht, zeigt Christian Drosten. In der Kommunikation mit der Bevölkerung verzichtet er auf gewisse Details und stellt nur das Wesentliche heraus. Es gilt die richtige Balance zu finden: Die Aussagen mögen nicht vollständig das komplexe Wissen widerspiegeln, aber sie sollten stimmen. Auch auf die Gefahr hin, dass jemand sagt, das wäre zu trivial.
Welche Konsequenzen haben unverständliche Texte?
Brettschneider: Dass sie nicht gelesen werden. Ein unverständlicher Text kann zudem dazu führen, dass man etwas falsch versteht, beispielsweise wenn Formulierungen nicht eindeutig sind. Und diese Fehlinformationen führen wiederum zu falschem Verhalten. Deshalb sind verständliche Texte beispielsweise besonders wichtig bei Arbeitsanweisungen zu Gefahrenvermeidung.
Thoms: … oder auch bei Beipackzetteln von Medikamenten. Verständlichkeit oder Unverständlichkeit können außerdem bereits für sich bestimmte Wirkungen erzeugen, die darüber hinausgehen, ob ich etwas verstanden habe oder nicht. Unverständlichkeit kann beispielsweise unangenehme Gefühle auslösen. Man fühlt sich womöglich getäuscht und hat den Eindruck, dass ein Text absichtlich unverständlich ist und ärgert sich darüber.
Wie kann verständliche Kommunikation dazu beitragen, dass man Transparenz und Vertrauen in die Wissenschaft schafft?
Thoms: Die Wissenschaftskommunikation sollte klar sein in dem, was sie mitteilt. Damit lässt sich vermeiden, dass das Gefühl entsteht, es werde da etwas verkauft, was man nicht will.
Aktuell sieht man das in Bezug auf die Impfungen und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Es ist es wichtig, den Menschen zu vermitteln, was das für sie bedeutet, welche Folgen es hat, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, verständlich zu kommunizieren.

Es kommt noch ein anderer Grund hinzu, warum Verständlichkeit mit Blick auf die Öffentlichkeit wichtig ist: Barrierefreiheit. Wenn der Ausgangstext schon verständlich ist, ist der Schritt zum barriereärmeren Text – also zu Leichter Sprache – leichter zu gehen. Der eine ist das Ausgangsmaterial für den anderen.
Es gibt aber noch immer Kolleg*innen im Wissenschaftsbereich, die glauben, nur komplizierte Sätze sind hochwertige Sätze. Unverständlichkeit wird da zum Qualitätsmerkmal. Das ist eine Denkweise, die wir getrost in die Mottenkiste packen können.
Wir sprechen zehn Jahre nach Projektstart der Klartext-Initiative. Was ist Ihr Zwischenfazit?
Brettschneider: Die Klartext-Initiative ist erstaunlich gut gestartet. Viele haben mitgemacht. Anfangs haben mehr Menschen mit der Software gearbeitet, aber das heißt nicht zwingend, dass das Interesse nachgelassen hat. Unser Ziel ist es, dass der Umgang mit Sprache in Fleisch und Blut übergeht, dass man automatisch verständliche Texte schreibt. Vielleicht wird die Software nach gewisser Zeit nicht mehr benötigt.
Zu Beginn hatten wir einen Klartext-Beirat, der die Klartext-Regeln aus bestehenden Regelwerken wie Handreichungen und Leitfäden sowie auf Basis existierender Verständlichkeitsmodelle zusammengetragen hat. Wir haben auch ein Klartext-Siegel eingeführt. Jeder Text, der bestimmte Klartext-Kriterien erfüllt, durfte dieses Siegel tragen. Ich fand es ein überflüssiges Gimmick, der Beirat aber fand es notwendig. Er hatte recht. Das Siegel hat viele motiviert, ihre Texte verständlicher zu schreiben.
Inzwischen würde ich sagen, dass wir einen Übergang in Routine sehen. Unseren Beirat haben wir seit acht Jahren nicht mehr einberufen.