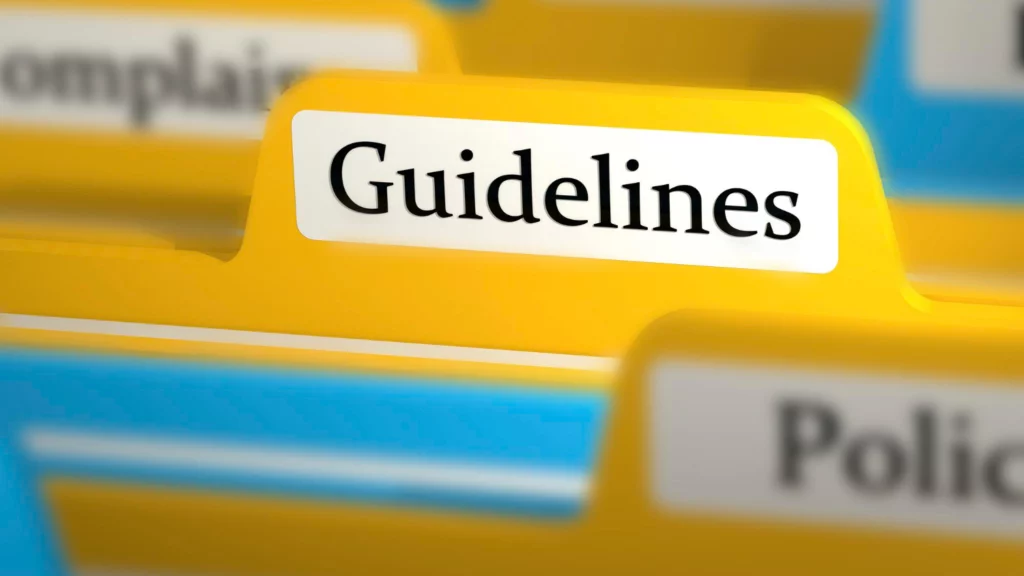Der sogenannte Matthäus-Effekt sorgt dafür, dass in Auswahlverfahren diejenigen eher berücksichtigt werden, die ein starkes Netzwerk, ein gutes Elternhaus oder eine Eliteuniversität besucht haben. Soziologin Katja Rost untersucht, was das für Berufungsverfahren an Hochschulen bedeutet und erklärt, wie das wiederum die Wissenschaftskommunikation beeinflusst.
„Wer hat, dem wird gegeben“
Frau Rost, Sie forschen im Bereich Organisationssoziologie mit einem Schwerpunkt auf Erfolgsfaktoren von Personen in Hierarchien. Was beeinflusst, ob jemand erfolgreich ist?
Leistung und Talent spielen zunächst eine große Rolle. Je weiter man aber in Organisationen oder auch der Gesellschaft nach oben kommt, umso wichtiger werden andere Eigenschaften. Dazu gehört das Sozialkapital, also welchen Zugriff man auf soziale Netzwerke hat, oder kulturelles Kapital wie der Habitus, dass man sich in einer bestimmten Klasse adäquat verhalten kann. Eine ganz große Rolle spielt aber auch Glück, dass man zur rechten Zeit am rechten Ort ist oder der sogenannte Matthäus-Effekte: Wer hat, dem wird gegeben.
Wie zeigt sich dieser Matthäus-Effekt in Karrierekontexten?
Ab einer gewissen Stufe wird deutlich, dass man Karrieren nur bedingt planen kann. Bis dahin kann man sich hocharbeiten. Top-Karrieren hat man aber kaum in der Hand. Als Gesangstalent kann man sich zum Beispiel einen gewissen Namen und ein Einkommen erarbeiten. Man kann aber nicht beschließen, die nächste Madonna zu werden. Talent allein ist keine Garantie dafür, ganz nach oben zu kommen. Es ist sogar so, dass diejenigen mit einem mittelmäßigen Talent, das leicht über dem Durchschnitt liegt, eher eine Top-Karrieren machen als diejenigen, die Top-Performer sind.
Was bedeutet das für das System Wissenschaft?

Derzeit suggerieren die Kriterien für Verfahren, dass diejenigen gewinnen, die am talentiertesten sind. Wenn man aber die Gründe erforscht, die zum Erfolg führen, kann man belegen, dass das nicht immer oder auch oft nicht der Fall ist. Das ist natürlich problematisch. Gerade in der Wissenschaft möchte man eher die Nerds haben, die herausragend in ihrem Fach sind. Sie lebt von Zufallsentdeckungen, von Genies und Querdenkern. Viele der Großen, wie etwa Einstein, waren eher Außenseiter und haben mit einer Nischenbegabung und viel Arbeit ihre Forschung vorangetrieben. Das ist in der heutigen Gesellschaft anders. Es ist alles glattgebügelt, die Aufmerksamkeitsökonomie spielt eine große Rolle und Menschen die sich gut auf dem sozialen Parkett bewegen können und gut aussehen haben öfter Erfolg.1 In der Wissenschaft geht es um die Top-Hochschulen oder Top-Journals und die Quantität der Publikationen darin. Leute, die sich so eine Ausbildung nicht leisten können, weniger breit publizieren und etwa nicht dieses kulturelle Kapital haben, haben es darum viel schwerer etwa in Berufungsverfahren zu bestehen.2 Das Problematische ist zum einen, dass eine Fehlselektion stattfinden. Es werden Talente vergeudet, weil sie einfach nicht ausgewählt werden.3 Zum anderen wird Chancengleichheit vorgegaukelt. Aber diejenigen, die aus einem guten Elternhaus kommen, haben aus verschiedenen Gründen einfach mehr Chancen.4 Das will man im heutigen Bildungssystem ja aber eigentlich vermeiden. Außerdem werden bei solchen rein kompetitiven Auswahlverfahren eher Männer ausgewählt.5 Ein dritter Punkt ist, dass Selbstüberschätzung gefördert wird. Diejenigen, die eine Top-Position bekommen haben, fühlen sich als Helden, weil ihnen über dieses Auswahlverfahren suggeriert wird, dass sie die Besten sind, eine klassische Hybris.
Was bedeuten die Erfolgsfaktoren und Effekte für die Wahrnehmung von Wissenschaft in der Öffentlichkeit?
Wie können Auswahlverfahren so verändert werden, dass Matthäus-Effekt und Co nicht mehr so stark wirken?
Meine Forschungsgruppe plädiert dafür, wieder mehr Zufallselemente in Auswahlverfahren einzubauen. Das ist in Expertenorganisationen etwas schwieriger als zum Beispiel in der Demokratie. Da kann man sagen: Wir brauchen eine repräsentative Gruppe im Amt und jeder hat hier das Recht, eine Person zu wählen die ihn oder sie vertritt. Das geht in Expertenorganisationen so direkt aber nicht. Wenn man eine Professur besetzen möchte, muss die Person ein bestimmtes Maß an Qualifikationen mitbringen. Wenn man hier durch eine formale Auswahl mehrere Personen identifiziert hat, könnte man zum Beispiel das Los entscheiden lassen. Das ist dann ein partielles Zufallsverfahren. Damit könnte man viele der zuvor genannten Effekte wie kulturelles Kapital oder soziale Netzwerke umgehen und auch der Hybris der Personen im Amt entgegenwirken. Man sorgt so außerdem für mehr Chancengleichheit. Wir konnten zum Beispiel nachweisen, dass Frauen sich in solchen Verfahren häufiger bewerben als in reinen Leistungsverfahren.6 Eine weitere Möglichkeit ist, die ganze Berufungskommission mit einem Zufallsverfahren zusammenzustellen.
Wie werden diese Mechanismen genau erforscht?
Die Grundlage bietet die Literatur aus dem Bereich der Organisationsforschung, der Managementforschung und der Soziologie, die aufzeigt, dass solche Zufallsprozesse eine Rolle spielen. Das sind meist empirische Längsschnittstudien zu börsennotierten Unternehmen oder aus den Sport-Economics, die untersuchen, ob die Sportler, die die höchsten Gehälter bekommen auch wirklich die sportliche Spitzenleistung erbringen. Andere Studien schauen sich an, welche Firmenchefs als „CEO des Jahres“ prämiert wurden und wie sich daraufhin die Performance der Firma entwickelt. Da kann man zum Beispiel nachweisen, dass solche Manager öfter an Hybris leiden und ihre Geschäfte eher an die Wand fahren und zu viel Geld ausgeben.
Welche Methoden wenden Sie an, um nachzuweisen, dass Zufallsverfahren die Auswahl von Personal in der Wissenschaft gerechter machen würden?
Was kann der wissenschaftliche Nachwuchs tun, um sich zu behaupten?
Sich zunächst einmal bewusst machen, dass es bei diesen Prozessen nicht nur auf die Leistung ankommt. Dann kann man nämlich auch Misserfolge ganz anders wegstecken. In der Wissenschaft spielen Ablehnungen und auch Missgunst eine große Rolle. Da hilft es, zu erkennen, dass die Erfolgreichen nicht unbedingt alle besser sind als man selbst, weil eben viele Effekte beim Erfolg eine Rolle spielen. Die Selbstüberschätzung der Leute kommt außerdem auch daher, dass die anderen sie anbeten. Diese Ehrerbietung zu entziehen und Kompetenzen realistisch und nicht abhängig von Journals oder Positionen einzuschätzen, ist schon mal ein Anfang. Außerdem sollte man sich immer wieder bewusst machen, warum man eigentlich in der Wissenschaft arbeitet und dass es die intrinsische Motivation ist, weshalb man Spaß an der Forschung hat und die Gesellschaft voranbringen möchte.