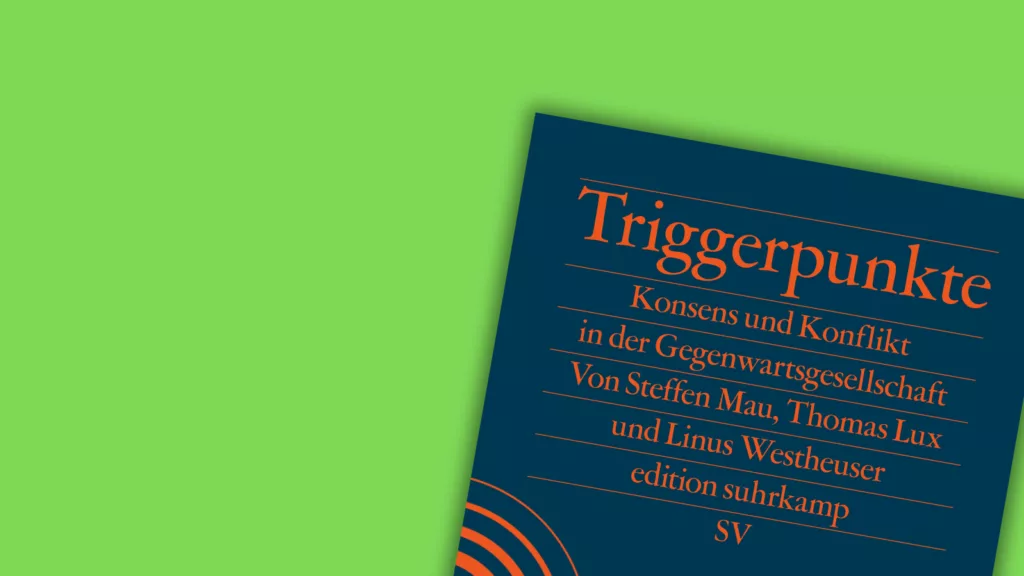Cancel Culture, Ausladungen von Universitäten – gerät die Wissenschaftsfreiheit zu einem Schlachtfeld der Ideologien? Wissenschaftsforscher David Kaldewey über Freiheit als Kampfbegriff und die Herausforderung, eine offene und kritische Diskussionskultur aufrechtzuerhalten.
Wenn Freiheit zum Kampfbegriff wird
Freiheit und Verantwortung sind zentrale Konzepte, die den Kern wissenschaftlicher Arbeit und der Wissenschaftskommunikation berühren. In dieser Reihe beleuchten wir aktuelle Debatten um die Wissenschaftsfreiheit, das Erstarken populistischer Bewegungen und das Ringen um konstruktive Dialoge zwischen Interessengruppen.

Herr Kaldewey, wie definieren Sie Wissenschaftsfreiheit?
Wissenschaftsfreiheit bedeutet für mich, inspiriert durch die Reflexionen von Pierre Bourdieu, vor allem ein Raum der Muße und Freiheit von praktischen Zwängen. Bourdieu verwendet hierfür den Begriff „scholé“ und meint damit einen Ort und Zeitpunkt, an dem ernsthaftes Spielen möglich ist und spielerische Dinge ernst genommen werden können, insbesondere in akademischen Institutionen wie Universitäten.
Für mich umfasst der Begriff der Wissenschaftsfreiheit daher sowohl die negative als auch die positive Freiheit. Negative Freiheit bedeutet die Abwesenheit äußerer Zwänge und die Möglichkeit, ohne Einschränkungen nachzudenken. Positive Freiheit beinhaltet die Verantwortung und die Fähigkeit, aus dieser Freiheit heraus etwas zu tun und herzvorzubringen. Dabei spielen Privilegien eine Rolle. Als verbeamteter Professor erkenne ich, dass diese Freiheit eine privilegierte Situation ist, aus der etwas gemacht werden muss. 
Wie unterscheidet sich Meinungs- von Wissenschaftsfreiheit und inwiefern kann es dort vielleicht auch zu Konflikten kommen?
Die Meinungsfreiheit, wie sie im deutschen Grundgesetz in Artikel 5 verankert ist, erlaubt grundsätzlich die Äußerung aller denkbaren Meinungen, also auch Verschwörungstheorien oder „alternative Fakten“, solange keine bewusste Täuschung beabsichtigt ist. Die speziell im deutschen Verfassungsrecht verankerte Wissenschaftsfreiheit schützt darüber hinaus Forschung und Lehre als eigenständigen gesellschaftlichen Bereich. Im Gegensatz zur amerikanischen Verfassung, die nur die Meinungsfreiheit kennt, betont die deutsche Tradition, dass die Wissenschaft in besonderem Maße schützenswert ist. Die Ausübung der Wissenschaftsfreiheit ist daher anspruchsvoller als die bloße Meinungsfreiheit, sie setzt fachliche Qualifikation und die Einhaltung von Qualitätsstandards voraus.
In der Praxis kann es zu Konflikten kommen, wenn Wissenschaftler*innen politische Meinungen oder Interpretationen, bewusst oder unbewusst, als wissenschaftliche Erkenntnisse präsentieren.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
In der Diskussion über komplexe gesellschaftliche Probleme beobachten wir, dass sich Forschende zu vielfältigen Aspekten eines Themas äußern. Der „Kern“ des die Öffentlichkeit interessierenden Problems wird dann mal besser, mal weniger gut getroffen. Dabei lässt sich kaum vermeiden, dass persönliche Meinungen oder politische Standpunkte einfließen.
Ein bekanntes Phänomen ist beispielsweise, wenn Expert*innen eines Fachgebiets plötzlich zu Themen außerhalb ihres Kompetenzbereichs Stellung beziehen – etwa wenn Volkswirt*innen als Virolog*innen auftreten oder Virolog*innen sich in demokratietheoretische Fragen einmischen. Im öffentlichen Diskurs wird oft nicht klar unterschieden, ob eine Aussage auf fachlicher Expertise oder persönlicher Meinung beruht. Es kann passieren, dass die Aussagen von Expert*innen, aufgrund ihrer Autorität automatisch als fachlich fundiert betrachtet werden. Interessant sind Interviews oder längere Gespräche mit Wissenschaftler*innen, in denen einerseits sehr fundiert kommuniziert wird, es aber auch die kleinen Momente gibt, in denen sie über ihre fachliche Expertise hinaus Aussagen über ganz andere Fachgebiete machen. Das ist durchaus legitim, markiert aber den Übergang von der Wissenschaftsfreiheit zur Meinungsfreiheit.
Forschende werden zunehmend dazu angehalten, ihre Arbeit zu kommunizieren. Auch der Großteil der Forschenden selbst betrachtet die öffentliche Kommunikation mit und über Wissen als Teil ihrer Arbeit. Wie kann diese Kommunikation gelingen, ohne die Freiheit der Wissenschaft zu gefährden?
Die Herausforderung besteht darin, fachliche Qualitätskriterien in der Wissenschaftskommunikation angemessen zu vermitteln. Oft wird in der Wissenschaftskommunikation das Ergebnis der Forschung erklärt, während der Weg dorthin, also die Methodik, die theoretischen Vorannahmen und vor allem der praktische Forschungsprozess, vernachlässigt wird. Das macht es schwieriger zu verstehen, wie man die Ergebnisse bewerten und mit ihnen umgehen soll. Es gibt dann auch eine Trennung zwischen öffentlicher und fachlicher Diskussion mit der Annahme, dass sich nur letztere für das Innenleben der Forschung interessiert.
Die Vereinfachung in der öffentlichen Kommunikation erschwert es der breiteren Öffentlichkeit, die Forschungsergebnisse angemessen zu kontextualisieren und ihre Robustheit einzuschätzen. Hier spielt Vertrauen eine entscheidende Rolle, da davon ausgegangen wird, dass die kommunizierenden Wissenschaftler*innen seriös sind und ihre Arbeit den Peer-Review-Prozess durchlaufen hat. Aber es reicht heutzutage nicht mehr aus, nur auf Vertrauen zu setzen. Man kann dem Publikum mehr zumuten und im Rahmen der Wissenschaftskommunikation die Prozesse hinter den Ergebnissen erklären. Das bedeutet, Unsicherheiten transparent zu machen und dem Publikum ein besseres Verständnis für die Entstehung des Wissens zu vermitteln.
Wie können Hochschulen einen konstruktiven und offenen Dialog zwischen verschiedenen Interessengruppen ermöglichen und gleichzeitig auch eine inklusive und kritische akademische Umgebung schaffen?
Universitäten spielen eine wichtige Rolle als Stätten des Austauschs und der intellektuellen Vielfalt. Sie sind Orte, an denen verschiedene Standpunkte und wissenschaftliche Ansätze diskutiert werden sollten. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie eine Atmosphäre fördern, die von wissenschaftlicher Integrität und kritischem Denken geprägt ist. In Zeiten, in denen Debatten von Polarisierung und „Cancel Culture“-Vorwürfen geprägt sind, stehen Universitäten vor der Herausforderung, einen ausgewogenen Diskurs zu ermöglichen. Das erfordert eine sorgfältige Abwägung bei der Auswahl von Redner*innen, um sicherzustellen, dass akademische Freiheit und Wissenschaftlichkeit gewahrt bleiben. Entsprechend wäre es keineswegs im Sinne der Wissenschaftsfreiheit, wenn jedem, der ein beliebiges politisches Anliegen vertritt, ein Rederecht an der Universität zukäme.
Ein komplizierter Fall ereignete sich kürzlich in Köln, als die renommierte Philosophin Nancy Fraser eingeladen und dann wieder ausgeladen wurde, weil sie einen Brief unterzeichnet hatte, in dem zum Boykott israelischer Kultureinrichtungen aufgerufen wurde. Obwohl ihre Vorträge nichts mit dem Nahostkonflikt zu tun hatten, führte die Unterzeichnung dieses Briefes zur Ausladung. Dieser Fall zeigt, wie komplex Wissenschaftsfreiheit sein kann. Interessanterweise ist Nancy Fraser keine Nahostexpertin, was die Frage aufwirft, wie sich ihre Meinungsäußerungen zu ihrer Rolle als Wissenschaftlerin verhalten. Solche Fragen sollten allerdings im wissenschaftlichen Diskurs, und nicht auf der Ebene der Universitätsleitung entschieden werden. Dies wurde im Kölner Fall deutlich, als vom Rektorat eine Entscheidung erwartet wurde, obwohl unklar ist, was genau Hochschulleitung dazu qualifiziert, zu solchen letztlich wissenschaftstheoretischen und wissenschaftssoziologischen Fragen Stellung zu beziehen. Das wäre eher die Aufgabe der beteiligten Fachwissenschaften und Institute gewesen.
Einige Stimmen behaupten ja, die Freiheit der Wissenschaft in Deutschland sei bedroht. Teilen Sie diese Ansicht, und wenn ja, wer oder was bedroht Ihrer Meinung nach die Wissenschaftsfreiheit?
Im internationalen Vergleich erscheint Deutschland relativ sicher in Bezug auf die Wissenschaftsfreiheit. Als verbeamteter Professor an einer deutschen Universität finde ich es schwierig zu behaupten, dass die Wissenschaftsfreiheit bedroht ist. Hier beobachten wir gelegentlich ein Jammern auf hohem Niveau, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht. Denn in autoritären Regimen finden massive Einschränkungen statt. Im deutschen Kontext sehe ich persönlich keine substanzielle Bedrohung.
Allerdings gibt es subtile Faktoren, die die Wissenschaftsfreiheit beeinflussen können. Ein Beispiel ist die Ressourcenknappheit. Wenn das Geld knapp wird, stellt sich die Frage, ab wann Wissenschaftler*innen nicht mehr frei arbeiten können. Dann gibt es den organisatorischen Kontext. Wie viel Freiheit lassen Universitäten zu, zumal in Zeiten zunehmender Konkurrenz? Wir haben selten Fälle, in denen Universitäten systematisch in die Freiheit der Wissenschaft eingreifen. Aber es gibt Mechanismen, die dazu führen können, dass Forschende in eine bestimmte Richtung gedrängt werden. Zum Beispiel wenn es darum geht, welche Themen gut mit Drittmitteln ausgestattet sind oder welche Projekte sich im Blick auf anstehende Exzellenz-Bewerbungen als vielversprechend darstellen und welche nicht.
Interessant wird es, wenn wir die weichen Faktoren betrachten, wie die Orientierung an sozialer Erwünschtheit, politischen Modethemen oder Selbstzensur. Diese Faktoren können dazu führen, dass Wissenschaftler*innen ihre Freiheit einschränken, indem sie bestimmte Themen vermeiden, bestimmte Methoden präferieren oder Fragen auf eine bestimmte Art und Weise stellen.
Nun können wir beobachten, dass ein immer größerer Teil der Forschung drittmittelfinanziert ist und die Haushalte von Universitäten stagnieren. Widersprechen sich Wissenschaftsfreiheit und Steuerimpulse in der Drittmittelförderung?
Eine gewisse Steuerung der Wissenschaft ist unumgänglich. Das Problem liegt vielmehr in der Ausgestaltung und Vielfalt der Förderlandschaft. Drittmittelforschung ist angesichts knapper Ressourcen bis zu einem gewissen Grad unverzichtbar. Wettbewerbliche Mittelverteilung bedeutet potentiellen Zugang für alle. Das System funktioniert, sofern die Förderlandschaft vielfältig genug ist und es verschiedene Formate gibt, die offen und unterschiedlich kompetitiv sind. Solange Forschende in multiplen Wettbewerben zwischen verschiedenen Förderformaten frei wählen können, bleibt die Freiheit gewahrt.
Wie können wir eine Politisierung von Grundbegriffen wie „Freiheit“ und „Vielfalt“ vermeiden, oder muss die gar nicht vermieden werden?
Ein zentrales Dilemma besteht darin, dass der Begriff der Wissenschaftsfreiheit oft konservativ oder rechts konnotiert ist. Genderfragen, Transsexualität, Immigration oder Islamismus polarisieren und führen schnell zu dem Argument, dass bestimmte wissenschaftliche Forschung nicht mehr frei möglich sei, weil ihre Ergebnisse nicht erwünscht seien. In diesem Zusammenhang drängt sich gelegentlich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit auf, welches in Teilen des akademischen Lagers als politisch problematisch wahrgenommen wird, kürzlich etwa wegen der Teilnahme eines Mitglieds des Netzwerks bei einem Geheimtreffen mit rechtsextremen Akteuren. Diese Wahrnehmung des Netzwerks als „rechts“ ist teilweise undifferenziert, aber sie existiert. Ich will das hier inhaltlich gar nicht bewerten. Worum es mir aber geht: In akademischen Milieus gibt es eine Tendenz, Freiheit zu problematisieren, wenn sie mit politischen Gegner*innen in Verbindung gebracht wird.
Beispielsweise gibt es mittlerweile soziologische Zeitdiagnosen, die den Freiheitsbegriff mit Egoismus und „libertärem Autoritarismus“ assoziieren. Solche abwertenden Label können einen konstruktiven Austausch über die Bedeutung von Freiheit und Wissenschaftsfreiheit behindern. Es ist eine große Herausforderung, den Freiheitsbegriff nicht den politischen Gegner*innen zu überlassen. Aus meiner Sicht ist es dann die Aufgabe der Wissenschaftsforschung, zu analysieren, was es bedeutet, wenn Freiheit zum Kampfbegriff wird und mit politisch unerwünschten Positionen in Verbindung gebracht wird. Wenn wir den Begriff zu stark politisieren und „Gegner*innen“ überlassen, haben wir ein demokratietheoretisches Problem.
Dieser Beitrag wurde redaktionell unterstützt von Jana Fritsch.