David Lanius, Experte für Streitkultur, gibt im Interview Ratschläge für konstruktive Debatten und spricht über ungenutzte Potenziale in Online-Diskussionen.
Wie steht es um unsere Debattenkultur?
Herr Lanius, Sie leiten das Forum für Streitkultur und forschen im DebateLab. Die Wissenschaft sieht sich gern als objektiv und sachlich. Wie passt das zusammen mit der Emotionalität, die Debatten entwickeln können?

Da gibt es in der Tat ein Spannungsfeld: Wir alle sind Menschen, die sich in sozialen Umfeldern bewegen, mit persönlichen Überzeugungen und Interessen, Wünschen und Gefühlen. Zugleich gibt es den Anspruch, professionell möglichst objektiv zu handeln. Letztlich ist die Spannung jedoch viel geringer, als häufig suggeriert wird. Denn die Emotionalität, die in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung entsteht, hat auch eine wichtige Funktion: als Motivation, sich mit Leidenschaft der Forschung zu widmen und Energie zu investieren, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Um dennoch auf der Sachebene möglichst objektiv zu bleiben, muss man sich seiner Wünsche, Gefühle und kognitiven Verzerrungen bewusst sein und über sein wissenschaftliches Handeln regelmäßig reflektieren. Doch einen grundsätzlichen Widerspruch gibt es nicht.
Wie führt man eine gute Debatte über brisante Forschungsthemen?
Es ist schwierig, allgemeine Ratschläge zu geben. Grundsätzlich ist es jedoch immer sinnvoll, möglichst sachlich zu bleiben; was nicht heißt, dass ich Emotionen nicht zulassen sollte. Oft ist es hilfreich, Emotionen zu benennen. Aber ich muss sie von den inhaltlichen Aussagen trennen. Zudem sollte das, was ich sage, für die Ausgangsfrage relevant sein. Zu häufig wird in einer Debatte von der ursprünglichen These abgelenkt – etwa, wenn man in der Klimadebatte nicht mehr über die Gestaltung des Klimawandels spricht, sondern darüber, welche Kritik daran berechtigt ist.
Sachlichkeit, Relevanz und Präzision – das sind drei ganz zentrale Kriterien. Wichtig ist allerdings auch, dass man das, was man behauptet, begründen kann. Transparente Begründungen nehmen oft schon etwas Brisanz aus einem hitzigen Thema, weil die vertretenen Positionen dann nachvollziehbarer werden.
Sind Argumente auch für jemanden überzeugend, der die eigenen Werte nicht ohnehin schon teilt?
Haben wir es denn mit einer Verrohung des öffentlichen Diskurses zu tun?
Ich kenne keine empirischen Daten, die das in irgendeiner Form nachprüfbar belegen könnten. Das liegt unter anderem daran, dass nicht so richtig klar ist, was die Qualität von Debatten überhaupt ausmacht. Ich hatte vier Aspekte genannt: Sachlichkeit, Präzision, Relevanz und Argumentation. In der Politikwissenschaft nutzt man etwa den Diskurs-Qualitätsindex, um das messbar zu machen. Aber wir haben zu wenig Daten, die das über die Zeit mit der gleichen Methode abbilden könnten, und schon gar nicht mehrere verschiedene Ansätze, die eine solche These allgemein stützen könnten. Insofern wäre ich mit solchen Diagnosen eher zurückhaltend.
Was ich als Hypothese in den Raum stellen kann: Wir haben es wohl einerseits mit einer Anhebung der Beurteilungsstandards zu tun. Vor 30 – 40 Jahren ging vieles als normal durch, was wir heute zu Recht als rassistisch und sexistisch kritisieren. Da haben wir sicherlich eine höhere Sensibilität. Auf der anderen Seite kann es aber gut sein, dass bestimmte Teildebatten durchaus verroht sind, gerade in den sozialen Medien. Ich glaube also nicht, dass man eine einfache Antwort auf diese Frage geben kann.
Warum ist konstruktives Streiten online so schwer?
Zusätzlich setzen sich Gesprächspartner*innen online selten bewusst Ziele, so dass oft unklar bleibt, warum überhaupt diskutiert wird. Die Nutzungsfunktion der meisten sozialen Medien ist nicht der Erkenntnisgewinn oder die Konsensfindung, sondern Unterhaltung und die Pflege sozialer Beziehungen. Deshalb funktioniert es dort oft nicht so gut, wenn unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Zielen zusammenkommen. Hinzu kommt der bekannte Punkt, dass soziale Medien eine gewisse Distanz erzeugen: Man postet etwas und sieht nicht, wie andere reagieren.
Sie schreiben: „Die sozialen Medien bieten eine Unmenge an noch ungenutzten Möglichkeiten der Entschleunigung, Zivilisierung und Epistemisierung der Debatte“. Können Sie auf dieses ungenutzte Potenzial näher eingehen?
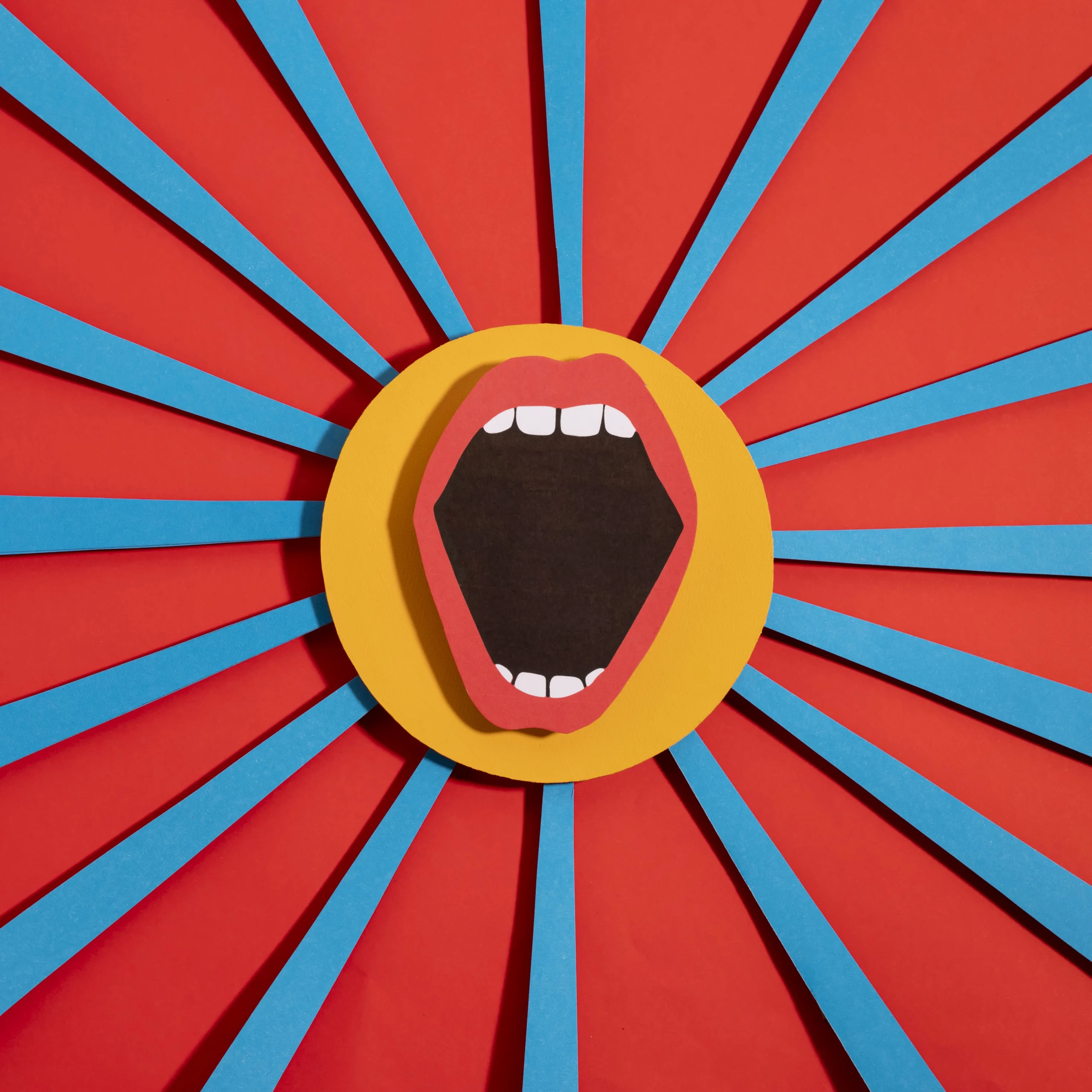
So können sich Online-Diskussionen auf der individuellen Ebene lohnen. Aber auch auf der systemischen Ebene gibt es Potenziale. Wir können die Aufmerksamkeitsökonomie der öffentlichen Debatte durchbrechen und uns aktiv fragen: Wie können wir ein soziales Medium anders gestalten, um bessere Diskussionen zu führen? Zum Beispiel, dass, bei Diskussionen tatsächlich Begründungen eingefordert werden. Auch das könnte zu einem Diskurs führen, der sich stärker am Erkenntnisgewinn orientiert und Kriterien wie Präzision und Sachlichkeit in den Vordergrund stellt.
Welche Rolle spielt der Ton in Debatten?
Das ist vor allem dann problematisch, wenn viele Diskussionen so ablaufen. Dann entsteht der Eindruck, das sei „die Meinung des Volkes“, die bei politischen Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen muss. Man denke nur an die viel beschworene „schweigende Mehrheit“. So werden tragischerweise vor allem echte Minderheiten, die gesamtgesellschaftlich diskriminiert werden, aus dem Diskurs gehalten. Gerade deshalb ist es so wichtig, zu Beginn einer Debatte auf den Ton zu achten und sie zu moderieren. Der zentrale Punkt ist, sich klar zu machen, wer in den Debatten aktiv ist und warum Andere weniger aktiv sind.








