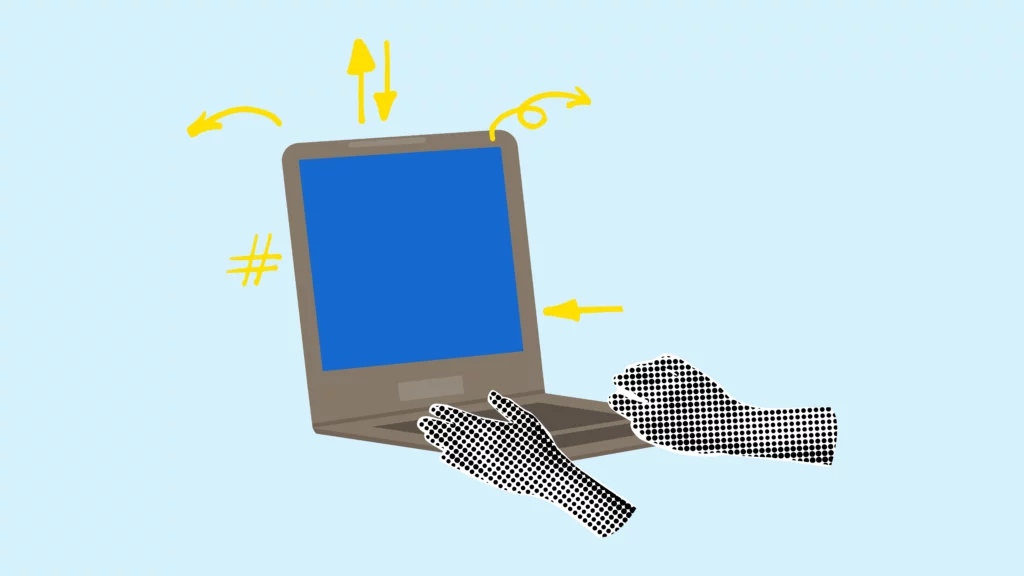Welche Wirkungen können Erzählungen entfalten? Im Interview spricht das Podcast- und Autor*innenduo Samira El Ouassil und Friedemann Karig über Held*innen, Storytelling und „Erzählende Affen“.
Die Macht der Geschichten und Narrative
Frau El Ouassil, Herr Karig, Ihr Buch „Erzählende Affen“ handelt von Erzählungen und Narrativen. Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig?

Samira El Ouassil: Die Ausgangsprämisse unseres Buches ist, dass wir nicht anders können, als in Geschichten zu denken, zu rezipieren und Informationen zu verarbeiten. Das heißt, dass sich unser Gehirn die ganze Zeit in einem Modus der permanenten Narrativierung befindet. Und als wir mit dieser Prämisse begannen zu recherchierten, kamen wir nicht umhin festzustellen, dass das im Grunde genommen jeden Bereich unseres Leben beeinflusst: die Art, wie wir leben und lieben, wie wir konsumieren, wie sich unsere Politik und unser menschliches Zusammenleben ausgestaltet.
Dazu kommt, dass wir uns aus schreibenden Disziplinen zum Podcasten zusammengefunden haben und ohnehin schon große Freund*innen des Erzählens sind.
Warum brauchen wir Erzählungen?

Friedemann Karig: Das ist ein bisschen, als würde man fragen, warum wir Farben brauchen. Wir Menschen können gar nicht anders als die Welt und alles, was auf uns an Wahrnehmungen einwirkt, in Geschichten zu sortieren. Wir können gar nicht anders, als eine Kausalität in Dingen zu sehen, weil wir Chaos und Zufall extrem schlecht aushalten. Problemlösungskompetenz und Sinnangebote in Form von Geschichten weiterzugeben hat den Menschen beim Überleben geholfen und die Stämme mit den besseren Geschichtenerzähler*innen und Zuhörer*innen haben überlebt. Und so sind wir von der Evolution zu erzählenden Affen gemacht worden – denn genau das unterscheidet uns von allen anderen Menschenaffen und auch allen anderen Tieren. Alles, was wir wahrnehmen, sortieren wir in eine Geschichte. Unser großes Gehirn, das wir für unsere Wahrnehmung nutzen und um daraus Geschichten zu stricken, war einfach ein evolutionärer Vorteil.
Das kann man auch erforschen und im Blut nachweisen anhand von gewissen Botenstoffen, Dopamin, Adrenalin, Serotonin und Oxytocin, die ausgeschüttet werden, wenn uns eine Geschichte berührt, wenn wir uns bei einer Geschichte ängstigen oder wenn wir uns damit identifizieren. Wir wollten einmal ergründen, was hinter diesen spannenden Hollywood-Filmen, Netflixserien und Romanen steckt und uns fragen, was Geschichten bewirken und wozu sie missbraucht werden.
Sie sprechen die Wirkmacht der Geschichten an. Mit Blick auf Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation: Welche Wirkung können Geschichten haben?
El Ouassil: Es ist natürlich immer eine Frage der Narrative, die eingesetzt werden. An der Coronapandemie kann man sehen, dass es verschiedene narrative Arten gab, Informationen zu interpretieren und wiederzugeben. Ein Beispiel ist die Kommunikationsstrategie Neuseelands. Sie haben die Pandemie als sportlichen Wettkampf einer Mannschaft bestehend aus fünf Millionen Neuseeländer*innen gegen das Virus geframed. Dabei wurde klar ein Antagonist oder ein Hindernis, das überwunden werden muss, etabliert. Durch diesen sportlichen Rahmen, dass Neuseeland kollektiv als Team versucht zu gewinnen, hat das Resonanz bei den Menschen erzeugt. Im deutschen Diskurs gab es dahingegen eine Übertragung auf das Individuum, die Verantwortung des Einzelnen. Das führte manchmal zum Gefühl, dass man gar nichts mit dem politischen Handeln zu tun hat oder jede*r für sich verantwortlich ist, wie man in der Debatte um die Maskenpflicht gesehen hat.
Narrative können aber nicht nur wie im neuseeländischen Beispiel die Gesellschaft einen, sie können auch spalten und desinformieren. Wo sehen Sie die Nachteile von Geschichten oder potenziellen Missbrauch?
Karig: Grundsätzlich braucht eine Geschichte jemandem, der handelt und etwas oder jemanden, der dieser Handlung im Weg steht. Dadurch gibt es einen Konflikt, der über Zeit zu einer Lösung kommt oder eskaliert. Und der Antagonismus steckt genauso tief in uns und in unserer Art über die Welt zu denken, wie der erste Bestandteil, dass jede*r Handelnde*r sein möchte. Diese Einteilung der Welt – gar nicht unbedingt in Gut und Böse – aber dafür und dagegen, findet man in allen möglichen Bereichen menschlicher Kultur. Wir haben im Buch versucht, diese Antagonisierung anderer Menschen am Beispiel von Rassismus oder Antisemitismus klar zu machen.
Dass in verschiedenen Epochen Menschen kulturell versucht haben, sich zu den Protagonist*innen zu machen, zu den Handelnden, indem sie andere, zum Beispiel Juden und Jüdinnen, zu Antagonist*innen gemacht haben. Und das sind die großen, epochemachenden, die furchtbaren Beispiele von manipulativen Narrativen, die ganz tief eingesickert sind und die dann zum Faschismus führten und ihn befeuern.
Aber man kann auch die Brücke schlagen zu eher ökonomisch motivierter narrativer Propaganda. Zum Beispiel im Kontext der Klimakrise, zu der die fossile Lobby und Industrie uns schon seit Jahrzehnten sehr geschickt Geschichten erzählen, die zumindest hochgradig hinterfragbar sind und aus einem ganz klar manipulativen Impetus heraus überhaupt erst unters Volk gebracht wurden.
Sie haben davon gesprochen, dass es Protagonist*innen mit Handlungsmacht, Antagonist*innen und einen Konflikt für eine Geschichte braucht. Stößt man in der Klimakommunikation mit dieser Erzählweise an die Grenzen?
El Ouassil: Das Problem an der Klimakrise ist, dass unser Gehirn bezüglich des Verständnisses dieses Problems kognitiv gesprochen ein Trottel ist. Unser Gehirn verträgt Chaos und Zufälle sehr schlecht. Es versucht immer Muster zu erkennen, Kausalzusammenhänge herzustellen und das Ganze in einen narrativen Gesamtzusammenhang zu bringen. Und das ist bei der Klimakrise nicht wirklich gegeben. Es gibt keinen klassischen Anfang, es gibt kein klassisches Ende. Was wäre ein Happy End der Klimakrise? Wir haben jetzt akut die Situation, in der es darum geht, zu verhindern, dass es schlimmer wird. Und das ist keine gute Heldenerzählung. Keine Heldengeschichte endet damit, dass der Held oder die Heldin es geschafft hat, dass die Gesamtsituation einfach nicht viel, viel schlimmer wurde.
Das heißt, uns fällt es schwer, die Klimakrise richtig zu erfassen, weil sie als Problem so omnipräsent ist und so allumfassend. Nichtsdestotrotz bemühen wir uns, narrative Muster in irgendeiner Form hineinzudenken. Wir neigen zu einer akteursbezogenen Heroisierung, wenn wir uns die Geschichte von Greta Thunberg anschauen, die wir fast wie eine Jeanne d’Arc im Diskurs behandelt haben. Oder wenn wir Klimaaktivist*innen besonders herausstellen und der Diskurs sich emotional an ihnen abarbeitet, weil sie als Einzelpersonen so greifbar sind.
Gleichzeitig ist es schwierig, in der Klimakrise etwas zu antagonisieren. Wir haben zwar ökonomische Akteur*innen, die vom systemischen Beibehalten des Status quo profitieren. Aber die Klimakrise selbst ist ein schlechter Antagonist.
Das macht es uns schwer, uns gegen die Klimakrise aufzustellen. Es ist einfacher, gegen einen Antagonisten zu mobilisieren und zu sagen „Da ist ein Hindernis, das wir überwinden oder jemand, gegen den wir sein müssen“. Das sorgt sofort für Empörung und Entrüstung und eben zu Mobilisierung, wie wir es in anderen Debatten, zum Beispiel es bei der Genderstern-Debatte wahrnehmen. Bei der Klimakrise fehlt aber eben diese Mobilisierung, weil es noch zu abstrakt ist, noch zu unkonkret und für uns nur schwer in Narrative zu fassen ist.
Karig: Und gleichzeitig gibt es so etwas wie den ökologischen Fußabdruck, eine Erfindung von BP, dem Ölkonzern. Ein sehr gutes Beispiel für eine Antagonisierung, die uns alle eigentlich zu den Antagonist*innen macht in dieser Geschichte und die in einen sehr frustrierenden Verzichtsdiskurs führt und weg von den wahren Antagonist*innen in der Krise, nämlich den Profiteur*innen der Zerstörung unserer Lebensgrundlage, wie beispielsweise BP. Insofern war das schon ein narratives Meisterstück.
Würden Sie sagen, dass die Gegenseite die einfacheren oder die besseren Geschichten hat?
El Ouassil: Die wirkmächtigeren vielleicht. Sie sind effektiver, weil sie einprägsamer sind und kompatibler mit der Art, wie wir denken. Der Verzichtsdiskurs ist ein ganz hervorragendes Beispiel, wie erfolgreich eine Angst geschürt worden ist vor einer Fiktion, die als solche ökonomisch gar nicht belegt ist. Wir wissen, dass es nicht darum geht, auf etwas zu verzichten, sondern eine Zukunft zu gewinnen. Das Verzichtsmoment triggert in uns erfolgreich die Angst vor der Wegnahme. Wir haben uns etwas erarbeitet und plötzlich kommt eine Institution, eine Instanz, eine Partei – irgendein Antagonist – und will uns diesen hart erarbeiteten Wohlstand wegnehmen. Und dieses Ungerechtigkeitsempfinden ist etwas, das uns empört und dann mobilisiert im Kampf gegen jemanden, der uns diesen Verzicht aufzwingen möchte. Und da funktioniert die Geschichte, weil sie wirkmächtig ist.
In der Wissenschaftskommunikation gibt es die anhaltende Debatte, ob man Storytelling einsetzen sollte, um Geschichten über Wissenschaft zu erzählen, oder die wissenschaftliche Evidenz für sich stehen und dem Publikum die Interpretationen selbst überlässt. Warum würden Sie dafür plädieren, Geschichten auch über Wissenschaft zu erzählen?
Karig: Das ist eine tatsächlich sehr schwierige Frage. Wir haben im Buch das Thema Wissenschaft ein Stück weit ausgespart, weil es sehr uneindeutig ist. Es gibt gute Argumente dafür, jede Form von Storytelling oder sogar Unterhaltung oder Infotainment von der Wissenschaft fernzuhalten. Aber ich glaube, wir haben in der Pandemie gesehen, wie Wissenschaft auch erfolgreich erzählen kann. Wenn man beispielsweise an den viel zitierten Podcast von Professor Drosten denkt, von dem ich immer wieder von Leuten höre, wie sehr er ihnen geholfen hat, die Problematik, auch die Bedrohung, die Unsicherheit und die gesellschaftlichen Umwälzungen innerhalb kürzester Zeit zu verstehen und auch besser zu ertragen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass Christian Drosten den perfekten Spagat geschafft hat zwischen einer völlig seriösen Darstellung der Forschung und vor allem immer wieder auch den Lücken der Forschung – und das alles in Geschichten zu verpacken. Das halte ich für ein großes Missverständnis in der Pandemie, dass Forschende gesicherte, absolute Wahrheiten zu verkünden hätten.
Christian Drosten und andere haben es immer wieder geschafft, Wissenschaft als die Verringerung von Unwissenheit darzustellen und nicht als die Maximierung von Wissen. Als „Wir scheitern nach vorne“. Dass man das langsame Voranleuchten mit dieser schwachen Taschenlampe namens Wissenschaft in die Dunkelheit dann immer wieder so in kleine Geschichten verpackt, die auch Leute, die nicht studiert haben, die noch nie einen wissenschaftlichen Text gelesen haben, trotzdem verstehen, das ist die eigentliche Heldengeschichte, die es zu erzählen gibt.
Neben den Ärzt*innen und Krankenpfleger*innen, die an vorderster Front um das Leben der Menschen gekämpft haben, sind die Wissenschaftler*innen die Held*innen der Geschichte, die gegen einen anfangs unsichtbaren Feind gekämpft haben und uns in sehr kurzer Zeit Hilfe gegeben haben, bis hin zu einem Impfstoff, der in Rekordzeit entwickelt wurde.
El Ouassil: Es ist auch eine Frage der Disziplinen, die hier zusammenkommen. In der Wissenschaft an sich hat das Storytelling gar nicht so einen Platz, aber wohl im Wissenschaftsjournalismus und in der Wissenschaftskommunikation. In den drei Bereichen kommen drei Formen der Kommunikation zusammen: wir haben die wissenschaftliche Kommunikation, die faktenbasiert und wirklichkeitsabbildend ist und die Vorläufigkeit ihres Wissens auch immer voranstellt. In der Wissenschaftskommunikation und im Wissenschaftsjournalismus kommt hingegen noch der Aspekt der journalistischen Kommunikation und der Risikokommunikation hinzu.
Die Risikokommunikation ist insofern interessant, als dass sie auch ein aktivistisches Moment – ich wähle diesen Ausdruck in diesem Kontext mit Bedacht – hat. Aber es geht um ein Momentum der Mobilisierung. Wissenschaft an und für sich hat noch nicht zwangsläufig den Auftrag zu mobilisieren, sondern es geht um die Durchdringung der Wirklichkeit mit empirischen und naturwissenschaftlichen Methoden und die Abbildung eben dieser. Die Risikokommunikation möchte noch dazu anhand dieser Ergebnisse die Menschen vor einem Problem warnen und zu einem Verhalten motivieren, das die Gesellschaft in irgendeiner Form schützt. Bei der Mobilisierung kommt Storytelling sehr gut zum Tragen, weil dort die Wirkmacht der Geschichte ein effektives Werkzeug ist, um Informationen, die nicht einfach zu verstanden werden, voranzubringen.
In Ihren Antworten ist angeklungen, dass Wissenschaft komplex ist, oft auch uneindeutig. Wie können wir Geschichten erzählen, die komplex und uneindeutig sind?
El Ouassil: Ich würde fast sagen: gar nicht. Wir müssen tatsächlich eine Zufälligkeit und eine Komplexität aushalten lernen. Ich glaube, das Erzählen von Komplexität ist an und für sich schon paradox, weil es wieder der Versuch ist, etwas Komplexes zu gestalten. Und in dem Moment, in dem man formt, verliert man selbstverständlich etwas Komplexität. Die Frage ist, ob man es sich erlauben kann, die Komplexität zu verlieren, um eine bessere Verständlichkeit der Wirklichkeit zu haben.
Karig: Auf welcher Dimension denn Komplexität? Wir erleben gerade, dass sich komplexere, diverse, eigene Lebensentwürfe, Orientierungen, Hintergründe, Identitäten im Endeffekt ihren Platz am großen Tisch der Geschichten erkämpfen: Transmenschen, Regenbogenfamilien, das gesamte sogenannte postmigrantische Milieu. Dabei wird sichtbar, zu welchen gesellschaftlichen Konflikten und Verwerfungen das führt, wenn die konservative oder reaktionäre Seite, die immer die Vormachtstellung in Sachen gesellschaftlichen Erzählungen hatte, das Gefühl hat, sie müssen jetzt ein bisschen was von dieser Bühne abgeben. Ich glaube, wenn es um Komplexität und Uneindeutigkeit bei Menschen geht, dass nicht jede*r immer gleich in die üblichen Schubladen passen muss. Diese Schubladen haben vielleicht auch nie wirklich gepasst, sondern sehr viel Leid verursacht. Da kann man Komplexität wunderbar erzählen – wie das postmigrantische Kino oder postmigrantische Literatur zeigt. Sie gewinnen ihren Wert, ihre Gravitas, genau dadurch, dass die Geschichten und Figuren eben nicht eindeutig sind. Und trotzdem können die Geschichten im Kern dann wieder ganz simpel sein und ganz einfache Muster bedienen und uns wieder berühren.