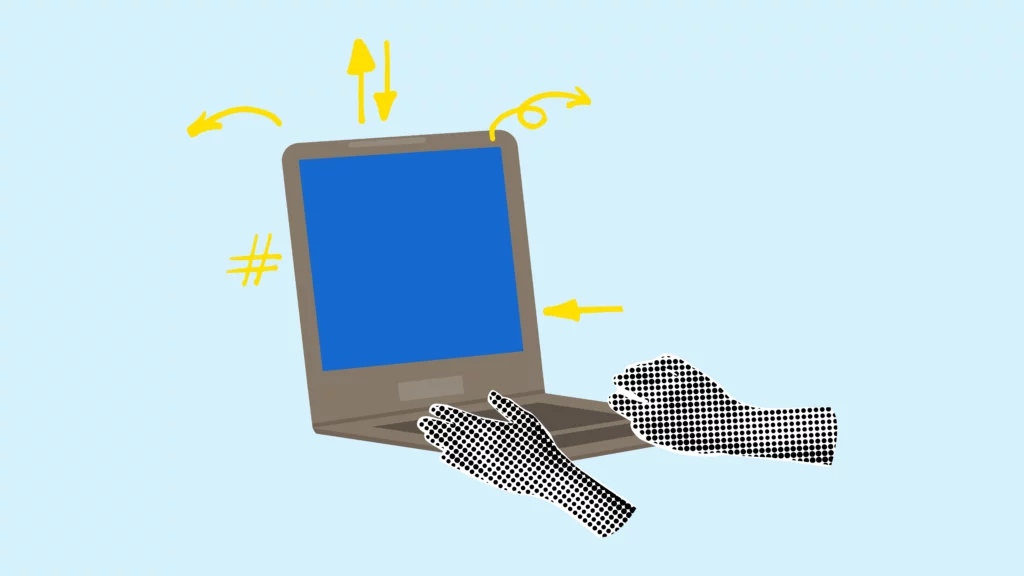In der aktuellen Krise wird deutlich, welchen Spagat die Wissenschaftskommunikation schon immer leisten musste: den zwischen der Unsicherheit wissenschaftlicher Erkenntnis und den öffentlichen Erwartungen an Orientierungswissen. Ein Gastbeitrag von Arndt Wonka und Julia Gantenberg.
Reflexion und Orientierung – was kann Wissenschaftskommunikation leisten?
In der Covid-19-Pandemie rückt mit der Epidemiologie eine eher wenig beachtete Wissenschaft ins Zentrum des öffentlichen Interesses, und Pressekonferenzen des Robert-Koch-Instituts wird eine außergewöhnlich hohe Aufmerksamkeit geschenkt. Grund dafür ist der Wunsch der Bevölkerung nach Orientierung in einer von fundamentaler Unsicherheit geprägten Phase, die von einigen als existenzielle Bedrohung wahrgenommen wird. Politische Entscheiderinnen und Entscheider wiederum folgen den Ratschlägen der wissenschaftlichen Expertinnen und Experten und dokumentieren die wissenschaftliche Basis ihrer Entscheidungen durch Pressekonferenzen, die gemeinsam mit Forschenden abgehalten werden. Durch diese Inszenierungen soll das Vertrauen der Bevölkerung in die sachliche Basis der Entscheidungen gestärkt werden, um damit die gesellschaftliche Folgebereitschaft zu erhöhen. Was in dieser aktuellen Situation besonders deutlich wird: Wissenschaftliche Erkenntnis offenbart auch unter diesen Bedingungen, die von enormem Handlungsdruck geprägt sind, eine ihrer wesentlichen Eigenschaften: ihre Unsicherheit. Und auch politische Entscheidungen demonstrieren eine fundamentale Eigenschaft: Sie betreffen in der Regel verschiedene Dimensionen (aktuell unter anderem Freiheit, Gesundheit, ökonomischer Wohlstand), und die Aufgabe von Politikerinnen und Politikern ist es, die jeweiligen Folgewirkungen abzuwägen und in Form politischer Entscheidungen zu gewichten.
In diesem Beitrag argumentieren wir, dass diese jeweiligen Eigenschaften zwar in der aktuellen Corona-Krise deutlicher als je zuvor sichtbar werden, sie jedoch ein grundsätzliches Charakteristikum von Politik und Wissenschaft sind. Die Herausforderung für die Wissenschaftskommunikation besteht darin, den jeweiligen Handlungsbedingungen und -logiken gerecht zu werden. Dabei gilt es vor allem grundlegende Eigenschaften der Wissenschaft und ihrer Erkenntnisse so zu kommunizieren, dass diese gut verständlich sind und somit Orientierung bieten, dabei jedoch nicht die grundsätzliche Unsicherheit wissenschaftlicher Erkenntnis verleugnen. Es sollte deshalb ein zentrales Ziel der Wissenschaftskommunikation sein, neben wissenschaftlichen Ergebnissen auch das Verständnis für den Prozess wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns zu fördern. Um gesellschaftliches Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse zu fördern, sollte sich die Wissenschaftskommunikation weder als primär politisch, noch vor allem als Vertreterin der Wettbewerbsinteressen einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder ihrer Organisationen verstehen. Vielmehr sollten wissenschaftliche Erkenntnisse und die Grenzen ihrer Geltungsbedingungen möglichst klar und verständlich kommuniziert werden. Dies gilt gerade auch, wenn Wissenschaft in politisierten Zusammenhängen agiert und kommuniziert.
Der Wissenschaft und dem von ihr generierten Wissen wird aktuell ein großes Vertrauen entgegengebracht. Doch die Kriterien und Handlungsweisen, die dieses Vertrauen generieren sollen – und gleichsam auch gefährden können – unterscheiden sich je nach Erwartung, die an das öffentlich kommunizierte wissenschaftliche Wissen gestellt werden. Wir unterscheiden im Folgenden zwei (idealtypische) Arten von Wissen: Reflexions- und Orientierungswissen.
Wissenschaftliche Erkenntnisse sind mit Unsicherheit behaftet und damit, per Definition, vorläufig. Ziel und Zweck der fachlichen Auseinandersetzungen zwischen Forschenden, unter anderem im Rahmen von Publikationen und Konferenzen, ist es, die Zuverlässigkeit von Befunden zu prüfen und durch konkurrierende und komplementäre Erkenntnisse zu verbessern. In diesem Sinne leisten die Debatten innerhalb der Wissenschaft einen zentralen Beitrag zur Verbesserung wissenschaftlicher Erkenntnisse und zum Vertrauen in deren Gültigkeit. Dass Erkenntnisse unsicher und vorläufig sind, gilt für alle Disziplinen, lediglich der Umgang damit unterliegt unterschiedlichen theoretischen, methodischen und empirischen Konventionen. Reflexion über die Unsicherheit und Vorläufigkeit empirischer Erkenntnisse sowie deren theoretische und methodische Handhabung sind aber die Legitimierungsgrundlage der Wissenschaft.
Demgegenüber stehen oftmals die Erwartungen, die „von außen“ an die Wissenschaft gerichtet werden – sei es seitens der Politik, der Öffentlichkeit oder der Medien als Zwischeninstanzen. Diese erwarten von wissenschaftlichen Erkenntnissen eine praxisrelevante Hilfestellung, sowohl als Entscheidungsgrundlage als auch in Form von Handlungsempfehlungen. In diesem Fall geht es letztlich darum, Erkenntnisse aus der Wissenschaft in anderen Kontexten nutzen zu können. Dafür ist es unabdingbar, dass die Erkenntnisse als „richtig“ und „sicher“ angesehen werden können. Denn nur wenn Wissen so kommuniziert wird, kann es die häufig erwartete Orientierung in Sachfragen bieten.
Diese öffentliche Erwartungshaltung führt zu Situationen, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgrund ihrer Expertise in eine andere als der ihr systemisch zugeschriebenen Rolle kommen können. Wenn sich Forschende in gesellschaftspolitischen Debatten, etwa zur Polarisierung in Gesellschaften und deren Ursachen, als Aktivistinnen oder Aktivisten präsentieren oder wenn die Wissenschaft als Mittel zum politischen Zweck genutzt wird, droht ein Verlust des Vertrauens in wissenschaftliche Erkenntnisse. Der Grund hierfür ist, um bei dem Beispiel der Polarisierung zu bleiben, dass unterschiedliche Theorien und ihre Vertreterinnen und Vertreter diese Ursachen in unterschiedlichen – individuellen, wirtschaftlichen, kulturellen, parteipolitischen – Faktoren sehen. Eine monokausale Ursache ist äußerst unplausibel. Macht man sich jedoch zum Aktivisten oder zur Aktivistin einer Erklärung, wird diesem grundlegenden Umstand nicht Rechnung getragen. Wissenschaftliche Komplexität wird nach den Kriterien der Disziplin unzulässig reduziert. Es könnten auch Erwartungen dahingehend erzeugt werden, dass die Wissenschaft politische Lösungen liefern kann. Dafür aber fehlen Forschenden die Mittel und auch die Legitimierung, denn das geht weit über die epistemische Legitimierung hinaus, die der wissenschaftliche Prozess sicherstellen soll.
Damit kann auch die Erwartung verbunden sein, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Gewichtung und zur Priorisierung unterschiedlicher, zueinander in Konkurrenz stehender Handlungsziele aufgefordert werden. Das Lösen von Zielkonflikten – wie beispielsweise zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Fragen – kann Wissenschaft aus sich heraus jedoch nicht leisten. In Demokratien ist dies die Aufgabe der Politik. Grundlage des Handelns bieten dabei Verfassungen und Gesetze. Die Legitimierung dafür, diese Interessenabwägung vorzunehmen, erhalten Politikerinnen und Politiker durch Wahlen.
Anhand der Unterscheidung zwischen Orientierungs- und Reflexionswissen wird deutlich, dass es verschiedene Erwartungen gibt, die an Wissenschaft und ihre Ergebnisse gestellt werden. Der Wissenschaftskommunikation kommt die Verantwortung zu, Vertrauen in die wissenschaftliche Arbeitsweise und in wissenschaftliche Positionen zu fördern und zu erhalten, ohne die Logik der wissenschaftlichen Arbeitsweise zu unterminieren. Maßgeblich und zentral hierfür ist der methodisch und theoretisch reflektierte Umgang mit Unsicherheit – sowohl inner- als auch interdisziplinär. Die Aufgabe der Wissenschaft ist es, mit ihren Erkenntnissen Grundlagen für sachgerechte Entscheidungen zur Verfügung zu stellen. Dabei sollte sie einerseits auf mögliche Zielkonflikte und Abwägungsnotwendigkeiten hinweisen und andererseits klar benennen, wenn die Unsicherheit ihrer Erkenntnisse es auch unsicher macht, ob bestimmte Handlungsziele überhaupt realisiert werden können.
Aus diesen Gründen scheint uns die Sensibilisierung für wissenschaftliche Arbeitsweisen und deren laiengerechte Vermittlung eine zentrale Aufgabe der Wissenschaftskommunikation zu sein. Für diese ergeben sich daraus entscheidende Fragen: Welche Art von Wissen können wir kommunizieren, und wie sollte dies geschehen? Wie können wir den Ansprüchen der Öffentlichkeit gerecht werden und gleichzeitig denen der Wissenschaft? Wie gehen wir mit der Unsicherheit wissenschaftlicher Erkenntnis um? Und wie kommunizieren wir wissenschaftliche Prozesse und die daraus resultierende Unsicherheit von Befunden, ohne das Vertrauen in die Wissenschaft zu schwächen? Denn der verantwortungsbewusste Umgang mit der Unsicherheit wissenschaftlicher Erkenntnisse und das Aufzeigen der Grenzen von Wissenschaft sind unabdingbar, um das Vertrauen in die Wissenschaft und damit ihre Legitimierung langfristig zu erhalten.
Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider.