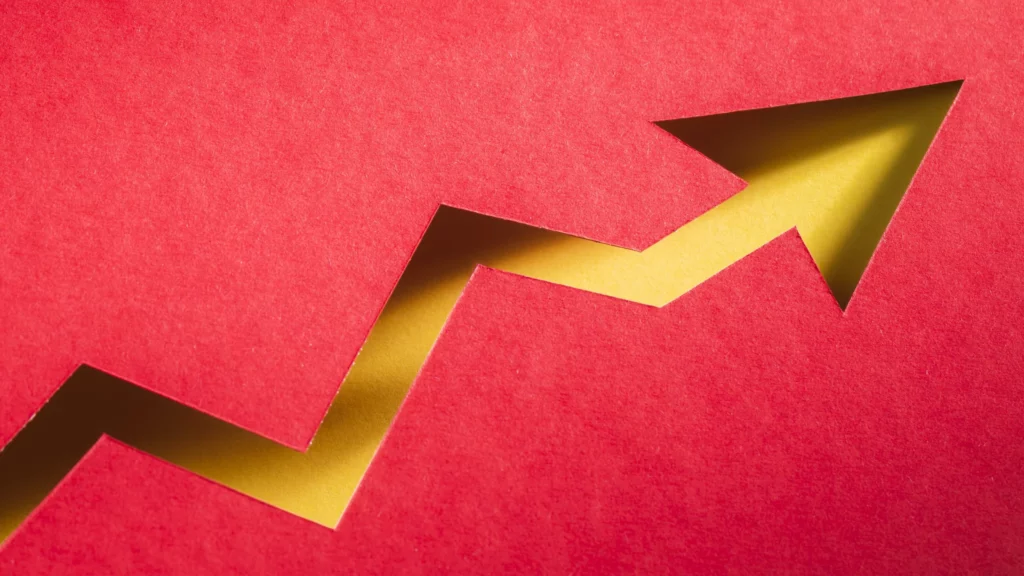Wissenschaftliche Innovationen werden nicht im luftleeren Raum entwickelt. Im Interview erläutert Stefanie Molthagen-Schnöring, Vizepräsidentin der HTW Berlin, wie Transfer- und Wissenschaftskommunikation Prozesse produktiv begleiten können.
Innovationen entstehen in der Interaktion
Frau Molthagen-Schnöring, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Wissenschaftskommunikation Innovationen in Wirtschaft, Gesellschaft oder Politik anstößt?

Besonders gute Voraussetzungen für Innovation haben die Forschungsprojekte, bei denen Transfer und Wissenschaftskommunikation von Anfang an, das heißt schon in der Ideen- und Antragsphase, mitgedacht werden. Wenn man sich also von vornherein mit den Fragen auseinandersetzt, was in einem Forschungsprojekt eigentlich Innovatives mit Nutzen für die Gesellschaft entstehen kann und wie man darüber kommunizieren sollte. Das setzt dann auch ein partizipatives Verständnis von Wissenschaftskommunikation voraus, da Innovationen nicht am Reißbrett, sondern in der Interaktion entstehen.
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen?
Neue Ideen oder Technologien sind oftmals komplex und erklärungsbedürftig. Deshalb ist eine klare, informierende Kommunikation entscheidend, die verdeutlicht, was daran tatsächlich neu ist und welchen Nutzen eine Innovation hat. Dabei stellen etwaige Verschwiegenheitspflichten eine Herausforderung dar. Die können nämlich dazu führen, dass die Kommunikation über eine neue Innovation erst relativ spät einsetzen kann. Außerdem muss heute immer auch gegen die allgemeine Wahrnehmung kommuniziert werden, wir seien in Deutschland gar nicht mehr innovativ. Ich denke, dass Wissenschaftskommunikation hier helfen kann, Innovationen nicht erst im Ergebnis, sondern schon im Prozess zu kommunizieren.
Wann spielt Wissenschaftskommunikation im klassischen Transferprozess eine Rolle?
Je früher, desto besser. Wir denken Transfer nicht mehr so, dass etwas Fertiges aus der Forschung der Wirtschaft und der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Sondern der Transferprozess beginnt da, wo ein Problem auftaucht, das mithilfe wissenschaftlicher Expertise gelöst werden soll. Und da muss es dann zu einer Verständigung der beteiligten Transferpartner kommen. Ist das Transferkommunikation oder Wissenschaftskommunikation? Darüber lässt sich akademisch diskutieren, aber zentral ist doch, dass wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse in diesem Prozess zur Anwendung kommen und außerhalb der engen Wissenschaftscommunity kommuniziert werden müssen.
Eine besondere Chance für Wissenschaftskommunikation, die meines Erachtens bisher noch nicht ausreichend genutzt wird, besteht im Hinblick auf den Transferkanal (Aus-)Gründungen. Denn hier entstehen innovative Produkte und Dienstleistungen mit einem hohen Innovationsgrad. Vor allem im Bereich der Deep-Tech-Technologien sind diese jedoch erklärungsbedürftig. Gleichzeitig tragen sie zu Lösungen für viele aktuelle Herausforderungen und Probleme bei – ob im Kampf gegen den Klimawandel, im Gesundheitswesen und in vielen weiteren Bereichen – bei und lassen sich daher für die Wissenschaftskommunikation nutzen, die positive Geschichten erzählen kann.
Gibt es aus Ihrer Sicht Best-Practice-Beispiele von Transferprojekten an der HTW Berlin, die besonders gut gelaufen sind?
Im Bereich der Klimaanpassung gibt es ein schönes Beispiel an der HTW. Wir verwandeln unseren Campus als Reallabor in einen „grün-blauen Campus“, indem wir Flächen entsiegeln, mehr Grünflächen schaffen und Beton reduzieren. Wissenschaftskommunikation wurde hier bereits im Projektantrag mitgedacht. Wir haben die Forschenden dabei unterstützt, geeignete Zielgruppen zu identifizieren und zu entscheiden, an welchen Stellen des Projekts sie wie kommunizieren wollen. So entstand ein klarer Zeitplan für verschiedene vermittelnde und partizipative Formate. Uns ist in diesem Projekt besonders wichtig, die Anwohner*innen einzubeziehen: Sie sollen den Campus kennenlernen, ihre eigenen Ideen für das Projekt im Laufe des Prozesses einbringen und den Campus auch selbst nutzen können – etwa am Wochenende. Kommen Vorschläge aus der Nachbarschaft, setzen wir diese nach Möglichkeit im Projektverlauf um. Das führt zu einem kontinuierlichen Austausch, der auch medial aufgegriffen wird – und die Forschenden lernen, noch gezielter mit Wissenschaftskommunikation umzugehen.
Wie kann es gelingen, frühzeitig Studierende in diese Transfer- und Kommunikationsprozesse einzubinden?
Studierende lassen sich über anwendungsbezogene Fragestellungen in der Lehre für die Wissenschaft begeistern und auch aktiv in die Wissenschaftskommunikation einbinden. Im zuvor genannten Projekt bieten Studierende beispielsweise Campusführungen an, in denen sie erklären, wie Klimaanpassung an der HTW umgesetzt wird und warum das wichtig ist. Auf diese Weise tragen sie das Thema selbst kommunikativ weiter.
Aus solchen Praxisprojekten entstehen häufig Ideen für Abschlussarbeiten. Und hier besteht für die Studierenden dann auch die Herausforderung, ihre Ergebnisse in die Praxis zurückzuspielen – eine frühe Übung in Transfer- bzw. Wissenschaftskommunikation.
Welche Missverständnisse treten auf, wenn Sie mit Forschenden oder externen Partnern über Transfer und Wissenschaftskommunikation sprechen?
Ein häufiges Missverständnis ist es, Wissenschaftskommunikation auf reine PR-Maßnahmen zu reduzieren, als fertiges Produkt für die Medien. Damit hängt die Annahme zusammen, dass allein die Kommunikationsabteilung für Wissenschaftskommunikation zuständig ist und die Projektbeteiligten diesen Teil delegieren können. Dabei geht es doch darum, dass Wissenschaftler*innen – von Studierenden bis zu Projektleitungen – selbst aktiv kommunizieren. Dafür reicht es nicht aus, am Ende lediglich einen Projektbericht zu schreiben. Klar muss aber auch sein: Wissenschaftskommunikation macht man nicht mal eben nebenbei. Sie erfordert Zeit, Vorbereitung und die Fähigkeit, sich auf unterschiedliche Partner*innen und Zielgruppen einzustellen.
Welche Kompetenzen benötigen Kommunikator*innen, um in einem innovationsorientierten Kontext wirksam zu agieren?
Ich denke nicht, dass hier besondere Kompetenzen jenseits derer nötig sind, die Kommunikator*innen in unserer Zeit ohnehin benötigen. Es geht darum, sich immer wieder auf neue Kontexte einzustellen, einordnen zu können, flexibel verschiedene Medien zu bespielen. Die Mitarbeiter*innen in den Kommunikationsabteilungen werden in diesen Zeiten immer mehr zu Berater*innen und Coaches, die z.B. Wissenschaftler*innen sensibilisieren, über Chancen aber auch Risiken von Innovationen zu sprechen.
Kann ein zu starker Fokus auf Transfer und Innovation auch Risiken bergen, etwa indem die Grundlagenforschung in den Hintergrund tritt?
Aktuell ist Transfer in aller Munde. Der Koalitionsvertrag spricht da zum Beispiel eine klare Sprache. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass nur Forschung mit einem unmittelbar erkennbaren Nutzen oder Anwendungsbezug gewollt ist. Insofern muss auch immer wieder deutlich gemacht werden, dass Grundlagenforschung die Basis für sehr viele praktische Anwendungen ist.
Ich sehe darüber hinaus das Risiko von Hypes, bei denen dann alles als innovativ bezeichnet wird und man sehr genau hinschauen sollte, was wirklich dahintersteckt. Tatsächlich ist Transfer oft unspektakulär, aber wertvoll, weil er konkrete Probleme löst, auch wenn das nicht immer gleich zu Sprunginnovationen führt.