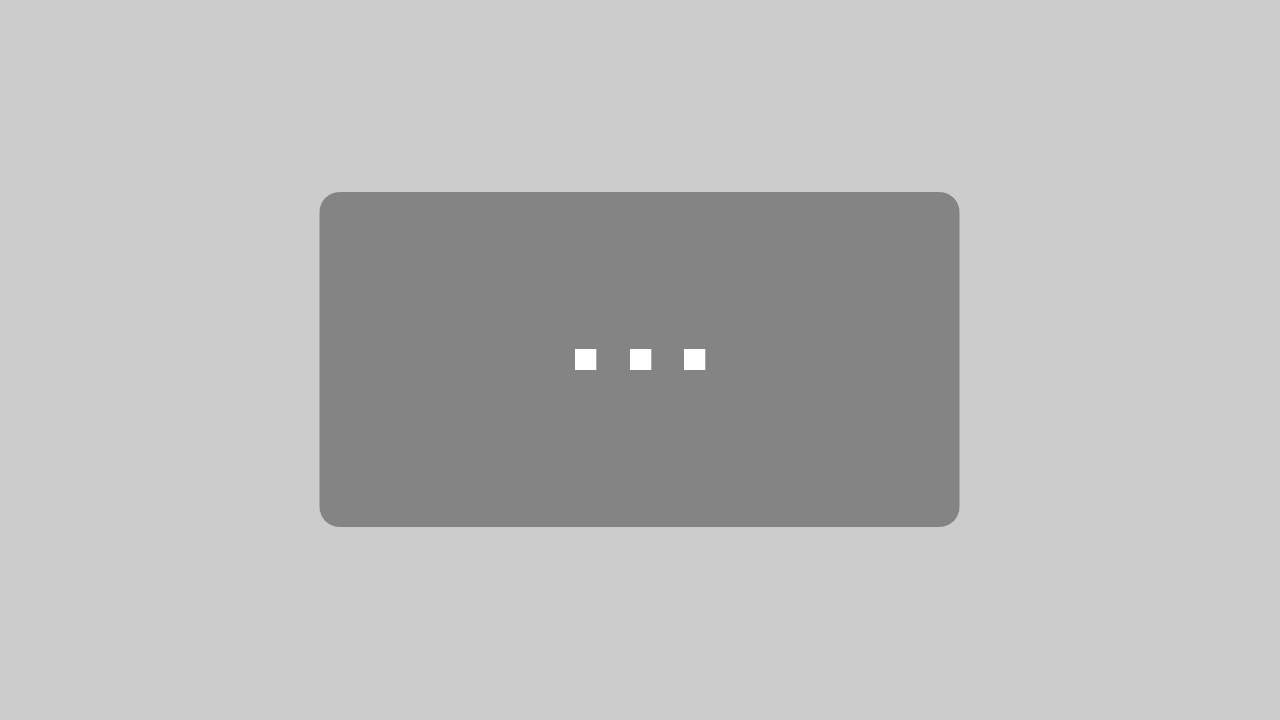„Gefühlte Wissenschaft – Wissenschaftskommunikation zwischen Evidenzbasierung und Emotionsmodus?“ lautete der Titel der Jahrestagung der DGPuK an der TU Braunschweig. Ein Gespräch mit Keynotesprecher Rainer Bromme von der Universität Münster über Emotionen und Werte in der Wissenschaftskommunikation.
„Die Emotionsdebatte ist auch eine Wertedebatte“
Herr Bromme, wenn man den Titel der Tagung liest oder sich die aktuelle Debatte um Storytelling in der Wissenschaftskommunikation anschaut, wird dort suggeriert, dass es ein Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Emotionen gibt. Wo liegt dieses aus Ihrer Sicht?
Das Spannungsfeld liegt in der Frage, ob Emotionen und emotionale Kommunikation die Objektivität der Wissenschaft gefährden beziehungsweise beeinflussen. Aus meiner Sicht gibt es keinen wirklichen Gegensatz, aber man muss das schon ein wenig sortieren: Objektivität ist das Ziel und Emotionen spielen auf dem Weg dahin eine Rolle. Objektivität bezeichnet dabei eine normative Vorstellung: Wissenschaft versucht eine valide, eine gültige Beschreibung und Erklärung unserer Welt zu erreichen, und diese sollte frei von den Emotionen oder den Werten der Beteiligten oder der Öffentlichkeit sein. Objektivität ist also dann wichtig, wenn es um die Frage geht, was eine wahre Aussage über die Welt ist.
Nebenbei gesagt: Wenn wir von der Wahrheit der Gültigkeit wissenschaftlicher Aussagen sprechen, müssen wir natürlich immer die Anführungszeichen mitsprechen, denn die Frage, was als ‚wahr‘ und ‚gültig‘ gilt, muss in der Geschichte der Wissenschaften immer wieder neu verhandelt werden. Dennoch braucht Wissenschaft diese Zielvorstellung der Objektivität.

Die Entscheidung über die Frage, ob etwas eine wahre oder weniger wahre Aussage ist, muss also, von der inhaltlichen Seite her, ohne Emotionen getroffen werden. Aber die Forschungsarbeit, die diese Entscheidung überhaupt ermöglicht, wird fast immer auch mit Emotionen ablaufen. Auch bei den Debatten unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind Emotionen dabei. Und sie sind auch dann dabei, wenn es darum geht, wie diese Erkenntnisse genutzt werden oder was sie bedeuten. Forschende sind schließlich Menschen mit Emotionen, Zielen und Werten, die sie automatisch in ihren Arbeitsalltag einbringen. Wissenschaftliche Methoden sind – unter anderem – dazu da, die Emotionen quasi aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen herauszurechnen.
Sollte man Emotionen dann auch in der Kommunikation über Wissenschaft außen vor lassen?
Ich denke nicht, dass das überhaupt möglich ist und Emotionen sind auch nicht per se schlecht. Ganz im Gegenteil, sie können viele positive Konsequenzen haben, wenn sie richtig eingesetzt werden.
Gibt es konkrete Beispiele, was man mit emotionaler Kommunikation erreichen kann?
Ein schönes Beispiel – welches ja auch von meinem Vorredner auf der Tagung, Markus Bauer, sehr anschaulich präsentiert wurde – ist die Rosetta-Kampagne der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Hier wurden Emotionen eingesetzt, um Aufmerksamkeit für ein Thema zu schaffen und zwar, indem man Rosetta mit menschlichen Zügen und Geschichten versehen hat und sie uns so nahe gebracht hat. Man erreicht auf jeden Fall einen positiven Effekt auf dem Aufmerksamkeitsmarkt. Das ist eine wichtige Funktion von Emotionen, weil ohne Interesse, ohne Aufmerksamkeit selbst die beste Wissenschaftskommunikation nichts bewirkt. Wie Herr Bauer sagte: Damit baut man eine Brücke zu den Menschen.
Da kommen wir zu der Frage, wer über die Brücke geht und mit welchen Informationen? Die Frage, die man dann stellen muss, ist die, was man mit dem so geweckten Interesse macht? Wenn ein technisches Gerät wie Rosetta so lebendig, so menschenähnlich gemacht wird, indem viele Menschen weltweit aufgefordert werden, sie zu wecken, so transportiert das erst einmal wenig wissenschaftliche Informationen. Das war aber auch nicht das primäre Ziel der Emotionalisierung. Es gelingt den Verantwortlichen dann durchaus auf anderen Wegen, mehr wissenschaftliche Informationen über die Rosetta-Mission zu vermitteln.
Herr Bauer hat auch gezeigt, dass sie bei der ESA über die Emotionen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an der Rosetta Mission beteiligt waren, berichten. Zum Beispiel, indem sie deren Emotionen zeigen, als im Kontrollzentrum klar wurde, dass Rosetta tatsächlich ‚erwacht‘ ist. Das ist ein guter Ansatz um, ausgehend von den Emotionen der beteiligten WissenschaftlerInnen, die wissenschaftlichen und technischen Problemstellungen und die gefundenen Lösungen darzustellen.
In der Debatte über Emotionen in der Wissenschaftskommunikation denkt man ja zuerst an die emotionalen Inhalte. Aber die Emotionen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu zeigen ist meines Erachtens auch deshalb ein guter Ansatz, weil Emotionen immer mit Werten einhergehen. Wenn ich meine Emotionen zeige, kommuniziere ich auch etwas über meine Werte. Die Emotionsdebatte ist also immer auch eine Wertedebatte.
Inwiefern hängen diese beiden Begriffe für Sie zusammen?
Emotionen erlauben es uns, ein sehr schnelles und unmittelbares Bild der Werte zu erlangen, die unser Gegenüber hat. Dafür sind sie sehr nützlich. Es ist hilfreich, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Werte offen kommunizierten. Allerdings liegt eben darin auch die Paradoxie, denn bei der Beantwortung der Frage, ob etwas wahr oder nicht wahr ist, dürfen die Werte dann wieder keine Rolle spielen.
Ich würde mir wünschen, dass Forschende sich vermehrt leidenschaftlich dafür einsetzten, dass wissenschaftliche Erkenntnisse leidenschaftslos behandelt werden müssen. Sie sollen also leidenschaftlich für die Grundwerte wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns eintreten und sich in dieser Frage klar positionieren.
Riskiert die Wissenschaft nicht, sich selbst zu verraten oder zu verlieren, wenn sie zu stark auf der emotionalen Ebene kommuniziert?
Wichtig ist dabei aus meiner Sicht nicht die Frage, ob sich Wissenschaft emotionalisiert, sondern die Frage, für welche Werte sie eintritt. Wissenschaft muss auf den Erklärungsmöglichkeiten von Wissenschaft bestehen und darüber kommunizieren, was die Bedeutung des wissenschaftlichen Konsenses ist und wie er entsteht. Wichtig ist, dass die Emotionen klar an einen Grund gebunden sind. Es muss erkennbar bleiben, auf welche Werte sich die Emotionen beziehen und was sie auslöst.
In der Einladung zu der DGPuK Jahrestagung wurde bereits der Zusammenhang zwischen der Emotionsdebatte und Populismus sowie Wissenschaftsfeindlichkeit angesprochen. Aus meiner Sicht sind in diesem Zusammenhang Emotionen nicht das Problem, aber auch nicht die Lösung. Vielmehr geht es darum, für welche Werte die Wissenschaft eintreten sollte und welche Emotionen diese Werte vermitteln. Das ist in dem Zusammenhang mit dem Populismus die Sorge um den Verlust der öffentlichen Akzeptanz, dass Wissenschaft die Welt besser verständlich machen kann.
Könnten Sie dies an einem Beispiel noch mal erläutern?
Gut verdeutlichen lässt es sich bei Donald Trump und dem Thema Klimawandel. Was ist das Problem, wenn der gegenwärtige US Präsident behauptet, der Klimawandel sei eine ‚Erfindung der Chinesen‘? Es ist ja nicht so, dass eine Mehrheit der Bevölkerung ihm das glaubt, auch nicht in den USA. Das Problem besteht darin, dass er eine empirische Frage (Was verursacht den Klimawandel?) in den Bereich der Meinungen verschiebt. Das gefährdet das öffentliche Verständnis davon, welche Fragen man mit wissenschaftlichen Methoden überhaupt bearbeiten kann. Dagegen muss sich die Wissenschaft aus meiner Sicht aktiv wehren.
Ich hatte eben bereits die Bedeutung des wissenschaftlichen Konsenses angesprochen. Das ist durchaus vertrackt: Wissenschaftliche Wahrheit wird in einem Konsens unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gefunden und dennoch sind das keine beliebigen Vereinbarungen, die zu Lasten der Wirklichkeit gemacht werden können. Anders gesagt: Manchmal muss dieser Konsens auch wieder verändert werden, aber dennoch gibt es viele Ergebnisse, die wir als gesichert annehmen können. Das zu verstehen, ist nicht einfach. Aber genau hier liegt die große Herausforderung der heutigen Wissenschaftskommunikation.
Nebenbei: Es hängt übrigens auch von der historischen Situation und dem Kontext ab, ob es wichtiger ist, leidenschaftlich auf die Revidierbarkeit des Konsenses über die ‚Wahrheit‘ hinzuweisen oder aber auf die Gültigkeit und Verlässlichkeit des jeweiligen Kenntnisstandes. Beim Thema ‚Ursachen des Klimawandels‘ ist derzeit vermutlich das Letztere der Fall.
Was bedeutet das für die Wissenschaftskommunikation?
In der heutigen Zeit muss diese immer stärker auch die Rolle erfüllen, Menschen dabei zu helfen informiertes Vertrauen in die Wissenschaft auszubilden. Dazu braucht es neben Interesse und einem Grundverständnis der Inhalte auch ein Verständnis davon, wie das System der Wissenschaft funktioniert und warum und wann wir davon sprechen können, dass wissenschaftliche Ergebnisse wahr sind.
Mehr zur Tagung
„Meistens hätte es Leute gegeben, die noch mehr Ahnung vom Thema haben“ – Interview mit Melanie Leidecker-Sandmann über ihre Studie, in der untersucht wurde, inwieweit Journalistinnen und Journalisten bei wissenschaftlichen Themen tatsächlich die renommiertesten Forschenden interviewen.
Leidenschaftlich für die Leidenschaftslosigkeit – Rückblick und Zusammenfassung der Tagung von Ricarda Ziegler im Gastbeitrag.
Videomitschnitt der Paneldiskussion „Emotional(isierend)e Inhalte“ vom 7. Februar: