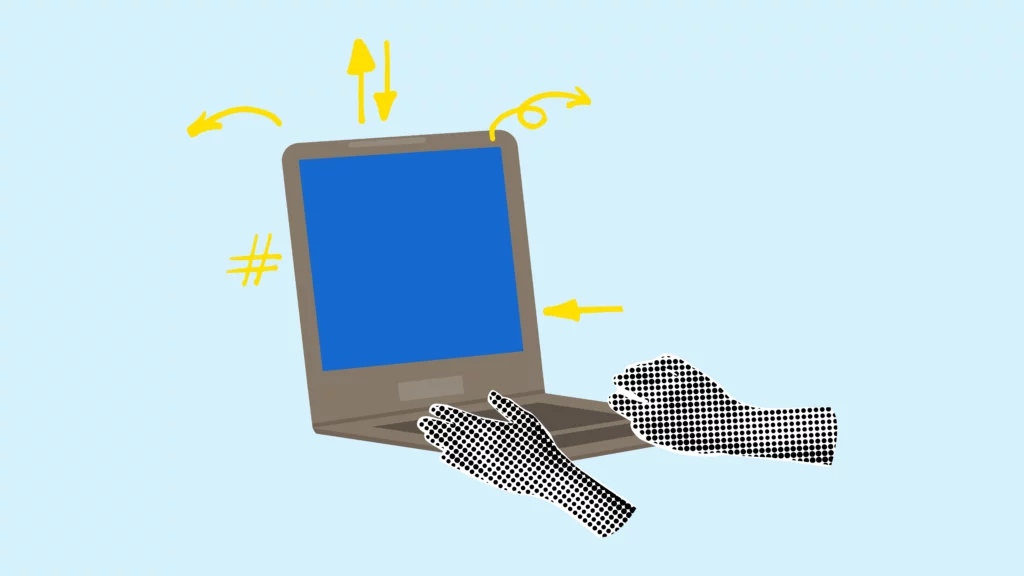Unternehmen investieren in Universitäten, Regierungen knüpfen Fördermittel an Bedingungen. Nehmen Wirtschaft und Politik damit unerlaubt Einfluss auf die Forschung? Und ist Transparenz eine Lösung oder ein Hindernis? Danach fragt der Schwerpunkt Unabhängigkeit der Forschung. Ein Überblick über Standpunkte und Diskussionen.
Der Verdacht, gekauft zu sein
Wenn Autohersteller eine Studie zu Stickoxiden in der Atemluft finanzieren, dann sind die Ergebnisse „von vorneherein wertlos“, schrieb Patrick Illinger Ende Januar 2018 in der Süddeutschen Zeitung. „Sie sind in der Öffentlichkeit so unglaubwürdig, wie es Monsanto-Studien über Herbizide oder Publikationen von Coca-Cola zu zuckerhaltigen Getränken wären.“ Er bezog sich dabei auf die Nachricht, dass die von VW, Daimler und BMW gegründet Lobbyvereinigung EUGT Stickoxidversuche mit Affen und Menschen unterstützt hatte.
Wann ist ein Forschungsvorhaben ausreichend transparent?
Die Studie an Menschen, in der es nicht um Diesel-Abgase, sondern um die Belastung der Atemluft am Arbeitsplatz ging, stammte von der RWTH Aachen. Der Studienleiter Thomas Kraus verteidigte sich: „Es muss gewährleistet sein, dass die Industrie keinen Einfluss auf die Versuchsanordnung, die Durchführung und die Ergebnisse nimmt und dass Transparenz darüber herrscht, wer das Vorhaben fördert. Das war im Fall der EUGT alles erfüllt“, sagte er damals.
Doch Illinger argumentierte, dass das nicht ausreicht. Die Wissenschaft müsse mehr gegen den Verdacht tun, käuflich zu sein, wenn sie Geld aus der Industrie annehme. Einer von Illingers Vorschlägen lautet: Es muss sich mehr als ein Institut um die Schädlichkeit von Stickoxiden kümmern – die Wissenschaft muss es zu ihrer Aufgabe machen, die möglichen Gesundheitsgefahren zu ermitteln. „Ein dubioser Verein der Autoindustrie ist jedenfalls die falsche Instanz.“ Wie aber klärt man, ob die Wissenschaft selbst die Idee zu einem Projekt hatte, oder sich von einem Geldgeber überzeugen ließ? Das Chancen-Ressort der Zeit, das kürzlich 78 Universitäten nach ihren Kooperationen mit der Wirtschaft befragt hat, bringt dazu einen weiteren Vorschlag ins Spiel: Transparenz.
Kann drittmittelfinanzierte Forschung überhaupt ganz frei sein?
Die Wissenschaft ist bei diesem Thema meist wortkarg. Nur 27 der von der Zeit angefragten Universitäten wollten oder konnten ihre industrie- und stiftungsfinanzierten Drittmittelprojekte oder Institute vollständig auflisten. „Wenn ein immer engeres Band zwischen Wirtschaft und Wissenschaft das Ziel ist: Wäre es nicht angebracht, öffentliche Kontrolle nicht zu behindern, sondern zu ermöglichen?“, fragten die Autoren Anant Agarwala und Fritz Zimmermann. Sie haben auch einen Verdacht, warum Universitäten so selten Auskunft geben: Transparenz vertreibe die Industrie.
Das Online-Portal Hochschulwatch verfolgt diese Linie schon seit einigen Jahren. Es argumentiert, dass Geldgeber nicht nur direkt, sondern auch indirekt auf die Forschung Einfluss nehmen könnten. Ein indirekter Einfluss wäre gegeben, wenn die Wissenschaftler – bewusst oder unbewusst – aus Rücksicht auf ihren Auftraggeber oder in Erwartung künftiger Projekte ihre Forschungsergebnisse verzerren. Mit anderen Worten: Es besteht laut Hochschulwatch die Gefahr, dass die über Drittmittel finanzierte Forschung nicht ganz frei ist. Das Portal sammelt und veröffentlicht daher Informationen über Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Klar ist, dass die Industrie kräftig in die Universitäten investiert: Sie kauft Namensrechte für Hörsäle, finanziert neue Lehrstühle für einige Jahre, unterstützt Graduiertenschulen und vor allem gibt sie Studien in Auftrag.
Die meisten Drittmittel kommen vom Bund
Das ist im Grundsatz politisch gewollt, denn man verspricht sich davon eine höhere Innovationskraft des Landes. Wenn Wissenschaft und Wirtschaft zusammenarbeiten, entstehen aus Erkenntnissen der Grundlagenforschung schneller Anwendungen, so die Grundidee. Das Bundesforschungsministerium erklärt zum Beispiel zu seiner Hightech-Strategie: „Erfolgreiche Instrumente der Innovationsförderung stehen für einen lebendigen Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.“ Und es setzt selbst Schwerpunkte für die Förderung. Zu den Themen, die der Bund besonders unterstützen will, gehören: Krebs, IT-Sicherheit, Energiewende, Stadtentwicklung, Mobilität, Computertechnik und Quantentechnologien. Wichtige Anliegen, gewiss, doch eben auch ein Anreiz für Wissenschaftler, sich damit zu beschäftigen.
Von den Drittmitteln, die an Universitäten eingeworben werden, stammen etwa 19 Prozent aus der Wirtschaft, berichtet das Statistische Bundesamt. Das waren im Jahr 2015 knapp 1,3 Milliarden Euro oder 57.000 Euro pro Professor. Weitere sechs bis sieben Prozent der Drittmittel kommen von Stiftungen, der Anteil der Bundesmittel liegt bei etwa 24 Prozent.
Der Deutsche Hochschulverband kritisierte jüngst, dass sich in den vergangenen zehn Jahren das Verhältnis von Grundfinanzierung und Drittmitteln umgekehrt habe: Vor zehn Jahren kamen noch 56 Prozent der Universitätsbudgets aus den Landeshaushalten und 44 Prozent von anderen Finanziers, heute sind 44 Prozent des Etats Landesmittel und 56 Prozent werden anderweitig eingeworben. Der Druck ist also gestiegen, Drittmittel einzuwerben.
Beeinträchtigt Transparenz die Freiheit der Forschung?
Machen sich Wissenschaftler und wissenschaftliche Einrichtungen damit zu sehr von ihren Geldgebern abhängig? In der Umfrage „Wissenschaftsbarometer“ sagten 76 Prozent der Befragten, dass diese starke Abhängigkeit ein Grund sei, Wissenschaftlern zu misstrauen. Grund genug also, über Alternativen nachzudenken. Doch die Alternativen sind umstritten, und auch die Kritiker stützen ihre Argumentation auf die Forschungsfreiheit: Wissenschaftler dürfen selbst entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten und wann sie ihre Ergebnisse veröffentlichen – eben weil sie frei sind. „Es muss in der Wissenschaft – wie auch in der Politik und Wirtschaft – geschützte Räume geben, in denen man arbeiten kann“, sagt zum Beispiel der Sprecher der Universität Köln, Patrick Honecker, im Interview, das morgen hier im Journal erscheint.
Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages veröffentlichte 2011 ein Gutachten zur Frage, ob Universitäten verpflichtet werden sollten, alle Kooperationsverträge mit Firmen zu veröffentlichen. Das Fazit war eine Warnung: „Die Wissenschaftler wären durch Offenlegung etwaiger Forschungsgegenstände oder -projekte in ihrer Forschungsfreiheit beeinträchtigt.“ Die Veröffentlichung könne einen eventuellen Know-how-Vorsprung entwerten. „Damit dürften Kooperationsvereinbarungen unattraktiv werden.“ Der Wissenschaftliche Dienst bestätigte also die These, dass Transparenz die Industrie vertreibe. Er regte an, nur die Höhe der eingeworbenen Mittel und die Laufzeit der Projekte zwingend zu publizieren.
Werden aber die Ergebnisse der Studie schließlich veröffentlicht, verlangen inzwischen viele Fachjournale, dass die Wissenschaftler eventuelle Interessenskonflikte offenlegen. Thomas Kraus von der RWTH Aachen gab in seiner Studie zum Beispiel die Förderung durch die EUGT an. Ein Forscherteam fand 2016 heraus, dass 116 von 117 untersuchten Medizinjournalen eine solche Regelung eingeführt hatten. Allerdings kritisierten die Forscher, dass nur 29 Prozent der Fachzeitschriften auch verlangten, eventuelle finanzielle Verbindungen des Instituts oder der Hochschule anzugeben, an der die Autoren arbeiten. Hier könnte zum Beispiel erwähnt werden, dass ein Unternehmen die Namensrechte für Hörsäle des Instituts gekauft hat.
Das Wissenschaftsmagazin Nature gab Anfang des Jahres bekannt, künftig sogar nicht-finanzielle Interessenskonflikte abzufragen: etwa Mitgliedschaften in Verbänden und Lobbygruppen. Wenn schon nicht bei der Planung und Durchführung der Experimente soll spätestens bei der Präsentation der Ergebnisse deutlich werden, welche möglichen verzerrenden Einflüsse es auf die Arbeit gab. Ob die Ergebnisse tatsächlich verzerrt sind, wird dadurch aber nicht beantwortet.
Vorschau: In einem weiteren Teil des Schwerpunktes geht es um die Frage, wie frei Wissenschaftler sind, wenn sie unter einem hohen Konkurrenz- und Publikationsdruck leiden.