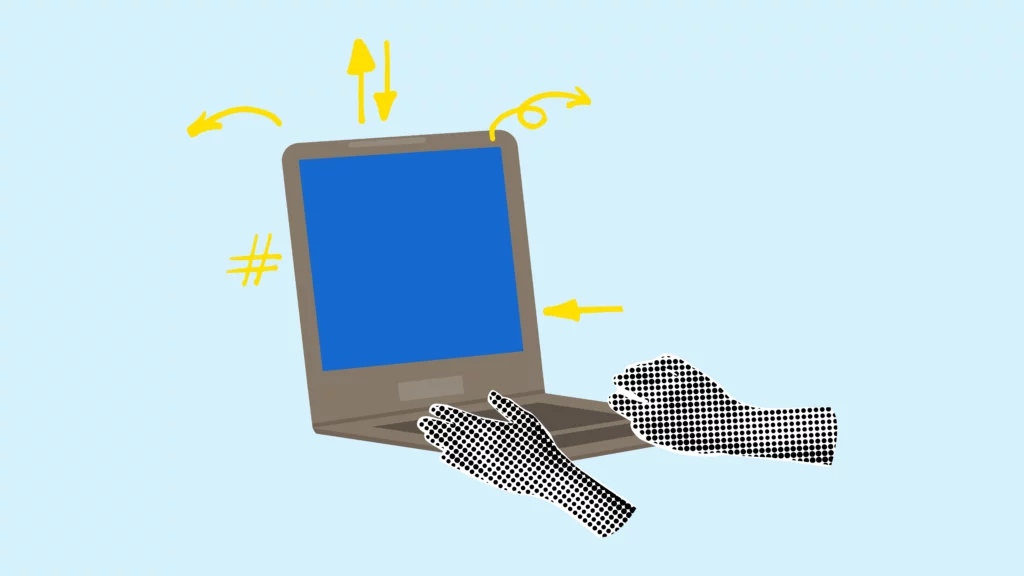Wie wählen Medien Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft für ihre Berichte aus? Wissenschaftsjournalist Martin Schneider erklärt, worauf es ankommt und gibt Tipps für gute Interviews.
„Das erste Kriterium ist die wissenschaftliche Exzellenz“
Herr Schneider, wie funktioniert die Expertenauswahl bei Ihnen?
Das hängt ein bisschen von den Sendungen ab und man muss verschiedene Dinge beachten. Das erste Kriterium ist die wissenschaftliche Exzellenz. Die Expertinnen und Experten haben die Funktion, Argumente zu unterstreichen und zu belegen. Wir haben hier beim Südwestrundfunk (SWR) darüber hinaus noch das spezielle Kriterium, dass die Forschenden idealerweise aus dem Sendegebiet kommen sollen. Auch diese regionale Komponente gilt es zu beachten, wenn es irgendwie möglich ist. Darüber hinaus braucht man dann auch noch jemanden, der sich dazu bereit erklärt, bei sich drehen zu lassen.
Das ist gar nicht so trivial, da Fernsehen sehr aufwendig ist und ein Dreh oft mehrere Stunden dauert. Außerdem braucht es natürlich noch jemanden, der gut und emotional über seine Forschung sprechen kann und das idealerweise auch noch vor der Kamera.
Was genau macht denn einen Forschenden aus, der gut vor der Kamera spricht?

Wir sind beim Fernsehen fast immer auf der Suche nach emotionalen und nicht nach erklärenden O-Tönen. Etwas erklären kann die Autorin oder der Autor im Kommentartext fast immer besser und prägnanter. Wir sind deshalb auf der Suche nach Forschenden, die erzählen, wieso etwas wichtig und spannend ist und die für ihre Sache brennen. Die Forschenden übernehmen hier mehr eine einordnende Funktion.
Fällt das den Interviewten in der Regel leicht?
Hier hat sich aus meiner Sicht viel zum Positiven verändert. Früher haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Interview oft zunächst an ihr Kollegium gedacht und daher sehr wissenschaftlich akkurat und mit vielen Fachbegriffen über ihre Forschung gesprochen. Heute gelingt es ihnen viel besser, auf Fachvokabeln zu verzichten und sie sind auch eher dazu bereit, für Laien zu erklären.
Bei Ärztinnen und Ärzten greifen wir dabei oft auf den Trick zurück, dass sie es einer Patientin oder einem Patienten erklären – entweder tatsächlich oder fiktiv. In anderen Fachrichtungen sind es dann vielleicht die Großtante oder ein nichtakademischer Person aus der Nachbarschaft, den wir den Forschenden bitten, sich als Gegenüber vorzustellen. Das funktioniert in der Regel sehr gut.
Wie gut funktionieren denn Interviews mit Forschenden aus Ihrer Sicht?
Auch wenn ich die Interviews nicht mehr aus erster Hand erlebe, also selten selbst führe, habe ich den Eindruck, dass es viele gibt, die es sehr gut können inzwischen und auch schon geübt sind. Ausnahmen davon gibt es aber auch immer wieder und für einige ist es auch heute noch ein relativ fremdes Metier. Das finde ich manchmal aber auch gar nicht so schlimm. Wir wollen ja die Wissenschaftlerin oder den Wissenschaftler als authentische Person zeigen. Dafür muss er nicht ganz geschliffen in 30-Sekunden-Abschnitten sprechen, sondern vor allem begeistert erzählen. Da kann zu viel Medientraining manchmal sogar schädlich sein, weil es nicht mehr authentisch klingt.
Ist es wichtig, Forschende verstärkt auch in Massenmedien wie Talkshows zu bekommen?
Auf jeden Fall. Sie gehören in die Massenmedien und müssen dort auch Position beziehen. Wissenschaftliche Expertise geht aber nicht immer damit einher, auch medienaffin zu sein. Bei Talkshows gibt es häufig den Effekt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen werden, die gut rüberkommen vor der Kamera, aber nicht unbedingt die größte Expertise in diesem speziellen Thema haben. Das ist suboptimal, aber generell denke ich, dass es wichtig ist, Forschende auch in Talkshows zu haben.
Hat sich an der Zusammenarbeit zwischen Medien und Wissenschaft ganz generell etwas verändert?
Ich glaube, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finden es heute wichtiger, in den Medien zu sein als früher und mit einer breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren. Es gilt nicht mehr als nur noch lästig. Natürlich wird es aber auch immer Leute geben, die es gar nicht mögen.
Welche Forschungsthemen schaffen es denn in Ihre Sendungen?
Es gibt einen gewissen Bias bei der Auswahl unserer Themen hin zu Forschung, die etwas mit dem Leben der Menschen zu tun haben. Als Massenmedium wollen und müssen wir halt so viele Rezipienten wie möglich erreichen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie beispielsweise Astro-Themen, die einen erhöhten Faszinationsfaktor haben und deshalb auch öfter mal vorkommen. Reine Grundlagenforschung kommt da leider etwas kurz. Das gilt aber in allen Publikumsmedien: Niemand schreibt im luftleeren Raum und alle wollen gelesen, gesehen oder gehört werden, sonst würde man sich ja nicht in diesem Berufsfeld bewegen. Journalistinnen und Journalisten arbeiteten halt immer auch rezipientenorientiert.
Inwiefern beziehen gute Fernsehbeiträge eine Position zu einem wissenschaftlichen Thema?
Für mich gehört das ganz klar dazu. Mit einem Beitrag will man immer Haltung und Bewertung ermöglichen. Es geht nicht darum, eine Meinung vorzugeben, aber das Ziel ist es, der Zuschauerin oder dem Zuschauer genügend Einblicke zu geben, damit sie oder er sich eine Haltung zum Thema bilden kann. Und in aller Regel hat jeder Beitrag daher auch eine gut begründete Haltung. Die oft gehörte Forderung, man müsse immer alle Seiten ausgewogen zu Wort kommen lassen, halte ich nicht für vereinbar mit meinem Verständnis von Journalismus.
Es gibt diesen schönen Spruch: Wenn jemand sagt, es regnet, und ein anderer sagt, es regnet nicht, dann ist es nicht deine Aufgabe als Journalistin oder Journalist, beide Meinungen darzustellen, sondern rauszugehen und zu gucken, wer Recht hat.