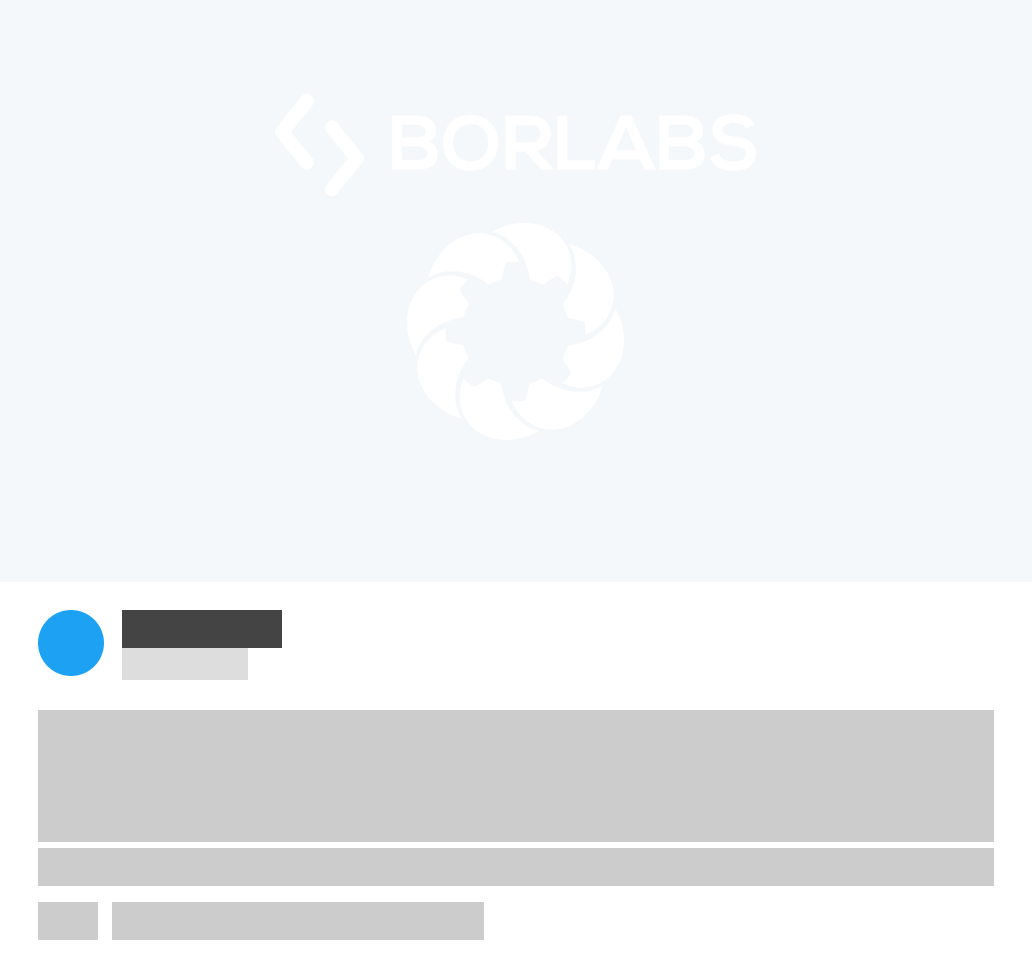Wie muss Kommunikation gestaltet sein, damit sie Menschen Selbstwirksamkeit ermöglicht? Der pädagogische Psychologe Thomas Martens hat dazu 15 Tipps für Wissenschaftler*innen verfasst. Im Gespräch erklärt er, was Motivationspsychologie für die Wissenschaftskommunikation bieten kann.
15 Tipps für handlungsorientierte Kommunikation
Herr Martens, auf Twitter haben sie 15 Tipps für Wissenschaftler*innen zur Wissenschaftskommunikation aus Sicht der Motivationspsychologie geteilt. Warum ist Ihnen dieses Thema wichtig?
Die Leitfrage ist: Wie müssen Informationen gestaltet sein, damit Menschen mit einer konkreten Gefahrensituation gut umgehen können? Dabei bringe ich verschiedene wissenschaftstheoretische Blickwinkel auf diese Kommunikation mit. Die Pädagogik und Soziologie haben einen eher sachlich-beobachtenden Ansatz und fokussieren auch in der Kommunikation auf die Wissensvermittlung. Die Psychologie hat dagegen einen eher handlungsorientierten Ansatz und vor allem das Handwerkszeug der Motivationspsychologie lässt sich auch auf Situationen wie die Coronapandemie anwenden. Das wird bisher aber selten gemacht.
Was war der Anlass dazu, die 15 Tipps auf Twitter zu posten?

Mir fällt auf, dass prominente Wissenschaftler*innen in den Medien Dinge sagen, die sie in einem wissenschaftlichen Kontext so nicht sagen würden. Wenn man zum Beispiel ein Paper einreicht, würde man am Anfang ganz deutlich machen, womit es sich beschäftigt, welche Fragen darin nicht behandelt werden und wozu es konkret Informationen gibt, die darin diskutiert werden. Man würde außerdem sehr deutlich machen, wann man sein Wissensgebiet verlässt und spekuliert. In Gesprächen in den Medien kommt man aber ganz schnell in die Situation, dass man aus seinem konkreten Forschungsgebiet rausgeht und sich zu Dingen äußert, die man nicht konkret erforscht hat. Das geht mir gerade auch so. Ich bin Motivationsforscher und sage jetzt etwas zu Wissenschaftskommunikation, zu der es sicher Spezialist*innen gibt, die sich besser auskennen. Ich schaue also mit meiner Brille der Motivationsforschung und vielleicht noch als Editor-in-Chief auf diese Abläufe. Diese Rolle möchte ich deutlich machen und beobachte gleichzeitig, dass das in Mediengesprächen nicht so häufig passiert.
Wünschen Sie sich also mehr Reflexion darüber, in welcher Rolle Wissenschaftler*innen in der Öffentlichkeit kommunizieren?
Unbedingt. Gerade wenn man in der Lehre tätig ist, kommt man immer wieder in eine asymmetrische Lehr-Lern-Situation. Man selbst hat sehr viel Wissen zu einem Thema, die Studierenden sehr wenig. Das kann schnell zu einer Selbstüberschätzung führen, auf die ich mich auch selbst als Professor immer wieder besinnen muss. Ein Phänomen des Berufs. In einer Peer-to-Peer-Situation mit anderen Wissenschaftler*innen wird man sofort ausgebremst, wenn man sich auf unsicheres Terrain begibt. Das passiert mit Journalist*innen nicht unbedingt. Die lassen einen dann Quatsch erzählen und der wird ausgestrahlt. In solchen Kommunikationssituationen wünsche ich mir also mehr Differenziertheit.
Kann man diese Differenziertheit mit Ihren 15 Tipps erreichen?
Das ist das Ziel. Die ersten beiden Punkte – Wissensbewusstheit und Vermittlung von Grenzen – haben wir ja schon angesprochen. Das nächste Thema sind dann Ziele, also was will ich mit der Kommunikation erreichen und welche versteckten Interessen habe ich vielleicht? Die muss ich dann auch offenlegen. In Zeiten von Corona finde ich den nächsten Tipp besonders wichtig: sich Zeit und Raum für Komplexität zu nehmen. Ein Beispiel ist: Die Dynamiken des Infektionsgeschehens haben immer eine zeitliche Komponente, etwa die Zeit, in der sich das Virus und jetzt die Mutationen ausbreiten. Vor allem das exponentielle Wachstum kann man nur erklären, wenn man die Zeit mit der Zahl der Infektionen in Zusammenhang bringt und dadurch Prognosen erst verständlich werden. Das ist ähnlich wie bei der Geschichte mit dem Schachbrett und dem Reiskorn. Wenn sich bei jedem Feld, das man weiter geht, die Zahl der Reiskörner verdoppelt, passen sie schnell nicht mehr auf das Brett. Die Zeit für solche Ausführungen muss man sich dann nehmen. Auch für die Erklärung von Coronamaßnahmen und deren komplexer Wirkung. Wenn man eine Variable in dem Geflecht der Maßnahmen verändert, beeinflusst dies alle anderen Variablen auch, man weiß aber nicht genau wie. Darum gibt es auch keine einfache Lösung für diese Situation.
Der nächste Punkt ist, das Publikum ernst zu nehmen. Warum ist das aus Sicht der Motivationspsychologie wichtig?
Das hat verschiedene Komponenten. Es bedeutet zum einen, dass man sich motivationspsychologisch verstanden fühlt. Wir nennen das Social Relatedness. Man baut also eine Verbindung zur Situation des Publikums auf. Zum anderen bedeutet es, dass man da andocken muss, wo die Leute mit ihrem Vorwissen und ihrem Interesse stehen und versucht, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen. Der nächste Punkt „Komplexität verringern“ baut dann darauf auf. Das kann man erreichen, indem man mehrfach kodiert, also verschiedene Medien wie Text, Bild oder Film nutzt, um die Inhalte zu vermitteln. Man kann natürlich auch versuchen, die eigene Sprache anzupassen. Das ist aber zum Teil schwierig, da man gewisse Fachwörter braucht, um einen Sachverhalt präzise darzustellen und um anschlussfähig zu sein. Was mir als nächstes besonders wichtig ist, ist die gute wissenschaftliche Praxis.
Was bedeutet gute wissenschaftliche Praxis im Zusammenhang mit der Kommunikation?
Dass man die Quellen offenlegt und diese auch zugänglich sind, im besten Fall Open Access. Ich finde hier auch wichtig, dass man die Kommunikation interdisziplinär offen denkt. Das bedeutet, dass zum Beispiel andere Fachwissenschaften andocken können. Dass man im Fall von Corona zum Beispiel neben Virologie und Epidemiologie etwa auch die Sozialpsychologie mit einbezieht, um den größeren Zusammenhang aufzuzeigen. Dabei finde ich auch den Punkt Interaktivität wichtig. Das Publikum sollte in den Dialog einbezogen und nicht unterschätzt werden. Professor*innen machen das fast in jeder Lehrveranstaltung, dass sie versuchen, mit den Studierenden gemeinsam Fragen zu lösen. Das wird im öffentlichen Diskurs kaum genutzt. Aber warum eigentlich? Traut man dem Publikum nichts zu? Hat Angst vor Trollen? Da wünsche ich mir mehr Mut zum Dialog.
In den letzten drei Tipps geht es darum, wie zusätzlich zu Informationen auch Handlungsansätze vermittelt werden können. Warum sollte Wissenschaftskommunikation diese auch mitdenken?
Aus motivationspsychologischer Sicht sind mir Handlungsansätze besonders wichtig. Diese passen vielleicht nicht zu allen Bereiche der Wissenschaft, etwa wegen fehlender Handlungsoptionen in der Grundlagenforschung. Wenn es aber um anwendungsorientierte Forschung geht, gibt es hier viele Anknüpfungspunkte. Ein Ziel könnte aktuell bei Corona sein, ein Gleichgewicht zwischen Bedrohungssituation und Handlungsoptionen herzustellen. Zum Beispiel indem man aufzeigt, wie effektiv verschiedene Handlungen sind, dies auch illustriert und Beispiele bringt. Damit schafft man Selbstwirksamkeit. Das ist eines der bekanntesten Konstrukte aus der Psychologie. Und diese Selbstwirksamkeit kann man vorbereiten, indem man demonstriert, welche Handlungen den Menschen offenstehen. Im Fall von Corona fällt mir zum Beispiel auf, dass kaum jemand im Fernsehen zeigt, wie man eine Maske richtig trägt. Sogar in Interviews der Tagesschau sieht man nach einem Jahr Pandemie noch Menschen, die ihre Maske irgendwie tragen. Das sind keine guten Handlungsbeispiele.
Gehört es denn zur Rolle der Wissenschaft, Handlungsanweisungen zu geben?
Das hängt natürlich mit dem wissenschaftstheoretischen Grundverständnis zusammen, das wir am Anfang schon besprochen hatten. Wenn man aus einer beobachtenden Tradition heraus agiert, wird man sich hüten Handlungstipps zu geben. In der Psychologie hingegen gehört es auch zur fachlichen Arbeit, Handlungspläne mitzugeben, Interventionen vorzuschlagen. Es können sich aber natürlich auch Wissenschaftler*innen aus anderen Fachrichtungen dafür entscheiden, handlungsorientiert zu kommunizieren. Dann würde ich aber zumindest erwarten, dass sie sich gut überlegen, wie sie das machen. Was man nicht machen kann, ist das Wissen einfach irgendwo abzuladen und sich dann darüber zu wundern, wie es aufgenommen wird. Aus psychologischer Sicht finde ich aber wichtig, das kommunizierte Wissen so lange zu begleiten, bis man sicher sein kann, dass es in sicheren Händen ist.
Sie haben in Ihrem Tweet auch den Wissenschaftspolitiker Karl Lauterbach und den Virologen Hendrik Streek erwähnt. Warum?
Die Tweets von Herrn Lauterbach sind sehr gut recherchiert. Da merkt man, dass unheimlich viel Mühe reingesteckt wird. Sie sind aber motivationspsychologisch bisweilen wenig durchdacht. Wenn er zum Beispiel Inhalte aus einer Long-Covid-Studie aus ihrem Kontext nimmt und auf Twitter kommuniziert, erzeugt das ein wahnsinnig hohes Gefühl von Bedrohung. Das sieht man dann auch in den Kommentaren dazu. Hier wäre mehr Kontext wichtig: Wie wurde erhoben, wie wurden Zahlen errechnet? Es macht einen großen Unterschied, ob es eine repräsentative Stichprobe war oder nur Menschen untersucht wurden, die einen schweren Verlauf hatten.
Herr Streek auf der anderen Seite hat oft noch einen beruhigenden Unterton in seiner Kommunikation und plädiert für weniger Angst. Auch das ist motivationspsychologisch gesehen nicht sinnvoll. Man sollte das Publikum in die Lage versetzen, selbst fundierte Handlungsentscheidungen zu treffen. Das geht aber nicht, wenn man nur einen Teil der Informationen hat. Diese Einzelinformationen können sich dann ganz schnell zu Halbwissen verselbstständigen, das sich hartnäckig hält. Zum Beispiel, dass Covid-19 nur so etwas wie eine Grippe sei.
Wenn man umfassend kommunizieren soll, kann man dann überhaupt Dienste wie Twitter dafür nutzen?
Es ist natürlich sehr schwierig. Die Frage ist aber eher: Kann man sich aus solchen sozialen Kanälen zurückziehen? Und da würde ich sagen: nein. Denn die Debatten auf diesen Kanälen laufen ja weiter und dann sollten sich auch Menschen mit Expertise daran beteiligen.