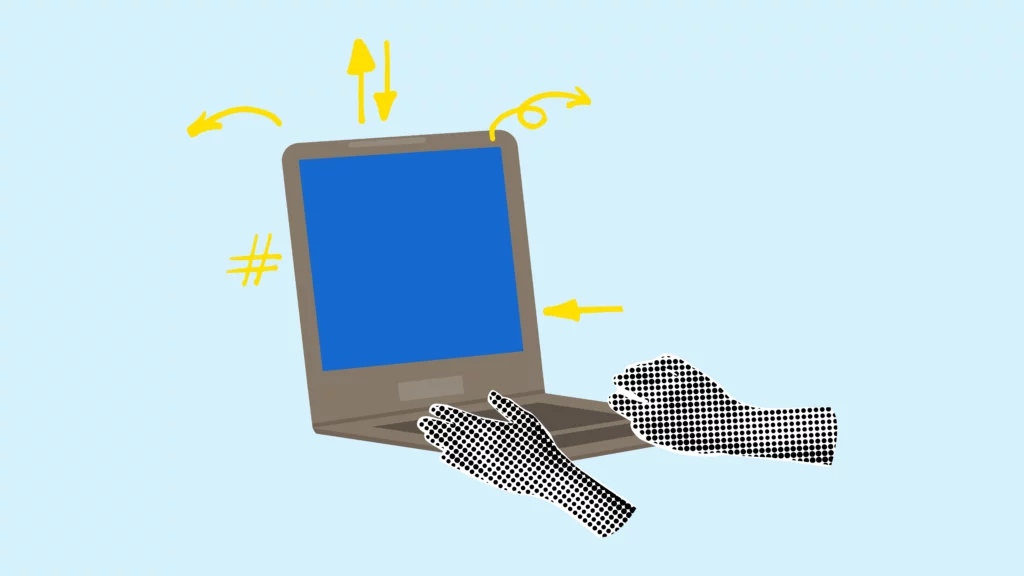Anfang des Monats wurde in Berlin das Futurium eröffnet – ein Museum und Veranstaltungsort, in dem über mögliche Zukünfte nachgedacht wird. Direktor Stefan Brandt erklärt das Konzept und die Ziele des neuen Hauses, das sich explizit nicht als Science-Center versteht.
„Technische Lösungen sind kein Selbstzweck“
Herr Brandt, was ist das Futurium?
Es ist ein Haus der Zukünfte. Ein Ort, an dem sich Menschen über Entwicklungen, Visionen und Utopien informieren, austauschen und sich ihnen sogar experimentell nähern können. Die Leitfrage lautet: Wie wollen wir leben? Wir können die Zukunft nicht vorhersagen, wir stellen unterschiedliche Optionen vor. Welche davon am Ende tatsächlich Teil unserer Zukunft werden sollen, ist Thema der gesellschaftlichen Debatte, für die das Futurium Denkanstöße liefern möchte. Wir tun das auf drei Ebenen: In der Ausstellung mit den drei Denkräumen Mensch, Natur und Technik; im Forum als Ort für spannende und hoffentlich auch kontroverse Diskurse und im Futurium Lab als Ort zum Mitmachen, Experimentieren und Ausprobieren.
Wieso braucht es das Futurium?
Wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Wir müssen unsere gestaltende Rolle auf dem Planeten verantwortlich und nachhaltig erfüllen – das gilt für Klimaschutz, für Ressourcenverbrauch und für den Umgang mit uns selber. Das löst Ängste aus, die wir auch ansprechen. Aber wir haben die Chance auf eine Mitgestaltung der Zukunft, was bis vor einigen Jahrzehnten noch nicht der Fall war, weil es noch nicht die demokratische Mitbestimmung gab wie heute.

Viele Leute haben Angst vor der Zukunft – vor Klimawandel, künstlicher Intelligenz, Gentechnik. Wie wollen Sie ihnen diese Angst nehmen?
Das kann und will ich gar nicht. Denn auch Ängste und Sorgen gehören zu einer ehrlichen Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen dazu. Ich möchte die Leute aber dafür sensibilisieren, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Künstliche Intelligenz kann hilfreich sein, zum Beispiel in der Krebsfrüherkennung. Sie hat aber auch Missbrauchspotenzial, in der Gesichtserkennung und der Selektierung von Menschen anhand ihres Verhaltens. Wir zeigen beide Seiten.
Am Tag der Eröffnung waren Schülerinnen und Schüler bei Ihnen zu Besuch. Viele aber demonstrierten wie jeden Freitag für ihre Zukunft, derer sie sich beraubt fühlen. Wie erreichen Sie die?
Mit unserer Politik des kostenfreien Eintritts wollen wir prinzipiell jeden erreichen. Die Vertreter von Fridays for Future und anderer Bewegungen laden wir ins Futurium zum Austausch ein. Viele unserer Veranstaltungen richten sich explizit an die junge Generation, zum Beispiel „Berlin am Meer“, wo Schülerinnen und Schüler sich mit Klimawandel und der Vermüllung der Ozeane befassen. Oder der „Climathon“, bei dem man im Rahmen eines Hackathons Ideen erarbeiten kann, um die Stadt klimaneutral zu machen.
Hat die Fridays-for-Future-Bewegung recht?
Sie haben mit ihrer Diagnose recht und sie haben es geschafft, eine wissenschaftliche Beleglage in breitenwirksame politische Forderungen umzusetzen. Nun müssen sich diese Forderungen dem Realitätstest stellen – ein normaler demokratischer Prozess.

Das Futurium wird finanziert vom Forschungsministerium, Wissenschaftsorganisationen und Vertretern der Wirtschaft. Sollen sie allein die Frage beantworten, wie wir leben wollen?
Ihre Frage impliziert, dass die Gesellschafter das Programm bestimmen. Dem ist nicht so, wir arbeiten inhaltlich eigenständig. Ich bin offen dafür, den Gesellschafterkreis zu erweitern, das würde die inhaltliche Ausrichtung des Hauses aber nicht ändern. Wir arbeiten natürlich intensiv mit unseren Gesellschaftern zusammen – sie bilden nicht zuletzt ein exzellentes Netzwerk, um beispielsweise interessante Gäste oder spannende Exponate ins Futurium zu holen.
Bei der Gestaltung könnten Sie doch auch andere Organisationen mit ins Boot holen.
Das tun wir, zum Beispiel kooperieren wir mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der Initiative Climate-KIC, dem Weizenbaum-Institut und Falling Walls. Wir laden Umweltschutzverbände ein und arbeiten mit vielen Kunstschaffenden zusammen. Unser vielfältiges Programm wäre ohne diese Kooperationen gar nicht möglich.
Die Gesellschafterstruktur legt dennoch den Verdacht nahe, dass man glaubt, für alles eine technische Lösung zu haben.
Technische Lösungen sind kein Selbstzweck; sie setzen sich nur durch, wenn sie das Leben der Menschen erleichtern. Wenn Sie durch die Ausstellung gehen, werden Sie feststellen, dass es oft gar nicht um Technik geht, beispielsweise im Denkraum Mensch. Hier stehen soziale Innovationen und unsere Werte im Mittelpunkt. Im Denkraum Technik werden technische Entwicklungen natürlich vorgestellt, aber auch explizit kritisch hinterfragt. Und im Denkraum Natur stellen wir auch die Frage, wie Natur und Technik versöhnt werden könnten.
Sie reden stets von Utopien. In der futuristischen Literatur und im Film überwiegen die Dystopien. Warum?
Sie entfalten eine größere Faszination, weil sie spannungsgeladener sind. Freilich ist der Übergang von der Utopie zur Dystopie fließend und hängt nicht zuletzt von der individuellen Perspektive ab. Wir haben in der Geschichte erlebt, wie gesellschaftliche Utopien zu realen Dystopien werden können – schauen Sie sich das Beispiel des Kommunismus an. Ich verstehe den Begriff Utopie nicht im krampfhaft positiven Sinn, sondern eher als Zukunftserzählung. Utopien sollte man nicht als Vorgaben missverstehen, sie können aber Orientierung bieten.
Wer hat die Utopien ausgewählt?
Ein Team von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat sich in Forschung, Kunst, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft umgeschaut. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben uns bei der Auswahl der Themen und Inhalte unterstützt. Wichtige Teile der Ausstellung stehen in Verbindung mit der Anthropozän-Debatte, die besagt, dass der Mensch mittlerweile zum maßgeblichen Einflussfaktor des Planeten geworden ist.
Haben Sie sich auch von der Science-Fiction inspirieren lassen?
Wir haben sie an einigen Stellen eingebaut, aber keinen expliziten Science-Fiction-Schwerpunkt. Wir haben uns eher von Kunstwerken aus diesem Kontext inspirieren lassen und sie zur Verbildlichung von Dingen genutzt, die es heute noch nicht gibt.
Ist das Futurium ein Science-Center?
Nein. Wir sind zwar ein Ort der Wissenschaftskommunikation, aber es geht nicht darum, Wissenschaft zu promoten. Wissenschaft und Forschung liefern die Grundlage für einen qualifizierten Diskurs über Zukünfte und spielen dementsprechend eine besondere Rolle. Aber auch Inputs aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel aus der Kunst oder aus der Zivilgesellschaft, sind wichtig.

Haben Sie sich bei Science-Centern dennoch etwas abgucken können?
Wir haben sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen in der Ausstellungsentwicklung, die natürlich wissen, wie Science-Center und Technikmuseen funktionieren und welche Stationen robust genug für die hoffentlich zahlreichen Gäste sind. Was wir mit Science-Centern gemeinsam haben, ist der experimentelle und interaktive Ansatz. Er folgt aber primär dem Gedanken: Wie wollen wir leben? Und nicht: Wie erschließe ich mir die Wissenschaft? Wir sehen uns deshalb nicht in Konkurrenz zu Science-Centern.
Die Idee zum Futurium entstand bereits 2010. Warum hat es so lange bis zur Eröffnung gedauert?
Viele Personen und Institutionen waren an der Gründung beteiligt. Ursprünglich war das Haus als Schaufenster für den Industrie- und Forschungsstandort Deutschland gedacht, mit der Zeit wandelte sich das Konzept zu einem breiteren Herangehen an Zukunft. Im Juni 2015 wurde der Grundstein gelegt, ich bin seit Sommer 2017 an Bord. Vier Jahre Bau- und Entwicklungsphase bis zur Eröffnung sind für ein so großes Haus eine eher kurze Zeit.
Sie sind studierter Musikwissenschaftler und waren zuvor Geschäftsführer der Hamburger Kunsthalle. Was hat sie an der neuen Aufgabe gereizt?
Das Futurium ist etwas ganz Neues, das es so in Deutschland, wahrscheinlich sogar in Europa, noch nicht gibt – und ich war immer schon neugierig. Vielleicht ist diese Tätigkeit an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft auch so etwas wie die Quintessenz aus den verschiedenen beruflichen Erfahrungen, die ich bislang machen durfte. Und hier im Futurium gibt es die Chance, mit unseren Inhalten über Zeit sogar gesellschaftswirksam zu werden.
Gibt es Parallelen zur Kunsthalle?
Vielleicht in der Herangehensweise an die Themen und in der Kommunikation mit dem Publikum. Damals in Hamburg haben wir versucht, die Kunsthalle für verschiedene Bevölkerungsschichten zu öffnen. Wir haben interdisziplinäre Formate entwickelt und auch für eine gewisse Zeit freien Eintritt gewährt. Mit Erfolg, wir hatten nach Abschluss der Modernisierung 200.000 Besucher – in einem Monat! Auch der Eintritt im Futurium wird für die ersten drei Jahre frei sein. Ich würde mir wünschen, das auch nach 2022 so beibehalten zu können.
200.000 Besucher jährlich peilen Sie an. Gibt es noch weitere Marker für den Erfolg?
Wir wollen Menschen erreichen, die noch nie zuvor ein Museum besucht haben oder mit der Wissenschaft Kontakt hatten. Wir wollen Debatten anstoßen, die eine gesellschaftliche Relevanz entfalten. Und wir haben Bildungsmaterialien für Schulen entwickelt – die Zukunftsboxen zu Themen wie „Zukunft der Stadt“ oder „Zukunft der Ernährung“ – und sind sehr gespannt, wie sie angenommen werden.
Die Zukunft ist veränderbar, so lautet Ihre Botschaft. Das bedeutet aber auch, dass Sie die Ausstellung ständig anpassen müssen. Wie oft soll das passieren?
Wir werden kontinuierlich Daten und Fakten aktualisieren. Aufwändiger wird es sein, ganz neue Themen einzubauen. Wir arbeiten gerade zum Beispiel an einer umfangreicheren Ergänzung zum Thema Mobilität.
Wie sieht die Zukunft des Futuriums aus?
Ich hoffe, dass es uns in den nächsten fünf Jahren gelingt, uns in Berlin und in Deutschland so zu etablieren, dass man beim Thema Zukunft automatisch an das Futurium denkt. Wir möchten gemeinsam mit Partnern ein interdisziplinäres Zukunftsfestival auf die Beine stellen. Wir wollen außerdem mobile Ableger bilden und gezielt in Nicht-Metropolregionen gehen. Und wir wollen uns international stärker vernetzen. An verschiedenen Orten weltweit entstehen derzeit Häuser wie unseres. Es ist also Zeit für Zukünfte!
Jens Lubbadeh berichtet in unserem Auftrag zu diesem Thema.