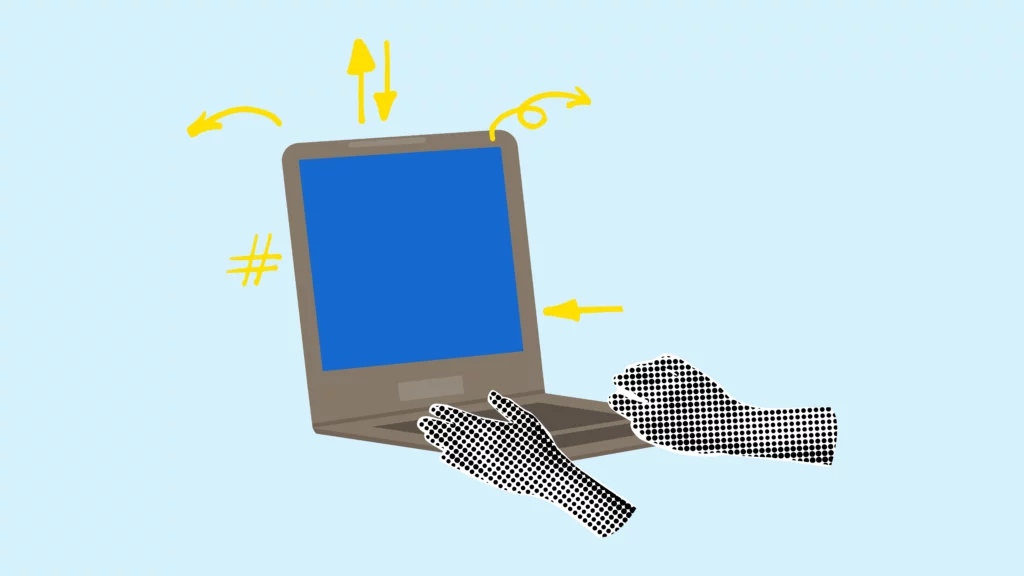Partizipative Prozesse haben selten die Beteiligungsquote, die sich deren Initiatoren vorstellen. Woran liegt das? Diese Frage beantwortet Oliver Kuklinski, der als Kommunikationsberater Beteiligungsprozesse für und mit Politik und Unternehmen entwickelt. Ein Gespräch über Nutzen, Sinn und Tücken der Partizipation.
Partizipation in der Wissenschaft – „Die Beteiligten müssen profitieren.“

Herr Kuklinski, was genau verbirgt sich alles hinter dem oft genutzten Begriff Partizipation?
Partizipation ist letztlich immer die Kommunikation von relevanten Akteuren miteinander, um Ziele zu erreichen. Dabei gibt es verschiedene Rollen: die der Initiatoren, der Betroffenen, der Interessierten, der Zuständigen, der Profiteure, der Opfer usw. Die Initiatoren entscheiden sich vielleicht bewusst Andere einzubeziehen oder die Anderen bekommen Wind von dem Vorhaben und positionieren sich dagegen oder dafür. Es braucht also immer einen Anlass, ein Vorhaben, eine Veränderungsabsicht und verschiedene Positionen. Nun können sich Initiatoren dazu entscheiden, andere Akteure einzubeziehen, um das Vorhaben zu optimieren, Akzeptanz zu erzeugen, Protesten vorzubeugen oder einfach nur, um gemocht zu werden (man trifft sich ja immer zweimal im Leben). Ein Beispiel: In Braunschweig sollte ein neues Maushaus, also ein Tierversuchszentrum, gebaut werden. In einer Veranstaltung am Haus der Wissenschaft wurde zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen, um anlässlich des Vorhabens das Pro und Kontra von Tierversuchen und des neuen Maushauses zu erörtern. Ziel war es, die Öffentlichkeit zu informieren, Argumente von Tierversuchsgegnern, Wissenschaftlern und Tierschützern offenzulegen und damit einen Beitrag zur Versachlichung der öffentlichen Diskussion zu leisten.
Ist denn die bloße Information schon eine Form der Partizipation?
Ja, denn Teilhabe ist erst möglich, wenn Informationen fließen: ‚Wir haben da etwas vor, wir wollen dies und das tun, um dieses und jenes zu erreichen.‘ Diese Form von basaler Transparenz ist in vielen Zusammenhängen oft schon ein Durchbruch. Allein, dass sich die Initiatoren überlegen, ob sie die Kommunikation mit der Öffentlichkeit aufnehmen, kann einen Kulturwandel in Gang setzen. Schließlich kann die Reaktion auf die ersten Informationen auch Hinweise darauf geben, welche Chancen weitere Partizipationsstufen bieten können, die da sind: Konsultation, Kooperation und Koproduktion (Definition von Klaus Selle, Professor für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen). Partizipativ wird es also dann, wenn ein Prozess die Rolle derjenigen, die er einbezieht, verändert. Die Beteiligten erhalten nicht nur Wissen über das Anliegen, sondern überprüfen ihre Einstellung dazu und setzen sich vielleicht sogar dafür ein, dass dieses Anliegen gelingt. Das heißt aber nicht, dass nachher alle das Projekt gut finden.
Ich kann mir als Projektträger auch selbst überlegen, was sich die Leute zu meinem Projekt so denken könnten und versuchen, es ihnen Recht zu machen oder mich gegen sie zu wappnen. Besser und auch Wirksamer ist es aber, sie direkt zu fragen. Wenn diese Leute dann, wie beim Maushaus, mit Medizinern, Ethikern und Tierschutzverbänden sprechen, besteht die Chance, dass sich allen Beteiligten noch ganz andere Perspektiven eröffnen.
Was können partizipative Prozesse konkret für die Wissenschaft leisten?
Diese Frage lässt sich schön mit einem Beispiel veranschaulichen: Eine Gruppe Wissenschaftler hat sich gefragt, welche Leitungen zum Transport von Energie am besten geeignet sind – Freileitungen oder unterirdische Leitungen– und wo sie verlaufen sollten. Um das zu beantworten, haben sie Böden untersucht, Bauaufwand kalkuliert, Kosten-Nutzen-Abwägungen vorgenommen. In einem Beteiligungsprozess haben die Anwohner aber ganz andere Fragen gestellt und ihre Ängste und Sorgen thematisiert: Sterben Vögel durch die Leitungen? Wird das Landschaftsbild zerstört? Gehen von unterirdischen Leitungen elektromagnetische Felder aus, die auch bis in mein Haus reichen? Was richten sie an? Messungen zu elektromagnetischen Feldern hatten die Wissenschaftler zwar gemacht, die waren aber auf technische Standards und Normen fokussiert. Der Beteiligungsprozess hat ihnen dann klar gemacht, dass es nicht egal ist, ob eine Leitung unter einem Acker oder einer Siedlung hindurchführt. Ihre Forschungsergebnisse und die darauf basierende Trassenführung haben einen direkten Einfluss auf die Anwohner.
Zum einen hatten die Wissenschaftler also durch den Beteiligungsprozess die Gelegenheit, ihre Ergebnisse zu erklären. Nur so können sie Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufbauen. Sie haben daraus aber auch ganz neue Perspektiven und neue Forschungsfragen mitgenommen. Und darum geht es eben auch: Dass die Schlauen verstehen, dass sie eben doch nicht so schlau sind. Die Theorie ist ja, dass es in der Wissenschaft viele neue Erkenntnisse gibt, die dann den Bürgern oder der Politik erklärt werden müssen. Bei Partizipationsprojekten erfahren wir aber immer wieder, dass andersherum die Wissenschaftler hier viel neuen Input bekommen und die Lernenden sind.
Partizipation heißt also, beide Seiten sollen aus dem Prozess etwas mitnehmen können?
Ja, die Erfahrung haben wir beispielsweise beim Projekt Klima-Werkstatt in Göttingen gemacht. Menschen konnten sich im Rahmen der Initiative Zukunftsstadt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit ihren eigenen Projekten zur CO2-Reduktion anmelden. Wir haben dann Wissenschaftler gesucht, die sie dazu beraten sollten. Es stellte sich aber heraus, dass die Beteiligten in Bezug auf das Wissen und Know-how zu ihrem Projekt sehr gut ausgestattet waren. Statt inhaltlicher Expertise mussten und wollten sie eher lernen, wie sie ein Projekt managen und das gescheit kommunizieren. Für die Wissenschaftler war es interessant zu sehen, auf welch hohem Niveau sich die Menschen mit ihrem Thema beschäftigen. Sie haben angefangen zu überlegen, wie ihre Forschung aussehen muss, damit die Ergebnisse der Projekte noch mehr Relevanz bekommen. Das war für uns alle eine wichtige Erkenntnis. Partizipation kann also eine große Wissensquelle für die Forschung sein. Viele Wissenschaftler drücken sich aber davor, einen gesellschaftlichen Bezug zu ihrer Forschung zu sehen und die Übersetzung komplexer Sachverhalte in allgemein verständliche Sprache leistet leider auch keinen Beitrag für die Reputation im jeweiligen Fach. Aber auch Bürger haben nicht immer Lust, die Rolle wissenschaftlicher Objekte zu spielen, sie wollen mitbestimmen und etwas mitnehmen, sie wollen Selbstwirksamkeit erfahren.
Wer wird denn überhaupt mit partizipativen Formaten erreicht?
Das kommt darauf an, um was es geht und wie wir kommunizieren bzw. wie wir unsere Zielgruppe angehen. Das ist wie mit den Fliesen im Badezimmer: Wenn man Mieter fragt, ob sie mitbestimmen möchten, welche Farbe die Fliesen haben sollen, wollen das 80 %. Beim Streichen des Treppenhauses beteiligen sich noch 60 %, bei der Fassade noch 40 % und wenn man das weiterführt bis zu komplexen wissenschaftlichen Fragen jenseits des Alltags ist die Quote verschwindend gering. Politische Akteure sagen dann manchmal, dass die Leute doch froh sein sollen, wenn sie beteiligt werden. Aber es ist eigentlich andersherum. Die Institutionen sollten froh sein, wenn die Bürger sich beteiligen, ihre Perspektiven, ihr Alltags- und Spezialwissen und ihre frische Sicht auf die Dinge – meist kostenlos – einbringen. Und da kommt es vor allem auf gute Öffentlichkeitsarbeit an. Es muss Anreize geben. Wenn man im Fahrgastbeirat der Bahn mitmacht, bekommt man vielleicht eine Bahncard 100. Die Leute erbringen im Rahmen der Partizipation eine Leistung und das ist den Initiatoren nicht immer so bewusst. Ich kann nicht damit rechnen, dass mir Leute für mein eigenes Thema die Bude einrennen, erst recht nicht, wenn ich eine bestimmte Gruppe beteiligen möchte.
Was kann man tun, damit ein partizipativer Prozess erfolgreich wird?
Hier geht es vor allem um die Gestaltung der Prozesse. Wenn ich jemanden berate, der bei seinem Projekt auch Bürger einbeziehen möchte, frage ich zunächst nach seinen Zielen und den Zielgruppen. Dann suchen wir uns Repräsentanten aus diesen Zielgruppen und überlegen mit ihnen gemeinsam, was das Projekt ihnen bringen kann. Welche Anreize können wir bieten, damit sie Lust haben sich einzubringen? Reicht es, wenn ich sie einmal beteilige, oder muss ich sie wiederholt erreichen? Nicht zu vergessen die Ressourcenplanung für das Projekt in Bezug auf alle relevanten Dimensionen wie etwa Manpower, Zeit, Geld, Know-how. Also hier gilt, gute Planung und die Einbeziehung der relevanten Akteure – schon im Prozessdesign – machen Partizipationsprozesse erfolgreich. Ich reagiere übrigens allergisch auf Sätze wie ‚Leute ins Boot holen‘ oder ‚Die Menschen mitnehmen‘. Das bedeutet meist, dass das Projekt eigentlich schon fertig und eher Marketing als Partizipation gefragt ist. Und, wer möchte sich schon gern ‚mitgenommen‘ fühlen?
Wollen wir erfolgreich beteiligen, müssen wir die Motive der Schlüsselakteure beachten und ihnen die Gelegenheit geben, ihre Selbstwirksamkeit zu erfahren. Es gab Zeiten, da wurde ein Bürgerforum zur Quartiersentwicklung veranstaltet und dann ein DVD-Player verlost, damit möglichst viele kommen. So wurden die erreicht, die noch keinen DVD-Player hatten aber nicht diejenigen, die sich beteiligen wollten. Formate, bei denen man etwa mit Fragen von Tür zu Tür geht, vielleicht sogar in Fremdsprachen kommuniziert, um Erkenntnisse zu gewinnen, sind viel intensiver, kosten aber auch viel mehr. Und das Know-how, um diese Formate durchzuführen, kann ich zum Beispiel von Wissenschaftlern gar nicht verlangen. Es reicht nicht, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter aus dem betreffenden Fach einzustellen, der dann eine Veranstaltung organisiert. So werden oft Tagungsformate kopiert, die man schon mal irgendwo gesehen hat, mit Postersessions und Open Spaces. Das sind aber vielleicht gar nicht die optimalen Formate, um die gewünschten Erkenntnisse zu gewinnen.
Ist das ein Plädoyer dafür, eher vorsichtig mit partizipativen Formaten umzugehen?
Das ist ein Plädoyer dafür, eine Partizipations-Fachexpertise einzubeziehen; sich bewusst zu machen, dass Kommunikation, Partizipation und Veranstaltungen nicht etwas sind, das man mal eben so nebenher macht. Jeder hält viel auf seine Ausbildung, aber wenn es zu Kommunikationsprozessen kommt, muten sich Wissenschaftler oft Dinge zu, die sie noch nie gemacht haben. Sich an der richtigen Stelle Expertise dazuzuholen ist eine kluge Entscheidung. Das Design von Kommunikations- und Partizipationsprozessen ist eine eigene Profession, diese gilt es anzuerkennen und zu nutzen. Wissenschaftler können ihr Fachgebiet, spezialisierte Kommunikations-Prozessdesigner können Partizipationsprozesse. Beide zusammen können Partizipation in der Wissenschaft.