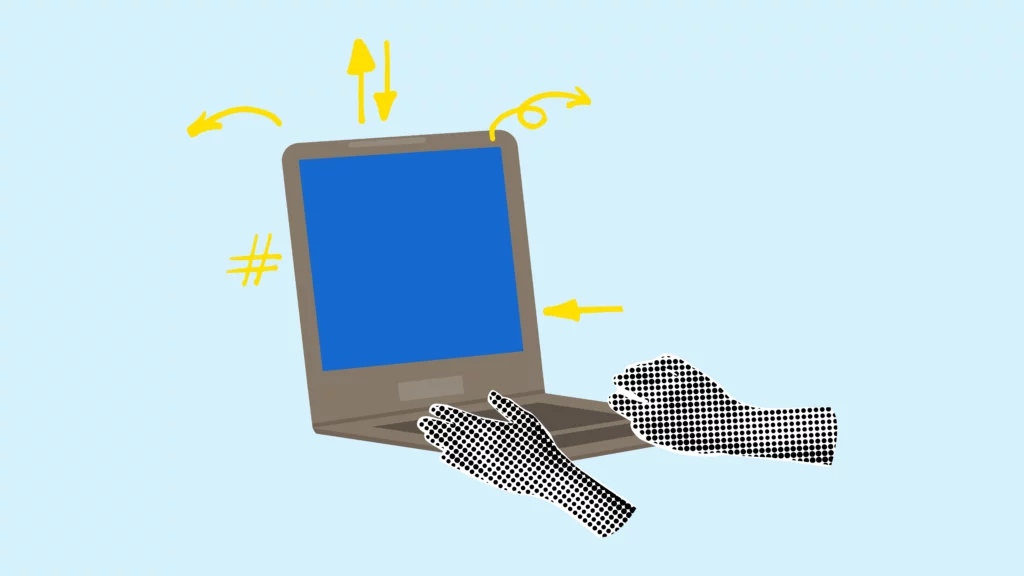Viele wertvolle Inhalte. In der WÖM-2-Stellungnahme stecken jedoch zu viele Regularien, anstelle von mehr konstruktiver Förderung aller zentralen Akteure und Möglichkeiten der Wissenschaftskommunikation – meint Beatrice Lugger in ihrem Kommentar.
Großakkord mit Dissonanzen
Es ist der zweite Großakkord zu Wissenschaft, Öffentlichkeit und Medien (WÖM), und wieder klingt er an vielen Stellen dissonant. Dabei steckt viel Gutes in dieser ergänzenden Stellungnahme „Social Media und digitale Wissenschaftskommunikation“ der Akademien zum ersten WÖM-Bericht des heißen Wissenschaftskommunikations-Sommers 2014. Nicht, dass ein harmonisch wohlgefälliges Stück zu erwarten gewesen wäre. Geht es doch um Empfehlungen in Zeiten eines massiven Medienumbruchs mit seinen gesellschaftspolitischen Auswirkungen auf Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Nur wirken viele Empfehlungen sehr rückwärtsgewandt, wie ein wütendes Staccato.
Die Stellungnahme zielt grundsätzlich und sehr positiv darauf ab, Wissenschaftskommunikation in Deutschland zu stärken und dies mit allen zentralen Akteuren – den Kommunikatoren, den Wissenschaftlern und den Journalisten.
Dabei ist jedoch manches in Schieflage geraten. Eigenartig zentralistisch und selektiv wirkt etwa die Idee, eine redaktionell unabhängige (sic!) bundesweite Wissenschafts- und Informationsplattform aufzubauen, die in der (Fehl-)Informationsflut wie ein Fels in der Brandung die einzig wahre Wahrheit vermitteln soll. Die Redaktion dieser Plattform solle unter der Ägide eines zentralen Herausgebergremiums ihre Arbeit verrichten. Das widerspricht der Idee von Pluralität in Gesellschaft, Politik und nicht zuletzt im Journalismus (siehe auch Kommentare von Markus Weißkopf und Annette Leßmöllmann).
Zugleich solle ausgewählter Wissenschaftsjournalismus nach dem Modell der Forschungsförderung Finanzspritzen erhalten. Immerhin merkten die Autoren, dass das durchaus „aus demokratietheoretischen Überlegungen problematisch“ ist und zimmerten dazu ein noch gewagteres Konstrukt: Mittel von Rundfunkbeiträgen sollen in Stiftungen fließen, die wiederum die Gelder vergeben sollen.
Beim Lesen des gesamten Papiers drängt sich der Gedanke auf, dass die Autoren am liebsten zurück in die 1990er mit ihrer schön geordneten Medienwelt wollen. Die Gegenwart und damit das, worum es in dieser Stellungnahme gehen soll – Social Media und digitale Wissenschaftskommunikation –, solle vor allem reguliert und ausgebremst werden. Die Social Media hätten, so tönt es, mit falschen „euphorischen“ Verheißungen von offenen gesellschaftlichen Dialogen die Menschen angelockt und zeigten nun ihre böse Fratze in Form von Hasskommentaren und anderen „dysfunktionalen Kommunikationsformen“. Außerdem habe das Digitale „zu einer scharfen Aufmerksamkeitskonkurrenz“ insbesondere zwischen klassischen journalistischen Medien und Social Media geführt.
Ja, hat es. Das ist ein normaler Vorgang, wenn neue Medien die Welt erobern. Nur haben viele etablierte Journalisten und Medien (ob TV, Hörfunk oder Print) in Deutschland diesen Wandel lange nicht wahrhaben wollen. Sie haben sich dem Internet und sozialen Netzwerken zu oft gezielt verweigert. Noch heute gibt es in den meisten Redaktionen eine Zweiklassengesellschaft zwischen klassischem Journalismus und der Online-Redaktion – dies drückt sich auch monetär aus. Und in einer gefühlten Klasse noch unter den Online-Redakteuren kommen diejenigen, die sich in den Medienhäusern um die Social Media kümmern. Immer noch rühmen sich einzelne Wissenschaftsjournalisten, die Finger von Twitter, Facebook & Co. zu lassen. Wenn Journalisten sich aber weigern, dorthin zu gehen, wo weite Teile der Gesellschaft sich informieren, dann stimmt innerhalb dieser Mediensysteme etwas nicht.
Es ist wichtig, dass alle Akteure, die diese Stellungnahme einbezieht, die digitalen Medien und den anhaltenden Medienwandel ernst nehmen – und dass sie dort ihre Stimmen erheben. Ja, wir haben es mit Fake-News, Filterblasen, Chat-Bots und unbekannten Algorithmen zu tun. Ja, es gibt jenseits von Qualitätsjournalismus und oft hervorragender Kommunikation von Forschungsgemeinschaften und Hochschulen Parallel- und Gegenströmungen im Netz, die mit falschen „Fakten“ wirre Behauptungen aufstellen und ihre jeweilige Anhängerschaft finden – Beispiel Chemtrails.
Gestützt werden solche Falschaussagen zudem nicht selten von unseriösen Publikationen – auch im Open Access-Bereich, den ich grundsätzlich begrüße –, in denen jedermann fachlichen Unsinn publizieren kann. Hierauf geht die Stellungnahme nicht näher ein. Das ist aber ein ernsthaftes Problem, weil Fake-Wissen dort hochprofessionell aufbereitet und untermauert wird. Die falschen Nachrichten finden ihre Empfänger, zumal in den Echokammern für Gleichgesinnte.
Zudem bestätigen in einem aktuellen Nature Human Behaviour Artikel „Limited individual attention and online virality of low-quality information“ Diego Fregolente Mendes de Oliveira und Kollegen von der Indiana University Bloomington in den USA, dass die inhaltliche Qualität einer Information nicht entscheidend dafür ist, was viral geht und was nicht. In dieser laut rauschenden Flut drohen die fast schon stummen Wahrheiten zu unterzugehen.
Deshalb ist es wichtig, dass Wissenschaftler, Wissenschaftskommunikatoren und Wissenschaftsjournalisten Online mitreden, Falschaussagen kommentieren, beständig dagegenhalten, Stellung beziehen.
Dies greift die hier vorliegende Stellungnahme auf – wenn auch etwas unter der Hand. Es finden sich darin ein „Ja“ zum Dialog und ein „Ja“ zur Transparenz. Denn heute geht es um mehr als Wissensvermittlung. Es geht um transparente Kommunikation. Die Autoren ermuntern dazu: „Wissenschaftler sollten, in Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, ihre Expertise in öffentlichen und politischen Debatten zur Verfügung stellen.“ Und: „Mit Social Media ergeben sich Möglichkeiten, bestimmte soziale Gruppen gezielt anzusprechen. Es entstehen neue Formate, was sich positiv auf die Formenvielfalt der etablierten Medien auswirken kann.“
Damit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für derartige Debatten – auch in den klassischen Medien – gewappnet sind, empfehlen die Autoren Medientrainings. Dies ist meiner Meinung nach von essenzieller Bedeutung und könnte so manches, was in der Stellungnahme in weiteren Empfehlungen mahnend angefügt wird, obsolet machen. Denn in guten Medientrainings für Wissenschaftler insbesondere im Bereich Social Media erfahren die Forschenden natürlich auch etwas von der gegenwärtigen Social-Media-Rechtsprechung, vom Zeitmanagement, von Netiquette, effektivem Netzwerken, von der Verpflichtung zur „redlichen Darstellung von Forschungsergebnissen“ und mehr.
Genau diese Themen sind wichtige Diskussionspunkte, die nicht zuletzt häufig die Wissenschaftler selbst in Medienseminare einbringen. Die Akademien können also durchaus auf Verantwortungsbewusstsein von Forschenden bauen. Das scheinen sie kaum zu tun, denn die Autoren heben an sehr vielen Stellen dieses Papiers mahnend und warnend die Hand. Sie fürchten, Wissenschaftler und Wissenschaftsorganisationen könnten im Konkurrenzkampf um öffentliche Mittel primär “Werbung in eigener Sache machen“ und nur um der Aufmerksamkeit willen kommunizieren. Sie fürchten, dass sich „die Kommunikation aus der Wissenschaft dem Diktat einer höheren Geschwindigkeit und Emotionalisierung bis hin zu einer aus Social Media antizipierten sozialen Erwünschtheit unterwirft.“ Sie fürchten „ein Übergreifen der Medienlogik auf die Kernaufgaben von Forschung und Lehre – beispielsweise durch die Fehlallokation von Mitteln“.
Mehrheitlich werden also in diesem Papier mögliche Gefahren ausgemacht und Empfehlungen dafür gegeben, wie diese eingedämmt werden könnten – etwa durch einen Verhaltenskodex. Eine Netiquette beispielsweise macht meiner Meinung nach für Hochschulen und Forschungsinstitute in der Tat Sinn, wenn sie nicht ausschließlich dazu dient, Kommunikationsregeln in Form von Verboten aufzustellen. Eine Netiquette kann in der Tat helfen, die internen Kommunikationsprozesse zwischen Kommunikatoren und Wissenschaftlern zu optimieren, Synergien zu schaffen, und damit auch Wissenschaftler zu motivieren, Dialoge mit der jeweiligen Öffentlichkeit zu wagen. Aber brauchen wir wirklich so viele Regeln? Müssen wir wirklich so viel Angst haben?
Ich denke, wir brauchen zunächst eine bessere Anwendung geltenden Rechts und nicht irgendwelche zentralen Gremien und neue Regularien. Es gibt gut durchdachte Regelwerke für Kommunikation (Pressekodex des Deutschen Presserats, Leitlinien zur guten Wissenschafts-PR etc.) Darin finden sich grundständige Dinge wie die Forderungen nach Wahrhaftigkeit und der Achtung der Menschenwürde. Und aus diesen entwickeln sich Leitwerte wie etwa die Offenlegung von Eigeninteressen.
Ich denke, wir brauchen ein besseres Verständnis, wie algorithmische Prozesse und Gesellschaft einander beeinflussen. Ein guter Ansatz ist ein aktuelles Arbeitspapier zur Digitalen Öffentlichkeit der Bertelsmann Stiftung. Es macht Ansatzpunkte aus, um die Auswirkungen des Strukturwandels der Gesellschaft in Einklang mit den Leitwerten der Öffentlichkeit zu bringen.
Regeln sind wichtig. Aber speziell für die Wissenschaftskommunikation brauchen wir heute in ganz besonderer Weise die Unterstützung von und die Aufforderung zur Kommunikation. Wenn das Vertrauen in die Wissenschaft sinkt, so braucht es offenbar mehr Transparenz, Authentizität und Dialog. Dazu äußern sich die Autoren meines Erachtens zu wenig, trotz aller Möglichkeiten der digitalen und speziell Sozialen Medien vom Zweigesang bis zum vielschichtig orchestralen Klangbild.
Weitere Beiträge zu WÖM2 auf dieser Plattform:
- „Weniger Kanalarbeiten, mehr Kreativität!“ von Annette Leßmöllmann
- „Guter alter Journalismus oder PR über Social Media – ist das hier die Frage?“ von Markus Weißkopf
- „Die Arbeitsgruppe hat zwar viel zu „Media“ geschrieben, aber den Teil mit „Social“ vergessen“ von Lars Fischer
- „Ein Denkanstoß für eine weitergehende fruchtbare Diskussion“ von Martin Schneider
- „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, nutzt soziale Medien!“ von Mareike König
- „Ein kontroverses Thema darf auch kontrovers diskutiert werden“ von Ulrich Marsch und Julia Wandt
- „Worin liegen die Spezifika von Wissenschaftskommunikation in sozialen Medien?“ von Julia Metag
- Rückblick der Redaktion
WÖM:
- Teil 1: Zur Gestaltung der Kommunikation zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und den Medien
- Teil 2: Social Media und digitale Wissenschaftskommunikation (PDF)
Weitere Beiträge zu WÖM2 stellte Marcus Anhäuser in einer Linkliste auf seinem Blog zusammen.