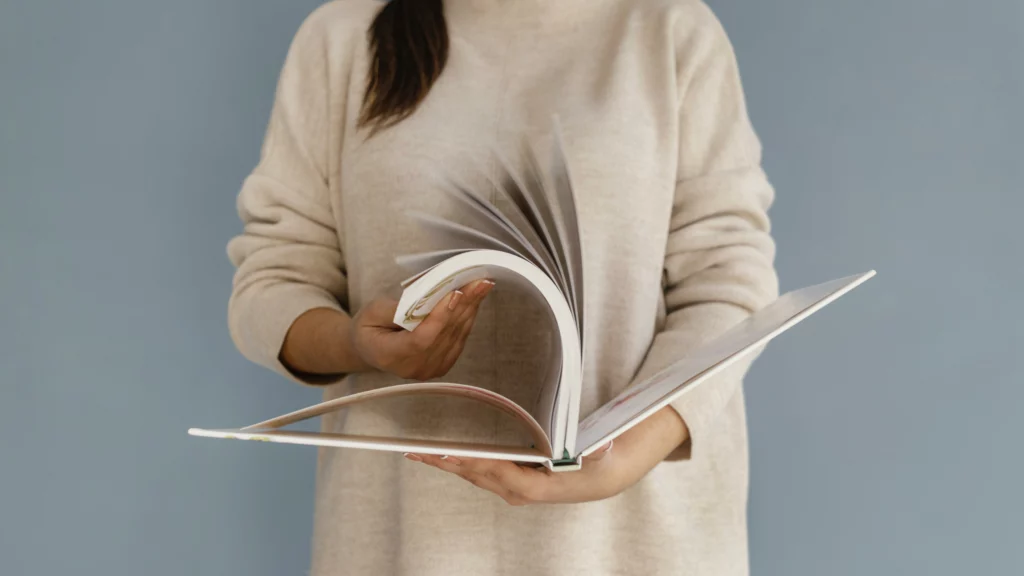Ein politischer Skandal brachte Verena Mischitz zum Journalismus. Heute arbeitet sie als Wissenschaftsjournalistin mit Fokus auf Klima und Gesellschaft – am liebsten im Videoformat. Warum sie gerade bewegte Bilder für besonders wirkungsvoll hält, erzählt sie im Jobprofil.
Im Profil: Verena Mischitz
Karriereleiter, Karrieresprungbrett oder Karrierekarussell – Wie war Ihr Weg in die Wissenschaftskommunikation/den Wissenschaftsjournalismus?
Ich habe Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Den Gedanken, im Journalismus zu arbeiten, hatte ich schon länger. Nach dem sogenannten „Ibiza-Skandal“, bei dem der damalige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der Nationalratsabgeordnete Johann Gudenus in einem heimlich aufgenommenen Video ihre Bereitschaft zur Korruption offenbarten, war für mich endgültig klar: Ich will in den Journalismus. Ich möchte Teil der Aufklärung sein und erklären, was warum wie falsch läuft. Also hatte ich mich für Praktika beworben. Lange hat das nicht geklappt, ich kannte niemanden in der österreichischen Medienbranche – zig Bewerbungen, kaum Rückmeldungen.
Dann hatte ich doch die Möglichkeit vier Monate beim ORF 1 zu arbeiten und im Anschluss das Videoteam der Tageszeitung Der Standard mitaufzubauen. Als Redakteurin und Moderatorin habe ich Erklärvideos zu unterschiedlichen Themen produziert. Das hatte zuerst nichts speziell mit Wissenschaftsjournalismus zu tun. Unsere Aufgabe war es lediglich: Das, was gerade passiert und relevant ist, für ein junges Publikum einfach und unterhaltsam aufzubereiten. Ich habe schnell gemerkt: Gute Erklärvideos funktionieren nur auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. So bin ich in den Wissenschaftsjournalismus gerutscht – und dabei geblieben, heute vor allem mit dem Fokus auf Klima und Gesellschaft.
In Österreich gibt es allerdings bis heute kaum Formate, die Wissenschaft und Video kombinieren. Eine Anstellung war nach drei Jahren Redaktionsalltag für mich nicht denkbar. Deshalb arbeite ich heute als freie Journalistin von Wien aus vor allem für deutsche Sender, wie WDR Quarks und Arte. Die Herausforderung bleibt aber länderübergreifend ähnlich: Klimaexpertise ist gefragt, Geschichten über planetare Krisen unterzubringen, nicht immer einfach.
Was sind die größten Herausforderungen in Ihrem Job und warum lohnt es sich trotzdem jeden Tag?
Die größte Herausforderung ist auch das, was mir am meisten Spaß macht: Komplexe Sachverhalte so zu übersetzen, dass jede Person die Chance hat, zu verstehen, worum es geht, warum das relevant ist, und was das mit der Art und Weise zu tun hat, wie wir unser Zusammenleben organisieren.
Zum Beispiel: Warum sollte es mich interessieren, dass das Eis in der Arktis schmilzt? Die Zusammenhänge sind nicht immer gleich erkennbar oder eindeutig. Also überlege ich mir, wie sich persönliche Bezüge herstellen lassen. Für ein Video zur Eisschmelze in Grönland ließen wir im Studio Eiswürfel in einem Cocktail schmelzen. Der Cocktail wurde dadurch verwässert und stand als Bild für ein „ungenießbares“ Leben, das durch den fortschreitenden Klimawandel droht.
Ich verbringe viel Zeit mit Storytelling und versuche komplexe Fakten in eine Geschichte zu verweben, mit der alle etwas anfangen können. Das ist nicht immer einfach – aber es ist sicher der aufregendste Teil meiner Arbeit.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Wissenschaftskommunikation?
Ich wünsche mir, dass die Wissenschaftskommunikation weiterhin mehr Raum bekommt, und dass vonseiten der Universitäten aber auch im Journalismus der Anspruch da ist, nicht nur Fakten verständlich zu kommunizieren, sondern sie auch so zu übersetzen, damit alle etwas damit anfangen können.
Vor allem sehe ich Potenzial, Themen verschränkt zu kommunizieren. Die Klimakrise wird beispielsweise nach wie vor oft als naturwissenschaftliches Phänomen und weniger als soziale Krise verstanden. Mit guter Wissenschaftskommunikation haben wir die Möglichkeit zu zeigen, wie sich unser Handeln, wie wir arbeiten und wirtschaften, auf den Zustand des Planeten auswirkt und was das wiederum für unser Zusammenleben bedeutet.
Besonders der Videojournalismus fasziniert mich, weil…?
Das Schöne am Format Video ist: Es ist zugänglich, abwechslungsreich und baut Barrieren ab. Ich muss mich als Zuseherin nicht anstrengen, kann mich entspannt zurücklehnen und mir ein Thema einfach mal erklären lassen.
Video verwischt die Grenze zwischen Wissenschaft und Unterhaltung. Wenn es richtig gemacht ist, ist das eine wunderbare Sache, weil es möglich wird, komplexe Zusammenhänge zu zeigen und gleichzeitig das Publikum für das, was gerade besprochen wird, zu begeistern.

Verena Mischitz lebt in Wien und arbeitet als freie Journalistin, Filmemacherin und Moderatorin u.a. für den WDR und Arte. Für ihre Videos zur Klima- und Biodiversitätskrise wurde sie mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Georg von Holtzbrinck Preis und dem österreichischen Umweltjournalismuspreis. Sie lehrt am Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation der Universität Innsbruck. Seit 2021 ist sie Sprecherin des Netzwerk Klimajournalismus Österreich. Mischitz studierte Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft in Wien und Liège.