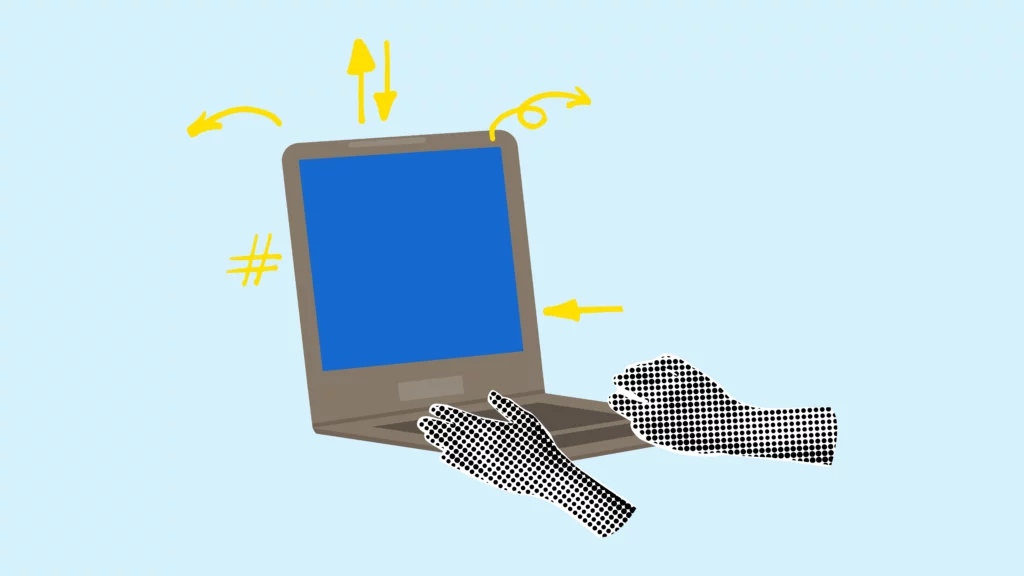Von Early Career Researchers wird häufig verlangt, ihre Forschung zu kommunizieren. Was sie zur Wissenschaftskommunikation motiviert und welchen Hindernissen sie dabei gegenüberstehen, hat Dominik Adrian in einer empirischen Studie untersucht. Ein Gespräch über die Ergebnisse und mögliche Konsequenzen.
„Zwang ist nie gut, weil er die intrinsische Motivation killt“
Sie haben etwa 7.000 Promovierende und promovierte Wissenschaftler*innen nach ihren Erfahrungen mit Wissenschaftskommunikation befragt. Was bewegt Early Career Researchers dazu, Wissenschaft nach außen zu kommunizieren?

Im Wesentlichen sind es idealistische Beweggründe. Spaß und das Wecken von Interesse sind sehr häufig genannte Motive. Auch extrinsische, aber dennoch idealistische Motive, wie das Gefühl, eine Informationspflicht gegenüber der Gesellschaft zu haben, sind für viele entscheidend. Diese Motive, die keinen harten, klar definierbaren Vorteil für die kommunizierenden Forschenden bringen, rangieren ganz hoch bei den Zustimmungswerten. Auf der anderen Seite der Skala sind Gründe, die mit einem äußeren Druck einhergehen, beispielsweise dass der Arbeitgeber es verlangt, zu kommunizieren, oder die Personen sich Wettbewerbsvorteile davon versprechen. Das ist selten die Motivation, sich in der Wissenschaftskommunikation zu engagieren.
Gibt es Unterschiede in der Motivation bei Early Career Researchers unterschiedlicher Fachbereiche?
Bei den Motiven unterscheiden sich die Fächergruppen eher geringfügig. Der Wunsch, zu evidenzbasierten Entscheidungen in Politik oder Wirtschaft beizutragen, ist beispielsweise in den Rechts- und Sozialwissenschaften etwas stärker ausgeprägt als bei anderen Fächergruppen. In der Mathematik und den Naturwissenschaften sind hingegen die Motive stärker gewichtet, den Nachwuchs zu fördern und Interesse bei anderen Menschen zu wecken. Doch das sind eher Nuancen.
Ihre Studie konzentriert sich auf Early Career Researcher. Wie genau ist diese Gruppe definiert?
Als Early Career Researchers gehören für meine Arbeit analog zu dem vierstufigen „Framework for Research Careers“ der Europäischen Kommission, das auch im Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (BuWiN) verwendet wird, sowohl Promovierende als auch Postdocs. Ich verwende den englischen Begriff Early Career Researchers, der sich in meiner Wahrnehmung zunehmend auch im deutschsprachigen Raum durchsetzt. Denn die Bezeichnung „wissenschaftlicher Nachwuchs“ steht zu Recht in der Kritik. Es ist nachvollziehbar, dass Menschen, die promoviert sind und im Berufsleben stehen, nicht ständig in diese Kategorie von nicht ganz fertigen, etwas infantilen Nachwuchswissenschaftler*innen gesteckt werden wollen. Außerdem gehen sehr viele nach ihrer Promotion in die Wirtschaft oder in den privaten Sektor. Somit sind nicht alle Promovierenden automatisch Aspirant*innen auf Stellen des akademischen Betriebs, was der „Nachwuchs“-Begriff ja nahelegt. Deshalb finde ich den englischen Begriff treffender.
Was war die Motivation für Ihre Studie?
Zum ersten Mal bin ich 2017 auf dem Forum Wissenschaftskommunikation mit dem Thema in Berührung gekommen. Damals stellte Carsten Könneker, heute Geschäftsführer der Klaus Tschira Stiftung, eine interessante Studie vor. Könneker und zwei Kollegen am KIT hatten hierfür fast 1.000 Teilnehmer*innen der Lindauer Nobelpreisträgertagung zu ihren Motiven und Formaten der Wissenschaftskommunikation befragt1. Während auf der Tagung zahlreiche Promovierende und Postdocs waren, die bloggten, Videos machten und andere innovative Formate vorstellten, zeichnete die Studie ein ganz anderes Bild: Die deutschen Early Career Researchers zeigten sich im internationalen Vergleich sehr zurückhaltend in ihrer Wissenschaftskommunikation, insbesondere bei der Verwendung digitaler Medien. Ich hatte die Idee, dass wir uns das auch einmal anschauen sollten. Denn damals bauten wir gerade die National Academic Panel Study (Nacaps) auf, eine Studie, die Karriereverläufe von Promovierenden und Promovierten untersucht. Für meine Masterarbeit – ich habe berufsbegleitend Wissenschaftsmanagement mit Schwerpunkt Marketing studiert – habe ich dann schließlich die Gelegenheit genutzt und in einen unserer Surveys ein Modul zum Thema Wissenschaftskommunikation integriert. Der Vorteil ist, dass wir wirklich große und repräsentative Stichproben von Promovierenden haben. Dadurch können wir bei unseren Auswertungen fein differenzieren, beispielsweise nach Fachbereichen, Stipendien oder nach Mitgliedschaft in einem strukturierten Promotionsprogramm.
Welche Formate bevorzugen Early Career Researchers für ihre Wissenschaftskommunikation?
Auffällig ist, dass Formate, die aus dem wissenschaftlichen Betrieb bekannt sind, ganz oben rangieren: Ein öffentlicher Vortrag oder ein Artikel für eine Zeitung zum Beispiel. Ich fand diese recht konservative Schwerpunktsetzung ehrlich gesagt etwas überraschend. Denn mir schien, dass es gerade die Promovierenden und Promovierten sind, die die neuen digitalen Formate und Kanäle in die Wisskomm bringen. Doch bei den genutzten digitalen Kanälen zeigen sich die Befragten eher zurückhaltend: Lediglich Twitter und LinkedIn werden von mehr als 20 Prozent der kommunizierenden Early Career Researchers genutzt. Einen eigenen Blog oder Podcast haben nur die allerwenigsten, nämlich weniger als 5 Prozent. Dieses Ergebnis entspricht nicht gerade dem Klischee der permanent und auf allen Kanälen präsenten „Digital Natives“.
Was sind Hindernisse, die Early Career Researcher von der Wissenschaftskommunikation abhalten?
70 Prozent der Befragten gaben an, keine Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Bei dieser Gruppe haben wir nachgebohrt und nach Hindernissen gefragt. Hier sei zunächst erwähnt, dass bei der Frage nach den Hindernissen, wie auch nach der Motivation, Antwortmöglichkeiten vorgegeben wurden, um die Datenauswertung bei 7.000 befragten Personen zu erleichtern. Die Antwortmöglichkeiten basieren auf den Ergebnissen verschiedener früherer Studien2, in denen die Motivation für Wissenschaftskommunikation bereits untersucht worden ist – allerdings nicht speziell für Early Career Researchers, sondern für kommunizierende Wissenschaftler*innen im Allgemeinen.
Es gab zwei vorgeschlagene Hinderungsgründe, die für die Befragten überhaupt keine Rolle spielten. Das waren schlechte Erfahrungen und die Sorge um negative Karriereauswirkunge – dem wurde regelrecht widersprochen. Die zwei Gründe, die hingegen ganz hohe Zustimmungswerte erhielten, waren ein Mangel an Zeit und ein Mangel an Gelegenheiten. Diese zwei Aspekte sind mit großem Abstand die beiden Faktoren, die die Befragten davon abhalten, Wissenschaft an ein Lai*innenpublikum zu kommunizieren.
Hat Sie dieses Ergebnis überrascht?
Man hat in der Promotionsphase wahnsinnig viel um die Ohren, oft herrscht ein hoher Leistungsdruck; Promovierende müssen sich zudem häufig noch an der Lehre beteiligen. So gesehen ist der Zeitaspekt nicht überraschend.
Aber dass es sich für so viele offenbar noch nie ergeben hat, ihre Forschung an ein Lai*innenpublikum zu kommunizieren, finde ich bemerkenswert. Aktuell habe ich den Eindruck, dass das Thema Wissenschaftskommunikation omnipräsent ist. In wissenschaftspolitischen Debatten ist es geradezu ein Buzzword geworden und viele Institutionen wollen sich in diesem Bereich verbessern. Wieso mangelt es dann an Gelegenheiten? Eine mögliche Erklärung ist die Karrierestufe: Professor*innen bekommen mehr Anfragen als Promovierende, das legt beispielsweise eine Studie von WiD, DZHW und NaWiK zu diesem Thema nahe. Aber unsere Umfrage hat sich nicht an Personen gerichtet, die gerade erst mit ihrer Promotion angefangen haben. Alle Befragten sind seit mindestens zwei Jahren mit dem Wissenschaftsbetrieb in Kontakt. Da muss so ein Ergebnis doch aufhorchen lassen.
Sehen Sie da Handlungsbedarf oder Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Institutionen?
Ja, und ich denke der Handlungsbedarf ist eigentlich bereits erkannt worden: In Positionspapieren, wie dem des Wissenschaftsrats oder auch der Hochschulrektorenkonferenz, wird die Notwendigkeit für Weiterbildungsangebote in der Qualifizierungsphase immer wieder thematisiert. Wenn man dafür Unterstützungsangebote entwickeln möchte, könnte es sinnvoll sein, bei den Punkten „Zeit“ und „Gelegenheiten“ ansetzen. Würden die Hochschulen beispielsweise ganz deutlich sagen: „Ein Teil der Ausbildung als Wissenschaftler*in ist nicht nur Forschung und Lehre, sondern auch das Vermitteln von Forschung an Lai*innen“, würde für diese Tätigkeiten vielleicht auch entsprechend Zeit eingeräumt werden.
In strukturierten Programmen könnten die Hochschulen die Curricula entsprechend gestalten. Wir haben zum Beispiel beobachtet, dass Promovierende, die einen Kurs zur Wissenschaftskommunikation besucht haben, zwei Jahre später deutlich häufiger angaben, Wissenschaft zu kommunizieren. Das sind aus meiner Sicht Hinweise auf Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Vielleicht muss man Early Career Researchers also etwas aus der Pflicht nehmen, selbst Zeit und Gelegenheit für Wissenschaftskommunikation finden zu müssen.
Die Wissenschaftskommunikation entwickelt sich von einem Nice-to-Have zu einem Must-Have. Sie ist zum Beispiel häufig verpflichtender Bestandteil von Fördermittelanträgen. Ist dies eine zusätzliche Belastung für Early Career Researchers?
Ich finde die Antworten der Early Career Researchers auf unsere Fragen spiegeln eigentlich eine sehr positive Einstellung zur Wissenschaftskommunikation wider, die so gar nicht nach „Belastung“ klingt. Das wirkt in vielen Twitter-Beiträgen zu #IchBinHanna aber oft auch anders. Da wird Wissenschaftskommunikation von vielen durchaus als zusätzlicher, belastender Faktor in einem ohnehin von zu viel Leistungsdruck geprägten Umfeld beschrieben. Die Frage ist aus meiner Sicht deshalb eher: Tragen solche Verpflichtungen wirklich dazu bei, dass Forschungsergebnisse mehr Menschen außerhalb der eigenen „Bubbles“ erreichen? Mit Blick auf meine Arbeit habe ich Zweifel: Bei der Motivation der kommunizierenden Early Career Researchers spielt externer Druck keine Rolle. Und schließlich weiß man aus der Motivationsforschung3 ja schon lange, dass Zwang ein schlechter Motivator ist und intrinsischer Motivation entgegenwirkt – die intrinsische Motivation es aber ist, die die Menschen zu Höchstleistungen bringt. Das spricht aus meiner Sicht nicht gerade für einen positiven Effekt von verpflichtenden Maßnahmen. Ich frage mich angesichts dessen eher, ob das nicht die Gefahr birgt, dass Wissenschaftskommunikation zur unmotiviert abgeleisteten Pflichtübung wird. Daher wäre meine Empfehlung eher: den Forschenden Zeit einräumen, Angebote machen, Hemmschwellen abbauen und vielleicht auch ein bisschen Inspirationen liefern, welche Wisskomm-Formate es neben Artikeln oder Vorträgen noch gibt.
- Könneker, C., Niemann, P., Böhmert, C., Weniger Wertschätzung, weniger Engagement – Zur Situation der Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Forschung & Lehre,10/18 (2018), 870–872. ↩︎
- Pansegrau, P., Taubert, N., WEINGART, P., Wissenschaftskommunikation in Deutschland: Ergebnisse einer Onlinebefragung, Berlin 2011. Gantenberg, J., Wissenschaftskommunikation in Forschungsverbünden, Wiesbaden 2018. Ziegler, R., Fischer, L., Ambrasat, J, Fabian, G., Niemann, P., Buz, C., Wissenschaftskommunikation in Deutschland – Ergebnisse einer Befragung unter Wissenschaftler*innen, Berlin/Karlsruhe 2021. ↩︎