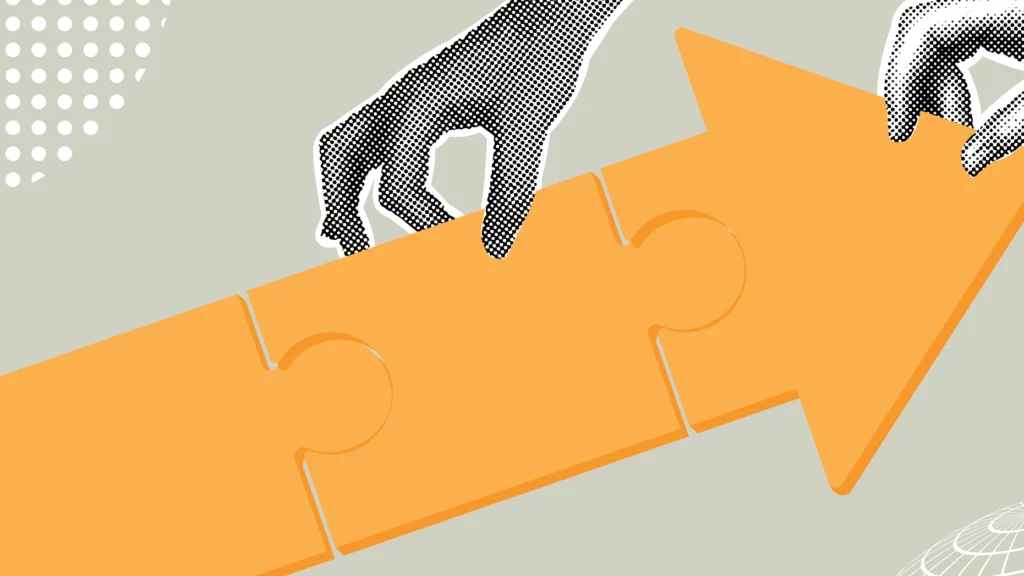Warum aggressive Sprache schaden kann und die meisten Menschen sich sachliche Informationen wünschen: Über die Vertrauenswürdigkeit von Forschenden in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Ein Gastbeitrag des Psychologen und Kommunikationswissenschaftlers Lars König.
Wissenschaftskommunikation im Krisenmodus?
Seitdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat, überschlagen sich weltweit die Meldungen über die neuartige Atemwegserkrankung Covid-19 (coronavirus disease 2019). Spätestens seit sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder auf ein Verbot von Zusammenkünften in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen geeinigt hat, scheint auch in Deutschland ein Großteil der Bevölkerung den Ernst der Lage erkannt zu haben. Mit dem sich einstellenden Problembewusstsein kommen allerdings auch eine Reihe von Fragen in der Bevölkerung auf. Diese sind zum Teil ganz praktischer Natur, etwa wenn es um die neue Gestaltung des Familienlebens oder die Organisation des Arbeitsalltags im Homeoffice geht. Die Beantwortung solch praktischer Fragen ist oftmals zeitaufwändig und erfordert organisatorisches Geschick. Im Allgemeinen gelingt es den meisten Menschen aber, adäquate Antworten zu finden.
Schwieriger wird es allerdings bei spezifischeren Fragen, die sich auf die Atemwegserkrankung Covid-19 beziehen. Beispielsweise fragen sich viele Menschen, warum gerade das neue Coronavirus SARS-CoV-2 weitaus mehr Menschen infiziert als das bereits aus dem Jahr 2003 bekannte SARS-Coronavirus. Die Beantwortung solcher Fragen ist deutlich schwieriger, weil hierfür Fachwissen aus den Naturwissenschaften und der Medizin nötig ist. Der Großteil der Bevölkerung ist zur Beantwortung solch spezieller Fragen auf die Hilfe von Expertinnen und Experten angewiesen. Insbesondere bei neuartigen Erkrankungen kann es dabei jedoch vorkommen, dass widersprüchliche und unpräzise Informationen im Umlauf sind. Ein Grund hierfür kann sein, dass die aktuelle Evidenzlage noch keine eindeutigen Aussagen zulässt. Eine andere Möglichkeit ist allerdings, dass gezielt Falschinformationen und Verschwörungstheorien verbreitet werden. Gerade über das Internet können solche Falschinformationen eine große Zahl von Menschen erreichen, weil soziale Netzwerke und Gesundheitsforen vielfach nur einer geringen oder keiner Qualitätskontrolle unterliegen.
Wovon hängt es also ab, auf welche Informationen sich Menschen verlassen, wenn sie mit widersprüchlichen Aussagen konfrontiert werden? Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden sich wahrscheinlich wünschen, dass die Qualität der vorgebrachten Argumente den Ausschlag gibt. Weil aber viele Argumente auf hochkomplexen wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, können die meisten Menschen deren Qualität nicht adäquat beurteilen. Stattdessen orientieren sie sich an anderen Faktoren, um sich eine Meinung über die Vertrauenswürdigkeit von Informationsquellen und die Glaubwürdigkeit von Aussagen zu bilden. Aus der Forschung ist beispielsweise bekannt, dass der Sprachstil, in dem eine Information vorgebracht wird, hierbei eine entscheidende Rolle spielt. So kann etwa die Emotionalität einer Aussage entscheidend beeinflussen, für wie glaubwürdig das Publikum die Äußerung hält. Die Wirkung unterschiedlicher Sprachstile in der Wissenschaftskommunikation haben Regina Jucks von der Universität Münster und ich in den vergangenen Jahren in mehreren Studien untersucht.
In einer dieser Untersuchungen sahen die Probandinnen und Probanden das Video einer Podiumsdiskussion über die Wirksamkeit von Antidepressiva. Hier wurde ein Wissenschaftler als weniger vertrauenswürdig wahrgenommen, wenn er einen aggressiven Sprachstil verwendete und beispielsweise sagte: „Dementsprechend war Herr Beckers Vorgehen aus methodischer Sicht hier nicht korrekt, sondern inkompetent und naiv“. Neben Aggressivität kann allerdings auch ein zu enthusiastischer Sprachstil die Vertrauenswürdigkeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern senken. Das zeigt eine Studie zu Gesundheitsforen, in der wir eine Onlinedebatte über neue Technologien zur Diagnose von Krankheiten fingiert haben. Schrieb dort ein Forscher Sätze wie „Das zweite Ergebnis – was ich super interessant finde –ist folgendes …“, wirkte sich das negativ auf die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen aus, verglichen mit derselben Aussage ohne den Einschub. Auch der Wissenschaftler selbst erschien als weniger informiert und als manipulativer, wenn er mit offensichtlicher Begeisterung von seinen Erkenntnissen berichtete.
Generell kann ein extrem positiver Sprachstil der Vertrauenswürdigkeit von Forschenden schaden, wie eine weitere Auswertung von Regina Jucks und mir ergab. Erneut ging es um die Äußerungen eines Experten in einem Gesundheitsforum, diesmal zur Wirksamkeit von Medikamenten. Viele positive Adjektive in seinem Beitrag – wie in „Sein vorbildhaftes methodisches Vorgehen und seine erstklassige statistische Datenanalyse sprechen für die Qualität der Studie“ – führten dazu, dass die Versuchspersonen den Forscher als weniger vertrauenswürdig einstuften, als weniger integer und wohlwollend und seine Äußerungen für unglaubwürdiger hielten. Alle drei Studien kommen letztlich zu einem ähnlichen Ergebnis: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden besonders dann als vertrauenswürdig wahrgenommen, wenn sie einen neutralen Sprachstil verwenden.
Viele Forschende scheinen das schon heute intuitiv zu beherzigen. Das derzeit wohl prominenteste Beispiel hierfür ist Professor Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité. In einem vom Norddeutschen Rundfunk produzierten Podcast beantwortet er aktuelle Fragen rund um das Thema Covid-19. Die behandelten Themen variieren von Tag zu Tag, seine Antworten gibt Drosten allerdings immer auf die gleiche Art und Weise: Neutral, sachlich und ruhig. Wie gut diese Art der Informationsvermittlung bei den Hörern ankommt, zeigt sich anhand der zahlreichen und fast ausschließlich positiven Bewertungen der Podcastepisoden.
Eine objektive und unaufgeregte Informationsvermittlung scheint auch in anderen Bereichen als der Gesundheitskommunikation Vertrauen zu schaffen. Während des Anschlags von München im Jahr 2016, als ein 18-jähriger Schüler neun Menschen tötete, war die Nachrichtenlage zunächst äußerst unübersichtlich. Über die sozialen Medien verbreiteten sich zahlreiche Gerüchte, die teils zu voreiligen Schlüssen führten. Allerdings hat eine Person in dieser Situation die Ruhe bewahrt und auf ihren Sprachstil geachtet: der Pressesprecher der Münchner Polizei, Marcus da Gloria Martins. Er hat die Bevölkerung sachlich und ruhig über den aktuellen Erkenntnisstand aufgeklärt. Im Nachgang erfuhr Martins viel Zuspruch für seine besonnene Informationsvermittlung und die Presse lobte ihn als „Ruhepol“ im Münchner Chaos.
Natürlich darf aus den geschilderten Studien und Beispielen nicht der Schluss gezogen werden, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich ausschließlich in einem neutralen Sprachstil äußern sollten. Es wird Situationen und Kontexte geben, in denen andere Sprachstile angemessen und nötig sind. Ein Beispiel liefert eine im Januar erschienene Untersuchung im Lehr-Lern-Kontext: Zwei Varianten eines Bildungspodcasts zum Thema evolutionäre Psychologie wurden untersucht, in denen der Sprecher entweder nüchtern oder enthusiastisch über Erkenntnisse aus diesem Fachgebiet berichtete. Versuchspersonen, die die „begeisterte“ Version gehört hatten, empfanden den Podcast als interessanter und angenehmer anzuhören, außerdem wollten sie gern mehr über das Thema erfahren und erlebten den Podcast-Sprecher als vertrauenswürdiger. Das zeigt, dass emotionale Äußerungen in der Wissenschaftskommunikation auch ihren Platz haben. Dennoch kann es in Krisenzeiten für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beruhigend sein, zu wissen: Ein neutraler und ruhiger Kommunikationsstil stellt in vielen Situationen eine angemessene und vertrauensschaffende Wahl dar.
Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider.