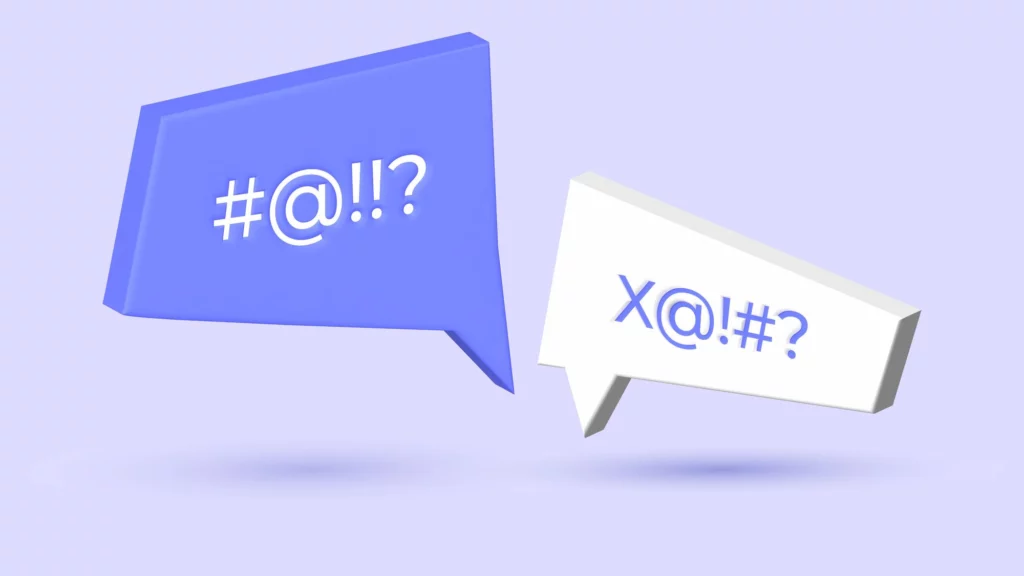Was, wenn das Forschungsministerium bald in AfD-Hand wäre? Matthias Jakubowski von „FragDenStaat“ warnt vor einer schleichenden Unterwanderung des Wissenschaftssystems. Die Angriffe auf alles, was nicht ins rechte Weltbild passt, laufen bereits.
Wie die AfD die Wissenschaft umbauen will
Herr Jakubowski, was passiert mit der Wissenschaft, wenn die AfD an die Macht kommt?
Ab dem Moment, in dem die AfD Regierungsverantwortung übernimmt, hat sie die Möglichkeit, über die Ministerien Einfluss zu nehmen. Vielleicht bekommt sie das Forschungsministerium. Damit hätte sie direkten Zugriff auf die Bildungslandschaft in Deutschland. Das könnte dann für die gesamte Wissenschaftslandschaft und die Hochschulen massive Einschränkungen bedeuten.

Welche Folgen hätte das konkret?
Gefährdet sind alle Bereiche, die dem rechten politischen Weltbild widersprechen: Gender Studies, Rechtsextremismusforschung, Demokratieforschung oder Migrationsforschung. Zu diesen Fächern gibt es klare Abwertungen und Ablehnung aus AfD-Kreisen. Sie sollen, nach deren Logik, „weg“. Und sie werden heute schon verbal attackiert. In der Wissenschaft läuft vieles über Finanzierungsmechanismen. Die Gefahr ist groß, dass sie in einem politisch veränderten Klima real zurückgedrängt oder finanziell ausgetrocknet wird.
Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber ich warne vor dem Bild einer plötzlichen „Machtergreifung“. Stattdessen erleben wir eine schleichende Entwicklung, wie bei einem Kochtopf, bei dem die „Hitze“ nach und nach höher gedreht wird. Bereits heute befindet sich die Wissenschaft in einer extrem bedrohlichen Lage.
Ist das BMFTR strategisch für die AfD interessant?
Bildung ist einer der Bereiche, über die die extreme Rechte – und auch die AfD – immer wieder versucht, Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Ideologisch steht dahinter die Vorstellung, dass im Bildungsbereich etwas rückgängig gemacht werden müsse. Es ist häufig vom „linksgrün versifften“ Bildungssektor die Rede, in dem seit der Achtundsechziger-Generation angeblich alles in die falsche Richtung gelaufen sei. Der Wille, das zurückzudrehen, ist sehr ausgeprägt. Insofern könnten das Bildungs- und auch das Forschungsministerium strategisch sehr interessant für eine Partei wie die AfD sein.
Was passiert dann mit der Wissenschaft? Soll sie umgebaut, diskreditiert oder gleichgeschaltet werden?
Ich denke, es geht vorrangig darum, Wissenschaft zu instrumentalisieren. Wissenschaft soll nicht ergebnisoffen forschen, sondern bestimmte politische Positionen stützen. Auf dem Weg dorthin wird zerstört, was nicht ins eigene Weltbild passt.
Ein Beispiel ist das inzwischen aufgelöste pseudowissenschaftliche Institut für Staatspolitik. Es wurde bewusst als „Institut“ bezeichnet – angelehnt an das „links-grüne“ Hamburger Institut für Sozialforschung –, um Seriosität vorzutäuschen. Der Anspruch war: Wir brauchen so etwas auch für „unsere“ Wissenschaft. Aber es ging nie um offene Forschung, sondern um Ideologie mit wissenschaftlichem Anstrich.
Sehen Sie die Wissenschaft eher als eine Zielscheibe oder ist sie ein handlungsfähiger Akteur?
Aktuell ist die Wissenschaft ganz klar eine Zielscheibe. Ich würde mir wünschen, dass sie in Zukunft ein handlungsfähiger Akteur wird. Seit der Corona-Pandemie steht die Wissenschaft unter großem Druck. Wissenschaftliche Meinungen sind im gesellschaftlichen Diskurs häufig Ziel von Angriffen – das betrifft sowohl einzelne Wissenschaftler*innen als auch ganze Institutionen.
Wie müsste sich die Wissenschaft wehren?
Da möchte ich an ein Interview mit Samantha Goldstein über „Stand Up For Science“ anknüpfen. Die Wissenschaft erlebt in den USA aktuell massive Attacken und politischen Druck. Entwicklungen, die so zwar noch nicht in Deutschland bestehen, aber befürchtet werden. Goldstein sagt, sie wünsche sich, dass vor allem etablierte Wissenschaftler*innen in den USA lauter werden und sich mehr zu den aktuellen Entwicklungen äußern.
Oft sind es vor allem Wissenschaftler*innen im Mittelbau, die sich engagieren, zum Beispiel bei Demonstrationen oder öffentlichen Stellungnahmen. Das kann man auch in Deutschland beobachten. Es gibt studentische Initiativen, die bestimmte Themen wie Mittelkürzungen, politische Entwicklungen oder rechtsextreme Tendenzen ansprechen. Es wäre wünschenswert, dass sich Institutionen in Deutschland vermehrt zu Wort melden, das hätte mehr Gewicht als einzelne Stimmen.
Wen hört man denn stattdessen?
Es gibt eine rechte Minderheit, die sehr präsent ist und den Diskurs stark prägt. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Dieses Netzwerk tritt sehr laut auf und trifft klare politische Aussagen. Auffällig ist: Einige der Mitglieder äußern sich selbst ausgesprochen politisch, werfen aber anderen genau das vor. Sie beklagen, Hochschulen würden „ideologisiert“, während sie selbst sehr offensiv Position beziehen. Laut der Webseite sind in diesem Netzwerk auch Personen vertreten, die der Neuen Rechten oder der AfD nahestehen.
Bietet die derzeitige Beschäftigungsstruktur im Wissenschaftssystem – Stichwort WissZeitVG – einen Nährboden für die Einflussnahme der extremen Rechten?
Die Beschäftigungsstruktur würde ich als prekär bezeichnen, besonders im wissenschaftlichen Mittelbau. Zum einen spielt der Unzufriedenheitsfaktor eine Rolle. Das sieht man auch in der Gesellschaft: Gerade dort, wo Menschen mit ihrer Lebens- oder Arbeitssituation unzufrieden sind, sind sie besonders anfällig für rechte Narrative1.
Zum anderen ist man angreifbar, weil man weniger resilient ist. Das liegt daran, dass viele unsicher sind, wie lange sie überhaupt in dieser Beschäftigungssituation bleiben können, ob sie ihr Forschungsvorhaben abschließen können oder ob die Mittel für das Projekt, an dem sie arbeiten, bereitgestellt werden.
Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung verfolgt laut ihrer eigenen Website das Ziel, wissenschaftliche Forschung und Veranstaltungen zu fördern, vor allem im Bereich Wirtschafts-, Politik- und Sozialwissenschaften. Was genau hat Ihre Analyse zur Arbeit dieser Stiftung ergeben2?
Zur Arbeit der Stiftung lässt sich sagen, dass sie Veranstaltungen mit vermeintlichen gesellschaftlichen Bezügen und wissenschaftlichem Anspruch organisiert. Wie seriös diese sind, ist schwer zu beurteilen, da die Stiftung sehr undurchsichtig agiert.
Örtlichkeiten werden oft nicht öffentlich genannt, stattdessen heißt es nur, in Berlin finde eine Veranstaltung statt. Oder der Titel wird genannt, aber keine Referent*innen. Wenn man aber doch mitbekommt, wer dort auftritt, lässt sich eine klare politische Schlagrichtung erkennen. Häufig sind Personen dabei, die Verbindungen zur sogenannten Neuen Rechten haben. Drei Personen aus dem aktuellen Vorstand werden im jüngsten Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz genannt. Diese drei Vorstandsmitglieder äußerten sich laut Verfassungsschutz so, dass deren Aussagen oder Verhalten als gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung gerichtet gewertet werden.
Titel von Veranstaltungen der Stiftung mögen unverfänglich klingen, doch die Gefahr besteht, dass sie zum Ort der Vernetzung für neue rechte Ideologien wird, die möglicherweise nicht mehr mit demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar sind. Das sind zwar nur Indizien, doch daraus könnte man schließen, dass die Stiftung in ihrer Gesamtschau womöglich nicht im Sinne der Demokratie arbeitet.
Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht demokratische Parteien bei der rechten Diskursverschiebung?
Demokratische Parteien sollten sich nicht im vorauseilenden Gehorsam oder aus Angst vor gesellschaftlichen Stimmungen dazu verleiten lassen, die Wissenschaft bereits jetzt einzuschränken. Ein Beispiel sind die Genderverbote in einigen Bundesländern. Sie sind Ergebnis einer von rechts gesetzten Kampagne. Die hat das Thema erfolgreich skandalisiert, obwohl es nie eine gesetzliche Verpflichtung zum Gendern gab. Es gab lediglich Empfehlungen, etwa von Hochschulen oder Gleichstellungskommissionen, diskriminierungssensible Sprache zu fördern – im Sinne von Artikel 3 des Grundgesetzes.
All das geschieht, ohne dass die AfD in irgendeinem Bundesland mitregiert. Deshalb dürfen wir nicht nur im Konjunktiv sprechen – nicht nur fragen, was passieren könnte, wenn autoritäre Kräfte an die Macht kommen. Wir müssen jetzt hinschauen, wo solche Entwicklungen längst Realität sind. Denn die stärksten Einschränkungen für die Wissenschaft kommen derzeit von rechts. Und das ist keine Zukunftsprognose, sondern Gegenwart.
Wenn Sie einen konkreten „Fünf-Punkte-Plan“ zur Resilienz der Wissenschaft gegen autoritäre Bestrebungen vorschlagen müssten – was würde auf dieser Liste stehen?
Erstens: Vorbereitung. Die Wissenschaft muss wissen, wer sie angreift und warum sie angegriffen wird. Das heißt auch vorausschauend zu denken und sich mit möglichen Bedrohungen frühzeitig auseinanderzusetzen.
Zweitens: Vernetzung und Solidarität. Hochschulen und wissenschaftliche Institutionen müssen sich untereinander stärker verbinden und eine Gemeinschaft bilden, die in der Lage ist, Angriffe gemeinsam abzuwehren.
Drittens: klare Forderungen an die Politik. Die Wissenschaft muss ihre Stimme erheben und deutlich sagen, was sie braucht, um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde verteidigen zu können. Dazu gehören Forderungen zur finanziellen Ausstattung, weniger Abhängigkeit von Drittmittelprojekten. Auch hier zeigt sich: Die Hochschulen sind nicht ausreichend resilient. Das ist ein strukturelles Problem.
Viertens: politische Positionierung. Wissenschaft ist parteipolitisch neutral, aber natürlich politisch. Sie muss sich klar zum Grundgesetz bekennen und deutlich machen, dass sie mit Akteur*innen, die dessen Grundprinzipien angreifen, nichts zu tun haben will.
Fünftens: ein klares Bekenntnis der Politik zur Freiheit der Wissenschaft. Es braucht eine starke Unterstützung aus der Politik. Der Wissenschaftsbetrieb selbst muss darauf hinwirken, dass diese Unterstützung auch eingefordert und eingeflochten wird.