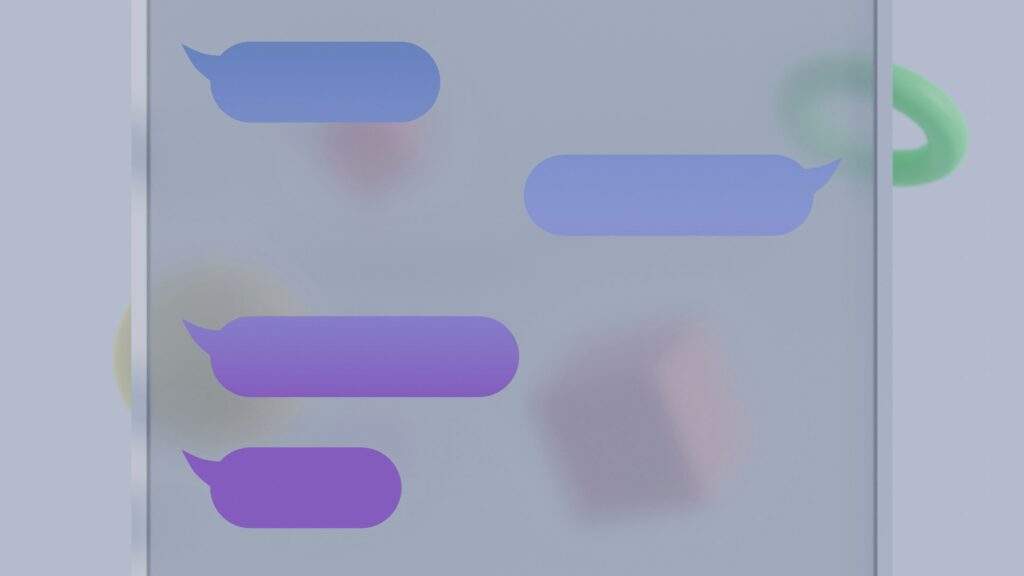Menschen sind immer emotional und Entscheidungen immer politisch, sagt Maren Urner. Im Interview erklärt die Neurowissenschaftlerin, warum Angst uns dümmer macht und wie authentische Emotionen Vertrauen schaffen .
Warum Wissenschaft „radikal emotional“ sein sollte

Frau Urner, kürzlich wurde eine Studie zu den Ängsten der Deutschen veröffentlicht. Demnach haben die Deutschen am meisten Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten. Die Angst vor dem Klimawandel schaffte es nicht einmal unter die Top Ten. Finden Sie diese Ergebnisse überraschend?
Ich finde sie nicht überraschend. Sie bilden ab, was aktuell medial priorisiert wird: geopolitische Herausforderungen, Angriffskriege und Inflation. Das sind Themen, die natürlich Angst machen und große Fragen aufwerfen. Das Klima wird mittlerweile häufig als nerviges Zusatz-Thema abgetan, was sicher auch mit einer gewissen Krisenmüdigkeit zusammenhängt. Übergeordnet müssen wir uns fragen, wie wir mit Ängsten umgehen. Aus neurowissenschaftlich-psychologischen Studien wissen wir, dass chronische Verunsicherung zu erlernter Hilflosigkeit führen kann. Sie lässt uns passiv zurück und Erlebnisse von Selbstwirksamkeit bleiben aus.
Wieso ist das so?
An dem Sprichwort „Angst ist ein schlechter Berater“ ist viel dran. Ich würde sogar noch weiter gehen und sagen: Angst und Unsicherheit sind schlechte Beraterinnen. Diese beiden Gefühlslagen treten häufig gemeinsam auf.
Unser Gehirn mag sichere Vorhersagen, doch in unsicheren Situationen gibt es die natürlich nicht. In akuter Angst und Unsicherheit kennt unser Körper drei Handlungsmöglichkeiten: Fight, Flight und Freeze, also kämpfen, flüchten und erstarren.
Aus neurowissenschaftlichen Studien wissen wir, dass Hirnregionen, die für höhere kognitive Fähigkeiten zuständig sind, in akuten Angstsituationen keinen Zugriff auf bereits abgespeicherte, gute Lösungen haben. Ein bisschen plakativer ausgedrückt: Wenn wir in einem ängstlichen Zustand sind, sinkt unser IQ.
Angst lässt uns also tatsächlich dümmer werden, weil wir uns mehr auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Gute Strategien für die Zukunft können Menschen in so einer Situation nicht entwickeln. Vermeintlich langfristige Themen wie der Klimawandel geraten so noch mehr ins Abseits.
„Fakten allein bringen niemanden dazu, das eigene Verhalten zu ändern. Wut, Trauer, Angst und Mitleid schaffen das“, das haben Sie in einem politischen Kontext gesagt. Was denken Sie, lässt sich davon auch auf die Wissenschaftskommunikation übertragen?
Viele Wissenschaftler*innen und Kommunikator*innen haben die Sorge, dass Wissenschaftskommunikation mit Emotionen nicht funktionieren kann. Emotionen würden Wissenschaftskommunikation verzerren, weil sie dann nicht mehr möglichst neutral, objektiv und rational sei.
Das menschliche Hirn – und somit wir Menschen – sind aber keine Computer. Egal wie gut eine Information präsentiert wird, sie wird nicht automatisch abgespeichert. Die Währung der Bedeutung für unser Gehirn sind Emotionen. Nur wenn wir etwas für „wichtig“ halten, es also einen emotionalen Wert für uns hat, speichern wir es gut ab.
In Europa sind mehr als 50 Prozent der erwachsenen Bevölkerung übergewichtig, obwohl die Gefahren von Übergewicht für die Gesundheit sehr gut bekannt sind. Solche Beispiele zeigen, dass die reine Weitergabe von Wissen nicht dazu führt, dass Menschen entsprechend handeln. Wissenschaftskommunikator*innen müssen sich fragen, was sie erreichen wollen. Wenn das Ziel darin besteht, Menschen zu informieren und so möglichst handlungsfähig zu machen, sollten Emotionen besser und klüger eingesetzt werden als bisher.
Denn rationale, also zielgerichtete Entscheidungen können wir nur treffen, weil wir bestimmte Vorlieben und Werte haben.1 Und diese sind immer durch Gefühle bestimmt. Basierend auf unseren Gefühlslagen entscheiden wir uns für oder gegen etwas. Wir sind also immer emotional und unsere Emotionen immer politisch. Weil jede noch so kleine Form der Kommunikation etwas über meine Überzeugungen und Werte aussagt.
Wie könnte dieser klügere Einsatz von Emotionen gelingen?
Zunächst ist das Wissen darüber, was Emotionen auslösen können, wichtig um die eigene Kommunikation zu verbessern. Emotionen sind wie erwähnt die Währung, die uns angibt, wie relevant etwas ist. Je emotionaler ein Erlebnis ist – es kann sich dabei auch um einen Vortrag handeln, der mich emotional berührt –, desto eher erreicht mich die Botschaft. Das ist ein Indikator dafür, dass wir uns besser daran erinnern, anderen davon erzählen und unser Handeln anpassen.
Wichtig ist, Emotionen authentisch einzusetzen, damit es nicht in Alarmismus oder Resignation umschlägt. Menschen sind sehr gut darin, zu erkennen, ob ein Verhalten oder eine Kommunikation authentisch ist. Je authentischer eine Person beziehungsweise eine Aussage wirkt, desto vertrauenswürdiger finden wir sie. Im besten Fall schaffe ich es als Wissenschaftlerin durch einen authentischen Dialog, dass eine Person mir vertraut, weil sie dann ein bisschen besser versteht, woran ich forsche.
Können Sie an einem Beispiel erklären, wie so ein authentischer Einsatz von Emotionen aussehen könnte?
Vor einigen Monaten hatte ich eine sehr schöne Begegnung während einer Podiumsdiskussion, bei der wir über den Umgang mit Extremwetterereignissen und die Berichterstattung darüber gesprochen haben. Im Publikum saß auch ein Klimawissenschaftler, der sich meldete. Er hatte in der Vergangenheit über schlimme Prognosen gesprochen, die ihn emotional mitgenommen haben. Diese Emotionen hatte er jedoch über lange Zeit nie gezeigt. Seitdem er in seinen Vorträgen auch darüber spricht, dass ihn diese Daten belasten und ihm der Klimawandel Angst mache, dringe er viel mehr zu seinem Publikum durch.
In den letzten zwei Jahren habe auch ich bei Vorträgen eine intensivere emotionale Nähe zugelassen. Das ist anstrengend, fühlt sich aber auch richtig an.
Das heißt, Sie sind der Meinung, dass auch Wissenschaftler*innen „radikal emotional“ kommunizieren sollten? In ihrem Buch fordern Sie eine radikale Emotionalität von Politiker*innen um das Vertrauen in die Politik zu steigern.
Absolut. Vertrauen erhalte ich nur, indem ich mich vertrauenswürdig zeige und das gelingt nur durch eine authentische Kommunikation, zu der Emotionen dazugehören. Vertrauen ist der Klebstoff für menschliche Beziehungen.
Wir können in den USA beobachten, was für Dynamiken freigesetzt werden können, wenn Menschen nicht mehr in staatliche Institutionen oder die Wissenschaft vertrauen. Dann ist Tür und Tor offen für Verschwörungsgeschichten und Menschen sind nicht mehr zugänglich für wissenschaftliche Herangehensweisen.
Vertrauen ist das wichtigste Gut, das Kommunikator*innen nicht verspielen sollten, um mit Menschen in einen konstruktiven und lösungsorientierten Austausch treten zu können.
Das bedeutet also, dass Wissenschaft nicht neutral und unpolitisch sein kann?
Auch wenn ich als Wissenschaftlerin nicht aktiv nach außen kommunizieren würde: Ob ich zu Parteivertrauen oder zu Quantenphysik forsche, mag auf den ersten Blick unterschiedlich stark politisch sein. Doch die Frage was mit den Forschungsergebnissen passiert, ist in beiden Fällen hochpolitisch. Wer hat Zugriff auf die Ergebnisse? Wofür werden sie später genutzt?
Das sind politische Fragen, die bereits bei jeder Forschungsfrage mitspielen, wenn auch vielleicht unbewusst. Dazu gehört auch das Thema der Wissenschaftsfreiheit: In den USA bekommen Museen und Forschungseinrichtungen jetzt keine Gelder mehr. Zu behaupten, Wissenschaft könne sich neutral verhalten, ist schlichtweg falsch und letztlich selbstgefährdend. Eine Demokratie und ihre Wissenschaftsfreiheit müssen gepflegt werden – auch von der Wissenschaft. Sie kann sich nicht vor dem Deckmantel vermeintlicher Neutralität verstecken, ohne sich selbst zu gefährden.
Welche Verantwortung sehen Sie konkret bei den Wissenschaftler*innen?
Wissenschaftler*innen sollten sich ihrer Privilegien bewusster werden. Wir leben in Deutschland in einem Land, in dem Wissenschaft möglich ist – wenn auch nicht immer fair. Aber beispielsweise darf ich als Frauen Wissenschaft betreiben. Dafür haben Generationen vor mir gekämpft. Auch ich habe das lange nicht so wahrgenommen, weil es nicht oft thematisiert wird, sondern als normal und gegeben angenommen wird. Mittlerweile halte ich es für fahrlässig, sich nicht auch dafür einzusetzen, dass es so bleibt.
Weder eine Demokratie noch eine wissenschaftliche Hochschullandschaft, so wie wir sie in Deutschland haben, sind einfach vom Himmel gefallen.
- Damasio, A. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. Putnam Publishing ↩︎