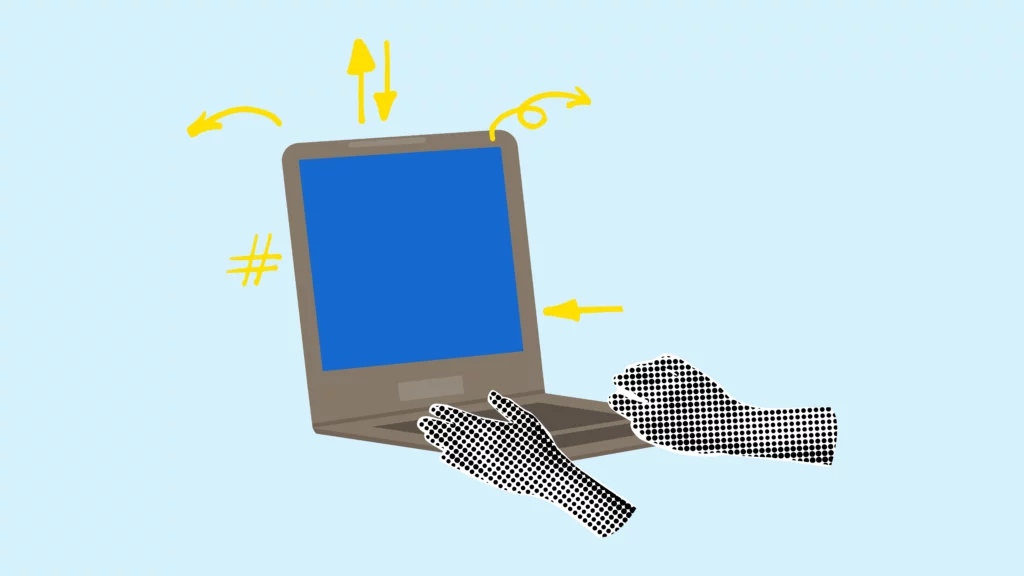Das soziale Netzwerk Twitter erfuhr während der Pandemie einen Aufschwung unter Wissenschaftler*innen. Was den Trend beförderte, welche Aspekte kommunizierenden Forschenden bewusst sein sollten und wer mitliest, erklärt die Kommunikationswissenschaftlerin Julia Metag im Interview.
Twitter: An der Quelle der Informationen?
Frau Metag, Sie forschen an Formen und Prozessen öffentlicher Kommunikation. Wie hat sich die Kommunikation zu wissenschaftlichen Themen auf Twitter während der Coronapandemie verändert?
Schon vor der Pandemie sah man, dass Onlinekanäle für die Wissenschaftskommunikation immer relevanter geworden sind. Im letzten Wissenschaftsbarometer gab die Mehrheit an, dass das Internet der wichtigste Informationskanal für sie sei. Die Coronapandemie hat diesen Trend verstärkt. Das liegt auch an der zeitlichen Dynamik: Gerade am Anfang gab es ein sehr hohes Informationsbedürfnis. Auf Twitter konnten Wissenschaftler*innen zeitnah und prägnant informieren. Viele Wissenschaftler*innen haben sich schon vor Corona in den sozialen Medien engagiert. In der Pandemie haben viele die Möglichkeiten der Kanäle wie Twitter schnell verstanden und für sich genutzt, um sich – gerade als die Lage zum Teil noch sehr unklar war – direkt in den Diskurs einzuschalten und die wissenschaftlichen Fakten zum Thema zu liefern.

Hat sich die Art der Interaktion geändert, als das erste Informationsbedürfnis gestillt wurde?
Das ist durchaus möglich. Man weiß, dass generell nur ein kleiner Anteil der Nutzer*innen Twitter aktiv nutzt und mit Tweets interagiert. Der Rest liest auf dem sozialen Netzwerk eher passiv mit. Das gleiche gilt auch für Wissenschaftler*innen. Viele nutzen Twitter intensiv, andere legen Pausen ein und ziehen sich zurück. Jenseits von Anlässen wie einer Pandemie nutzen sie Twitter auch häufig, um ihre Peers über die neueste Studie oder aktuelle Entwicklungen in der Community zu informieren.
Welche Bedürfnisse des Publikums konnten neben der schnellen Information durch Twitter gedeckt werden?
Für die Nutzer*innen bot Twitter auch die Option, an die Quelle der Informationen heranzukommen. Bei der Flut an Nachrichten, die auf einen eingeströmt sind, gab es den Wunsch, direkt bei Wissenschaftler*innen nachzuhaken. Natürlich bot der Wissenschaftsjournalismus reichhaltige Informationsmöglichkeiten. Viele Medien hatten anfangs Liveticker zur Coronapandemie geschaltet. Oft hatten diese Ticker Tweets von Wissenschaftler*innen eingebunden, da griffen soziale und klassische Medien ineinander. Twitter ist für Journalist*innen ein wichtiges Medium für die Recherche. Als Wissenschaftler*in kann ich Medienschaffende über Twitter erreichen und mein Tweet kann Anlass zur Berichterstattung geben.
Welche Stimmen aus der Wissenschaft waren besonders laut oder reichweitenstark, welche gingen daneben eher unter?
Eine Studie hat am Beispiel der USA gezeigt, dass die wissenschafts- und gesundheitsbezogenen Communities zu Beginn der Pandemie auf Twitter sehr prominent waren. Das waren einzelne Wissenschaftler*innen, aber auch Gesundheitsbehörden. Im Laufe der Zeit haben aber immer mehr politische Akteure die Diskussion dominiert. Die Debatte wurde dadurch viel stärker politisiert. Für die Wissenschaftscommunity war es dadurch schwieriger, über längere Zeit ein ähnlich breites Publikum auf Twitter wie am Anfang zu erreichen. Auch in Deutschland und im deutschsprachigen Raum konnten einzelne Expert*innen sehr starke Reichweite erzielen. Vor allem Christian Drosten und andere Virolog*innen und Epidemiolog*innen haben den Diskurs stark geprägt. Was die Viralität der Tweets anging, waren die von Einzelpersonen oft reichweitenstärker als die von Forschungsorganisationen oder Behörden wie dem Robert-Koch-Institut. Aber auch Leute, die sich eher skeptisch äußerten, waren sehr laut – wobei sie auf anderen sozialen Netzwerken oder in Messengern wie Telegram oft präsenter als auf Twitter sind.
Es zeigt sich ein Trend hin zu personalisierter Kommunikation – auch bei wissenschaftlichen Themen. Welche Gründe kennt die Forschung dafür, dass man Personen scheinbar mehr Vertrauen schenkt oder häufiger mit ihnen interagiert als mit Behörden- oder Institutsaccounts?
Zu der Frage der Personalisierung in der Wissenschaftskommunikation steckt die Forschung noch in ihren Kinderschuhen. Aus der politischen Kommunikationsforschung wissen wir allerdings, dass Bürger*innennähe beispielsweise zu einer Stärkung von Vertrauen in die Politiker*innen führen kann. Das wird deswegen teilweise strategisch eingesetzt. Macht man zu viele private Details öffentlich, kann der Effekt aber auch ins Gegenteil umschlagen.
Was lässt sich daraus auf die Wissenschaftskommunikation übertragen?
Wissenschaft wirkt oft alltagsfern. Wird sie mit Personen, mit den Wissenschaftler*innen, verbunden, kann sie viel greifbarer sein. Wenn die Forschenden stärker aus ihrem Arbeitsalltag berichten und nicht nur wissenschaftliche Fakten präsentieren, auch zeigen, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert und welche Methoden zur Anwendung kommen, wird das oft positiv wahrgenommen. Dadurch erfährt die Personalisierungstendenz nochmals stärkeren Aufschwung.
Twitter ist durch eine maximale Zeichenzahl von 280 pro Tweet ein sehr begrenztes Medium – außer man schreibt lange Threads. Inwiefern gelingt es, dort komplexe Wissenschaft zu vermitteln?
Das ist eine der Grundfragen in der Wissenschaftskommunikation: Wie viel Vereinfachungen, wie viel Verknappung darf sein? Grundsätzlich sind eine einfache Sprache und kurze Informationen besser verständlich als komplexe, lange wissenschaftliche Sätze. Dafür eignet sich Twitter hervorragend. Eine andere Debatte, die wir häufig führen, ist, inwieweit Unsicherheit von wissenschaftlichen Erkenntnissen dargestellt werden soll. Wir wissen inzwischen, dass es nicht zwingend schädlich ist, diese Unsicherheit zu kommunizieren, sondern Vertrauen gewinnen und Interesse wecken kann1. Davor muss man keine Scheu haben. Es ist aber eine Herausforderung, das zu tun, wenn man sich aufgrund der Knappheit der Zeichen einschränken muss. Viele nutzen dabei die Charakteristika des Mediums für sich und schreiben gute Erklär-Threads, in denen sie die knapp formulierten Aussagen des ersten Tweets ausformulieren, begründen und Limitationen aufzeigen. Viele arbeiten dabei mit Datenvisualisierungen. Da erlaubt Twitter deutlich mehr Tiefgang als man in 280 Zeichen transportieren könnte.
Wer hört zu, wenn Wissenschaftler*innen auf Twitter kommunizieren?
Über die Zielgruppen von Twitter sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Twitter ist zumindest in Deutschland noch immer kein Medium, das eine breitere Öffentlichkeit erreicht, zumindest nicht direkt. Die Online-Nutzer*innenzahlen für 2021 zeigen, dass lediglich zehn Prozent der Bevölkerung Twitter regelmäßig, also zumindest einmal die Woche nutzen. Das ist ein sehr spezielles Publikum, zu dem viele Politiker*innen, Wissenschaftler*innen und Journalist*innen zählen. Twitter gilt deshalb auch als „Elitenmedium“. Das geht sowohl in der Wissenschafts- als auch der kommunikationswissenschaftlichen Community manchmal etwas unter. Natürlich sind auch Bürger*innen auf Twitter aktiv, aber das ist kein repräsentatives Abbild der Bevölkerung. Häufig sind die Nutzer*innen eher gebildet, haben ein Vorwissen oder gewisses Interesse für wissenschaftliche Themen und sind oft meinungsstark.
Welche Nachteile hat Twitter als Medium für die Wissenschaftskommunikation?
Ein viel diskutierter Nachteil – nicht nur von Twitter, sondern sozialer Medien allgemein – ist das Problem der Desinformation. Es gibt Studien, die zeigen, dass einzelne Tweets, die entweder unabsichtlich oder gezielt Falschinformationen streuen, sehr große Reichweite bekommen können – besonders, wenn beispielsweise prominente rechte Politiker*innen oder Aktivist*innen in den USA mit großer Reichweite Verschwörungserzählungen teilen, ist das schwer in den Griff zu kriegen. Durch die Viralität lassen sich Falschinformationen dann sehr schwer eindämmen. Studien belegen auch, dass sich Fake News oft schneller als korrekte Informationen verbreiten.
Eine andere Problematik ist das Risiko, angefeindet zu werden, dem sich Wissenschaftler*innen aussetzen, die auf Twitter sehr prominent kommunizieren. Bisher gab es noch wenig Unterstützung durch die Institutionen, wobei sich durch Wissenschaft im Dialog und den Bundesverband Hochschulkommunikation bei diesem Thema jetzt etwas tut. Man hat wahrgenommen, dass kommunizierende Wissenschaftler*innen eine Supportstruktur brauchen.
Dem Medium Twitter wird häufig unterstellt, dass es überhitzte Debatten fördert und sich durch eine Empörungskultur auszeichnet. Hat sich das in der Coronapandemie verstärkt?
Das ist eine gute Frage. Gerade Hassrede hat in den letzten Jahren einen Einfluss auf die Diskussionskultur in sozialen Medien und auch auf Twitter. Das geht über Kommentare, die das Diskursklima beeinträchtigen hin zu Beleidigungen und Verleumdung. Ich bin allerdings nicht sicher, ob es schon Daten dazu gibt, ob das Problem in der Pandemie zugenommen hat. Lange gab es auch eine Debatte um Echokammern, sodass sich Menschen nur innerhalb ihrer Filterblasen bewegen und nur noch mit Meinungen konfrontiert werden, die der eigenen entsprechen und sie unterstützen. Entsprechend käme man nicht mehr oder kaum noch mit gegenteiligen Meinungen in Kontakt. Das ist mittlerweile widerlegt.
Mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer*innen und den Social-Media-Dynamiken im Blick: Was sollten Wissenschaftler*innen im Hinterkopf behalten, wenn sie sich auf Twitter äußern?
Sie sollten sich bewusst darüber sein, wen sie über Twitter erreichen. Bestimmte Teile der Bevölkerung sind dort sehr überrepräsentiert, andere gar nicht oder sehr wenig. Dazu kommt, dass sich Tweets gegebenenfalls rasch verbreiten können. Für die Reaktionen muss man gewappnet sein. Die Intensität als auch die Schnelligkeit kann Leute überfordern. Mein Kollege Daniel Nölleke hat das in einem Interview zu seiner Expert*innenstudie schön zusammengefasst: Man sollte aus der Coronapandemie lernen, dass es nicht nur Medientraining braucht. Wie schreibe ich den perfekten Tweet? Daneben müssen die Wissenschaftler*innen lernen, in welcher Medienlandschaft sie sich bewegen, wie sich die Publika je nach Medium unterscheiden und welche Dynamiken soziale Medien entfalten können. Das zu wissen, sollte auch eine grundsätzliche Kompetenz sein.