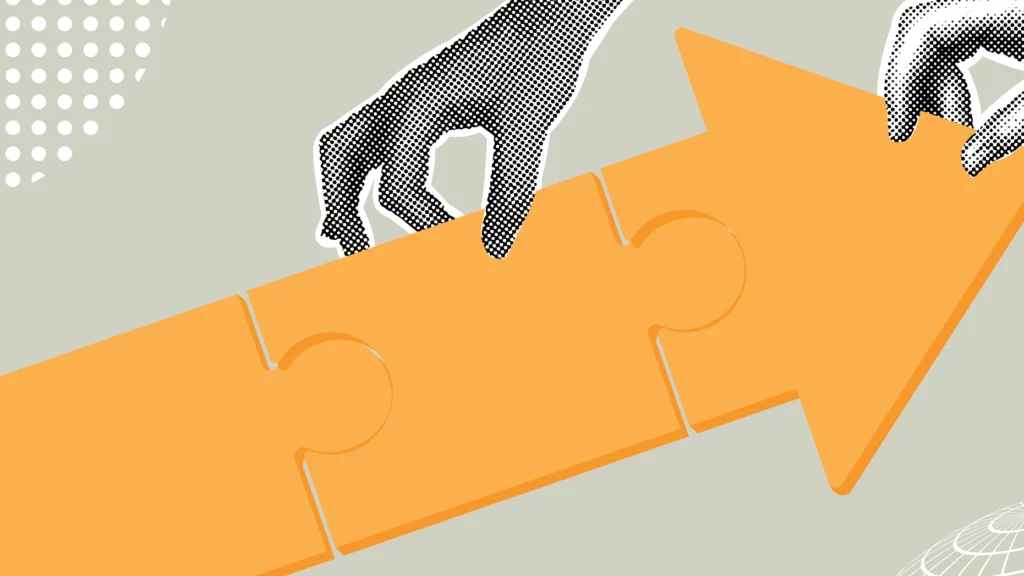Wer sich frühzeitig Gedanken über die Bedeutung seiner Forschung und den eigenen Kommunikationsstil macht, profitiert davon auch in seiner wissenschaftlichen Arbeit, sagt der Lernforscher Martin Storksdieck von der Oregon State University.
„Oft läuft die Kommunikation mit der Öffentlichkeit nur nebenher“
Herr Storksdieck, Sie haben kürzlich zusammen mit Ihrer Kollegin Julie Risien in einem Fachbeitrag das Konzept der „Impact Identities“ vorgestellt. Was verbirgt sich dahinter?
Im weitesten Sinne geht es darum, dass man sich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler nicht nur fragt: Was an meiner Forschung ist wichtig für meine Disziplin? Sondern auch: Was davon ist für die Öffentlichkeit relevant? Man soll sich also darüber bewusst werden, welchen Einfluss das, was man in seinem Beruf macht, auf die Gesellschaft hat und wie man es vermitteln könnte.
Machen sich darüber nicht alle Forschenden früher oder später Gedanken?
Nach meiner Erfahrung läuft die Kommunikation über die eigene Forschung mit der Öffentlichkeit oft nur nebenher und meist eher ungeplant. Wir – Julie Risien und ich – behaupten aber, dass es sehr lohnend sein kann, schon frühzeitig und gezielt über diese Fragen nachzudenken. So lässt sich schon zu Beginn der Karriere eine umfassende eigene Identität schaffen, die eben nicht nur fachliche Aspekte umfasst, sondern auch die Wissenschaftskommunikation von Anfang an mit einbezieht.

Wie entwickelt man eine solche Identität?
Man sollte natürlich immer von seiner Forschung ausgehen, denn die steht im Mittelpunkt. Die wichtigste Frage ist also: Welche Erkenntnisse bringen mein Fachgebiet voran, was interessiert meine Kolleginnen und Kollegen? Darüber hinaus sollte man sich aber auch fragen, welcher Aspekt der eigenen Forschung für die Öffentlichkeit interessant sein könnte, welche Art von „Outreach“ zur eigenen Persönlichkeit passt und zu den institutionellen Rahmenbedingungen, unter denen man arbeitet. Es geht also darum, welche Kapazitäten man hat, um neben der wissenschaftlichen Arbeit auch mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, und, ganz wichtig, welcher Kommunikationstyp man ist. Zieht es mich auf die Bühne, interagiere ich gern mit einem Publikum, oder möchte ich lieber im Hintergrund beratend tätig sein? Aus den Antworten auf all diese Fragen ergibt sich ein Bild darüber, wer ich bin und welchen Impact meine Arbeit hat – sowohl innerhalb meiner wissenschaftlichen Disziplin als auch in der Öffentlichkeit.
Sie schreiben, dass die Impact Identity sich idealerweise durch die ganze Karriere zieht. Können denn junge Forschende schon eine solche Identität aufbauen?
Ich glaube, dass auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sich bereits während der Promotion oder sogar während ihres Masterstudiums mit diesen Fragen befassen sollten. Zwar höre ich in Seminaren oft: Dafür sind wir noch nicht weit genug. Aber ich halte dagegen, dass es in jedem Stadium der Karriere hilfreich ist, seine Forschung genau zu verorten, sowohl fachlich als auch in der Gesellschaft. Es ist meiner Meinung nach auch wichtig, dass junge Forschende sich sozusagen selbst die Erlaubnis geben, ihre Forschung in der Öffentlichkeit zu vertreten, und das nicht nur den alten Platzhirschen überlassen. Immerhin wird die meiste tatsächliche Arbeit von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern geleistet. Das ergäbe daher auch ein realistischeres Bild davon, wie die Forschung wirklich ist.
Inwiefern profitieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon?
Ein Beispiel: Forschende brauchen für diverse Gelegenheiten sogenannte Kurzlebensläufe von nicht mehr als 200 Wörtern. Meistens klingen die bei jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern alle gleich. Es wird schlicht aufgelistet, welche Stationen der Ausbildung sie bislang durchlaufen haben und woran sie aktuell forschen. Da sagen wir: Denkt breiter, entwickelt eine eigene Identität, macht deutlich, wofür Eure Forschung steht.
Haben Sie denn Belege dafür, ob dieses Vorgehen hilfreich ist?
Wir haben erste Daten, die zeigen, dass Forschenden ihre Arbeit mehr Spaß macht und sie motivierter sind, wenn sie selbst den größeren Rahmen sehen. Unserer Erfahrung nach schreibt man auch bessere Forschungsanträge, wenn man seine Impact Identity klar formulieren kann. Denn auch bei so einem Antrag muss man auf den ersten Seiten deutlich machen, warum die Forschung wichtig ist. Und drittens sprechen unsere bisherigen Erfahrungen dafür, dass solche Impact Identities Forschenden helfen können, ihre fachliche Arbeit und ihre Wissenschaftskommunikation besser zu vereinbaren. Es gibt ja mitunter das Phänomen, dass Forschende in die Wissenschaftskommunikation wechseln, weil ihnen dieser Aspekt in ihrer Arbeit zu kurz kommt. Wenn sie aber eine Identität als Forscherin oder Forscher haben, die das explizit mit einschließt, bleiben sie eher in der Wissenschaft.
Wie kann man als Nachwuchsforscherin oder Nachwuchsforscher wissen, welche Kommunikationsaktivitäten einem liegen?
Am besten ist es natürlich, wenn man auf professionelle Unterstützung zurückgreifen kann. Ich habe mich selbst viel mit Netzwerken beschäftigt, die Forschende mit erfahrenen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren zusammenbringen. So war ich etwa Forschungsdirektor beim „Portal to the Public“, in dem mehr als 50 Wissenschaftsmuseen, Science-Center, Zoos und andere Einrichtungen jungen Forschenden anbieten zu kooperieren und ihnen verschiedene Möglichkeiten der Beteiligung aufzeigen. Ein anderes positives Beispiel sind die „Astronomy Ambassadors“, ein Programm für Nachwuchsforschende in der Astronomie, die durch Workshops, ein Mentorenprogramm und Online-Ressourcen bei ihren Kommunikationsbemühungen unterstützt werden. In Deutschland sind solche Angebote noch rar gesät. Es lohnt sich aber immer, bei der eigenen Institution oder Hochschule nachzufragen, welche Unterstützung sie in Sachen Kommunikation mit der Öffentlichkeit leisten können.
Wie nehmen Sie die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation für Forschende in den USA und in Deutschland wahr?
In beiden Ländern passiert gerade viel. Die Idee, dass Forschende selbst in der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen müssen, findet immer stärkere Verbreitung. Die National Science Foundation – wenn man so möchte, das amerikanische Gegenstück zur DFG – ist dazu übergegangen, bei der Bewertung von Forschungsanträgen nicht nur den „intellectual merit“ zu bewerten, also die fachliche Qualität eines Projekts, sondern auch offiziell gleichberechtigt dazu das Kriterium der „broader impacts“. Dabei geht es darum, welchen Wert die Forschung für die Gesellschaft hat, welche Auswirkungen sie haben wird. Nur wenn beide Kriterien positiv bewertet werden, gibt es Fördermittel.
Aber nicht jede Forschung hat ja einen unmittelbaren Nutzen für die Gesellschaft?
Sicherlich ist es bei manchen Forschungsvorhaben schwierig, einen anderen Nutzen zu benennen als den reinen Erkenntnisgewinn. Es wird aber tatsächlich in der Begutachtung nicht gern gesehen, wenn sozusagen die fachlichen Inhalte als einziges Argument für „broader impacts“ herhalten müssen. Es gibt meist auch in der Grundlagenforschung andere Möglichkeiten, den Nutzen herauszustellen. Eine Option ist es, auf wirtschaftliche Anwendungen hinzuweisen, etwa zu erwartende Patente, eine effizientere oder nachhaltigere Produktion und so weiter. Eine andere Variante ist es, Kommunikationsprojekte mit zu beantragen. Dann liegt der Impact beispielsweise darin, Materialien für den Schulunterricht zu entwickeln, die eigene Forschung der Öffentlichkeit verständlich zu machen oder benachteiligte Zielgruppen mit Kommunikationsaktivitäten anzusprechen.
Womit beschäftigen Sie sich sonst derzeit noch?
Wir widmen uns allen Fragen rund um die Vermittlung von Wissenschaft – sowohl in institutionalisierter Form wie im Schulunterricht oder dem Studium als auch im Alltag. So arbeiten wir unter anderem daran, wie man den Austausch mit der Öffentlichkeit besser evaluieren, also den tatsächlichen Impact erfassen kann. Hier konzentrieren wir uns aktuell darauf, die Reaktion des Publikums unmittelbar während einer Veranstaltung zu messen, also zum Beispiel während eines öffentlichen Vortrags oder eines Science-Cafés. Aber auch die Evaluation der Lehre an Universitäten gehört zu unserem Arbeitsgebiet, denn die Vermittlung von Wissenschaft muss auch dort auf ein besseres empirisches Fundament gestellt werden. Ich selbst forsche derzeit unter anderem zu Guerilla Science, genauer zu Pop-up-Wissensformaten, die etwa auf künstlerischen Veranstaltungen wie Konzerten eingebunden werden – und zur Frage, ob man damit neue Zielgruppen erreicht.
Gibt es schon Ergebnisse?
Kurz gesagt: Wenn man ein Format schafft, das tatsächlich Kunst und Wissenschaft vereint, dann kann man mit Guerilla Science auch Leute ansprechen, die sonst nicht in ein Museum oder zu einer wissenschaftlichen Informationsveranstaltung kommen würden. Es muss aber wirklich eine neue, interessante Form der Vermittlung sein. Ist es lediglich ein altes Format im neuen Gewand, zum Beispiel im Grunde ein klassischer Vortrag in ungewohnter Umgebung, funktioniert das nicht. Man erreicht dann wieder nur die Leute, die sich eh für Wissenschaft interessieren. Für ein wissenschaftsfernes Publikum braucht es eher spielerische und kreative Herangehensweisen, es darf sich auf keinen Fall wie Schulunterricht anfühlen.
Die Studie