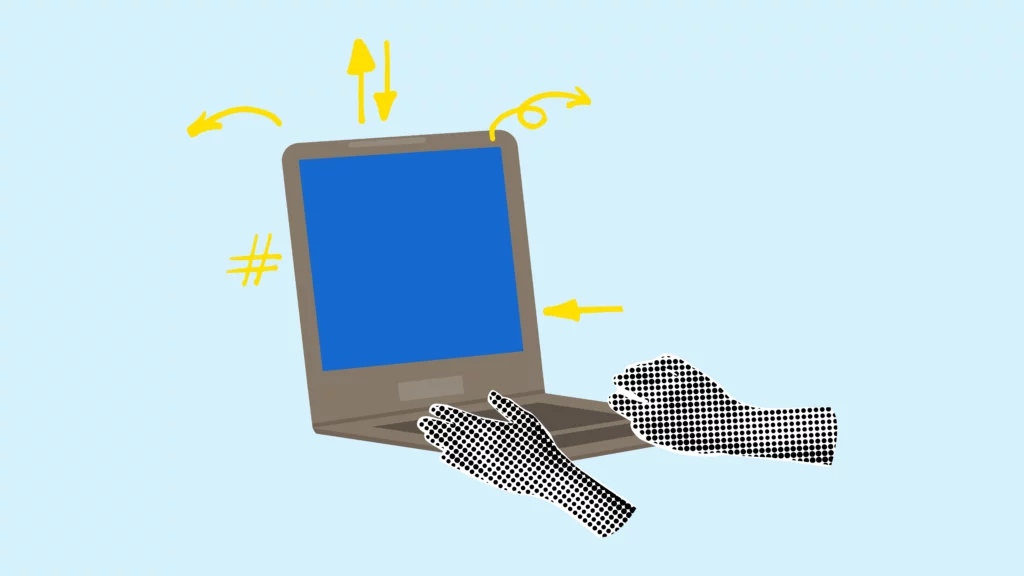Was können Geistes- und Sozialwissenschaften in der Diskussion um die Corona-Pandemie beisteuern? Ein Interview mit dem Soziologen und Politikwissenschaftler Floris Biskamp von der Universität Tübingen.
„Für eine seriöse Einordnung ist es noch zu früh“
Herr Biskamp, zu Beginn der Corona-Krise waren in der Öffentlichkeit kaum andere wissenschaftliche Stimmen zu vernehmen als medizinische oder epidemiologische. Warum haben Geistes- und Sozialwissenschaften sich so spät zu Wort gemeldet?
Es liegt einfach in der Natur dieser Krise, dass es in ihr sehr stark auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse ankommt. Ohne Wissen über das neue Virus kann man schlicht nicht entscheiden und bewerten, welche politischen Maßnahmen angemessen sind und welche nicht. Ich selbst habe mich daher zu Beginn der Epidemie auch sehr lange nur für die medizinischen Aspekte interessiert. Denn auch für einen politologischen Blick darauf, was gerade in unserem Land passiert, braucht man medizinisches Wissen darüber, wie bedrohlich die neue Krankheit ist und über welche Mechanismen sie sich ausbreitet. Man könnte andererseits auch zugespitzt sagen: Aus politikwissenschaftlicher Sicht ist die Krise bislang nicht sehr interessant, weil noch gar keine Politik stattgefunden hat.

Was meinen Sie damit?
Es wurden zwar so weitreichende politische Maßnahmen beschlossen wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik – teils auf unklarer Rechtsgrundlage. Das alles kam aber ohne öffentlich sichtbare politische Konflikte zustande. Es gab hier und da mal Reibereien, ob man die Schulen ein paar Tage früher oder später schließt oder ob es eine Kontakt- oder doch besser eine Ausgangssperre werden soll. Aber alles in allem wurden die Beschränkungen des öffentlichen Lebens von einem breiten Konsens der politischen Entscheiderinnen und Entscheider getragen. Wenn man Politik als Streit um verschiedene Positionen und Interessen begreift, dann haben wir in den letzten Wochen sozusagen eine „Politik ohne Politik“ erlebt.
Könnte gerade das nicht aus politikwissenschaftlicher Sicht bedenklich sein, selbst wenn man die Maßnahmen befürwortet?
Es gab gute Gründe für diesen breiten Konsens. Spätestens als man die Bilder aus den Intensivstationen in Norditalien gesehen und die Berichte der Ärztinnen und Ärzte dort gehört hatte, war vielen klar: Wir müssen unbedingt verhindern, dass das bei uns passiert. Und abseits der Bilder haben ja wissenschaftliche Expertinnen und Experten ebenfalls bestätigt, dass auch in Deutschland viele Leben auf dem Spiel stehen und ein Kollaps unseres Gesundheitssystems möglich ist. Deshalb ist die Akzeptanz der Maßnahmen auch unter kritischen Geistern groß, die Verordnungen werden von den allermeisten als zwingend notwendig angesehen. Dem würde ich übrigens zustimmen.
Ein weiterer Aspekt ist, dass die Politik schnell Hilfsprogramme aufgelegt hat, damit weniger Existenzen von Ladenschließungen und Auftragseinbrüchen bedroht sind. Das nahm Kritikerinnen und Kritikern den Wind aus den Segeln. Und darüber hinaus wurde schnell klar: Egal, welche Strategie man künftig zur Bekämpfung des Virus verfolgt – die radikalen Distanzierungsmaßnahmen waren in jedem Fall zunächst nötig, um nicht von der Epidemie überrollt zu werden, sondern das weitere Vorgehen in Ruhe planen zu können.
Das heißt, eine Gegenperspektive fehlt im Wesentlichen deshalb, weil alle mit dem Krisenmanagement der Regierung einverstanden sind?
Sicherlich waren nicht alle von Anfang an mit all diesen Maßnahmen einverstanden, weil die von der Pandemie ausgehende Gefahr nicht allen direkt klar war – sie wurde ja auch von staatlichen Autoritäten noch Ende Februar eher kleingeredet. Aber zum einen wurde dann das Bedrohungsszenario immer deutlicher, zum anderen wurden die Maßnahmen ja nach und nach eingeführt. Man begann mit der Absage von Großveranstaltungen und kulturellen Events, was bei einer Infektionskrankheit leicht nachvollziehbar ist. Dann kamen sukzessive weitere Maßnahmen. So konnte sich die Zustimmung gewissermaßen im Gleichschritt mit der Verschärfung der Politik aufbauen. Erleichtert wird die Akzeptanz wohl dadurch, dass das Infektionsschutzgesetz, das die rechtliche Grundlage bildet, weithin unbekannt ist. Selbst in der Rechtswissenschaft fand es bis vor kurzem kaum Beachtung. Entsprechend gibt es auch nur ansatzweise informierte Debatten darum, ob das Gesetz die Maßnahmen überhaupt deckt.
Die Stimmen, die ein rasches Ende der Beschränkungen fordern – oder zumindest eine Diskussion darüber – wurden in den letzten zwei Wochen lauter. Ist die Politik nun zurück?
Es werden zumindest immer mehr Veröffentlichungen lanciert, in denen die Frage gestellt wird, wann man wie einen „Ausstieg“ aus den Beschränkungen des öffentlichen Lebens finden kann. Je näher der 19. April rückt, der von der Bundesregierung als frühestmögliches Ende der Maßnahmen ausgerufen wurde, desto intensiver wird diese Diskussion geführt werden. Will man dabei seriös bleiben, muss man jedoch unzulässige Vereinfachungen vermeiden. Es ist zum Beispiel nicht so, dass wir uns direkt zwischen den Profitinteressen der Wirtschaft und der Schonung von Menschenleben entscheiden könnten. Oft machen gerade Befürworterinnen und Befürworter der aktuellen Maßnahmen einen solchen Gegensatz auf. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht greift dies aber zu kurz.
Warum?
Weil auch durch einen ausgedehnten wirtschaftlichen Abschwung oder sogar eine Depression – also ein Verharren der wirtschaftlichen Aktivität auf niedrigerem Niveau – viele Menschen sterben würden. Denn wir wissen, dass Armut die Lebenserwartung verkürzt: In Deutschland sterben Menschen in der untersten Einkommensgruppe etwa fünf Jahre früher als die mit dem höchsten Einkommen. Andersherum scheint auch die Vorstellung absurd, die Wirtschaft könnte normal operieren, wenn sich die Krankheit wieder schneller verbreitet, es tausende kritische Verläufe gibt und das Gesundheitssystem überwältigt wird. Wenn es zu Situationen wie denen in Bergamo, Straßburg oder New York kommt, kann es keine gesellschaftliche oder wirtschaftliche Normalität geben.
Welche Expertise könnten denn Politologinnen und Politologen in der aktuellen Situation beisteuern?
Ganz allgemein geht es in der Politikwissenschaft oft um die Analyse politischer Prozesse und Machtverhältnisse: Welche gesellschaftlichen Akteure haben welche Interessen? Über welche Machtressourcen verfügen sie zu ihrer Durchsetzung? Und wessen Interessen berücksichtigen staatliche Institutionen bei der Entscheidungsfindung? Hier wird es in den nächsten Wochen sicher viel zu analysieren geben. Aber darüber hinaus können auch die verschiedenen politikwissenschaftlichen Teildisziplinen ihre je eigenen Beiträge leisten. Der Teilbereich der normativen politischen Theorie kann beispielsweise zur Beantwortung der Fragen beitragen, die auch in der Medizinethik diskutiert werden: Welche ethischen Güter muss der Staat bei seiner Entscheidungsfindung wie gegeneinander abwägen und berücksichtigen? Welche Pflichten und Rechte hat er gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern?
Welche Teildisziplinen sind noch von Bedeutung?
Ein weiterer in der aktuellen Krise relevanter politikwissenschaftlicher Forschungsstrang beschäftigt sich mit dem Ausnahmezustand. Dort wird gefragt, was passiert, wenn die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger – meist mit dem Argument, das Überleben von Menschen oder des Staates sichern zu wollen – rechtsstaatliche Errungenschaften aussetzen. In so einer Situation befinden wir uns ja gerade. In der Forschung ging man dabei in den letzten Jahren meist davon aus, dass militärische Konflikte oder Terrorismus den Anlass für einen solchen Ausnahmezustand bilden und nicht eine ansteckende Krankheit. Meine Vermutung wäre, dass bei der aktuellen Krise die grundsätzlich sehr kritische Betrachtungsweise dieses Phänomens wohl etwas abgemildert werden dürfte und die politischen Entscheidungen mit etwas mehr Verständnis für die Regierenden diskutiert werden.
Wie ordnen Sie selbst als Politikwissenschaftler die Situation ein?
Sicher ist, dass es sich nicht nur medizinisch, sondern auch gesellschaftlich und politisch um eine absolute Ausnahmesituation handelt, die wohl niemand auch nur annähernd erwartet hätte. Für eine seriöse Einordnung ist es meines Erachtens zu früh. Das hängt von zu vielen Faktoren ab, die wir noch nicht kennen. Das sind zum einen medizinische Fragen, zum anderen sind es aber auch die weiteren politischen Entscheidungen. In einem Jahr beantworte ich die Frage aber gerne.
Wie geht es nach der Krise weiter?
Das dürfte sehr stark davon abhängen, wie die Krise selbst verläuft. Es sind ja leider verschiedene Katastrophenszenarien realistisch, die durchaus zu grundlegenden gesellschaftlichen und politischen Transformationen führen könnten. Eine Renationalisierung der Wirtschaft und eine stärkere Rolle des Staates scheinen realistisch. Aber es muss auch keine Katastrophe kommen. Einige Dinge wird man sich jedoch mit etwas Abstand mit Sicherheit noch einmal genauer ansehen müssen: Wie kann es sein, dass viele ostasiatische Länder die Erkrankung frühzeitig sehr ernst genommen haben, auch die WHO schon früh vor ihr gewarnt hat, aber in Europa und Nordamerika lange Zeit der Kopf in den Sand gesteckt wurde? Meiner Meinung nach liegt der Verdacht nahe, dass das ein Ausdruck westlich-postkolonialer Überheblichkeit ist, weil man glaubt, unser medizinisches System müsse dem asiatischer Länder weit überlegen sein. Das Argument konnte man zu Beginn der Krise auch noch häufig in Talkshows hören. Europa hat sich für weniger verwundbar gehalten. Und man wird fragen müssen: Wer hat politisch wann zu langsam reagiert? Warum waren die Gesundheitsämter etwa in den ersten Wochen damit überfordert, Menschen Auskunft zu geben? Da gibt es noch einiges aufzuarbeiten.