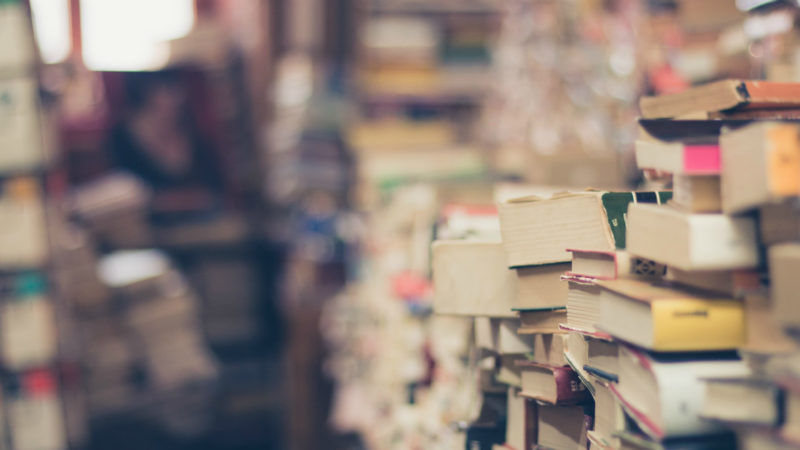Wissenschaftskommunikation beim Wacken-Festival? Benjamin Winkel und Gyula Józsa vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie beweisen, dass Wissenschaft auch mitten im Festivaltrubel funktioniert. Plötzlich standen Weltraumthemen auf der Agenda von Metal-Fans.
„Dunkelheit ist ein Metal-Thema“
Wacken ist laut, intensiv, hell – warum war das Heavy-Metal Festival ein geeigneter Ort, um über Forschung zu sprechen?

Benjamin Winkel: Unser Hauptziel war, die Dark and Quiet Skies Initiative zu thematisieren. Es geht dabei um die Reduzierung von Lichtverschmutzung und den Schutz des Nachthimmels für die Astronomie, sowie den „leisen Himmel“, darunter verstehen wir den Schutz der Radioastronomie. Wir dachten, das passt gut zu Wacken, da die Leute dort ja eher dunkelheitsaffin sind.
Gyula Józsa: Genau, die Dunkelheit ist der Aufhänger, denn Dunkelheit ist ein Metal-Thema, sozusagen eine Metal-Signalfarbe. Wir hofften, so die Besucher und Besucherinnen für Lichtverschmutzung zu sensibilisieren. Menschen sollen eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Wacken sind allerdings sieben Tage extrem viel Lichtverschmutzung, doch kann man das dem Spaß gegenüberstellen, den die Leute haben. Es geht darum, Licht bewusst einzusetzen. Und dafür ist Wacken ein gutes Beispiel.
2025 gab es zum ersten Mal auf dem Festivalgelände ein „Spacecamp“. Wie kann man sich das vorstellen?
Winkel: Das Spacecamp war ein abgetrennter Bereich, schon von weitem sichtbar. Wie viele Festivalbereiche war er mit Bauzäunen umgeben, an denen Banner angebracht waren, sodass sofort erkennbar war, dass es um den Weltraum ging. Der Bereich lag neben Fressbuden, an denen die Besucher*innen vorbeikamen, wenn sie zu Konzerten gingen. Dadurch gab es viel Durchgangsverkehr. Je länger wir vor Ort waren, desto mehr sprach sich das herum. Manchmal, wenn es stark zu regnen begann, kamen Leute auch einfach rein, um einen trockenen Ort zu finden.

Hat die Festivalatmosphäre eher geholfen oder es erschwert, über ein wissenschaftliches Thema ins Gespräch zu kommen?
Józsa: Absolut geholfen, kann ich nur sagen. Wir haben dadurch ein ganz anderes Publikum erreicht. Es waren nicht nur Leute mit akademischem Hintergrund, die sowieso zu wissenschaftlichen Vorträgen kommen. Wir haben Menschen aus allen Schichten erreicht, die sich sonst nicht mit Wissenschaft beschäftigen und die viele großartige Fragen hatten.
Wie haben Sie Ihren Stand konzipiert?
Winkel: Es gab ein großes Zelt, in dem alle Partnerinstitutionen vertreten waren: wir – also die Astronomie –, Vertreter*innen der Fraunhofer Gesellschaft und von der deutschen Raumfahrtindustrie, sowie viele Studierende von Universitäten. Wir haben erklärt, was Lichtschutz für Nicht-Astronom*innen bedeutet, von Auswirkungen auf die Tierwelt bis zu gesundheitlichen Effekten für Menschen. Besonders beliebt waren Formate wie „Meet the Scientist“ oder „Meet the Industry“, bei denen Besucher*innen spontan Fragen zu astronomischen Themen – und Außerirdischen – stellen konnten.
Józsa: Im Zelt konnten wir unsere Projektstände aufbauen, mit Demonstrationsobjekten und Plakaten. Wir haben zum Beispiel Lampen gezeigt, die man durch eine Linienfolie anschauen konnte. Dadurch wird das Spektrum der Lampe sichtbar, also das Licht aufgeteilt in verschiedene Farben. Wir haben auch ein Spektrometer aufgestellt, dass das Radiospektrum der Umgebung zeigt – also unter anderem Mobilfunksender, die Bluetoothsignale der Smartphones und vieles mehr. Damit konnte man das Licht der Lampen mit Radiostrahlung vergleichen und erklären, wie wir die Radioastronomie schützen.
Mit unseren Roll-ups haben wir gezeigt, wie man selbst aktiv werden und Lichtschutz betreiben kann. Und wie wichtig das für die Umwelt ist. Es ist uns ein persönliches Anliegen, fachübergreifend den Umweltschutzaspekt darzulegen und den Leuten nahezubringen, wie man Licht sinnvoll nutzt.
Wie kam das bei den Besucher*innen an?
Winkel: Das Zelt und unsere Vorträge wurden sehr gut besucht. Der Weltraum ist ohnehin ein universell ansprechendes Thema, das viele spannend finden.
Józsa: Und speziell die Astronomie ist natürlich immer ein sehr guter Aufhänger. Das interessiert viele. Und wir konnten dann die Inhalte transportieren, die uns wichtig sind – nicht nur Aliens, sondern tatsächlich, wie grundlegend Astronomie für die Gesellschaft war und ist.
Wie bei einem Musikfestival üblich, haben Sie auch Sprechgesänge mit den Besucher*innen gemacht.
Józsa: Es handelte sich nicht um normale Vorträge, sondern sie wurden in Sprache und Ausdrucksform an das Publikum angepasst. Wir haben die Leute – angelehnt an die Musik – dazu animiert, bei Sprechgesängen mitzumachen. Damit wollten wir zum Ausdruck bringen, wie wichtig die Nacht ist. Die Besucherinnen und Besucher wollten unterhalten werden und konnten auch mal einen kräftigen Ausdruck vertragen. Diesem Wunsch sind wir nachgekommen und haben unsere Inhalte entsprechend laut transportiert.
Wie hat die wissenschaftliche Community die Präsenz beim Festival aufgenommen?
Winkel: Natürlich gab es Leute, die vorher skeptisch waren. Manche Kolleg*innen haben erstmal die Nase gerümpft und gesagt: „Wacken? Was soll das denn?“ Aber das ist einfach Unwissenheit. Vorab gab es auch einen Kommentar bei Social Media, dass wir wahrscheinlich nur selbst zum Festival gehen wollten. Das könnte kaum weiter von der Wahrheit entfernt sein.
Unsere Kolleg*innen aus der Industrie und von der Fraunhofer Gesellschaft investierten enorm viel Zeit in die Vorbereitung. Selbst für uns, die wir lediglich einen Stand betreuten, war der Aufwand hoch. Während des Festivals waren wir täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr vor Ort. Meistens blieben wir im Zelt und machten nur kurze Pausen zum Essen. Nach sieben Tagen war das durchaus anstrengend.
Wie kam es zu der Idee, Wissenschaft beim Wacken-Festival auf die Bühne zu bringen?
Winkel: Tatsächlich sind wir über Umwege reingekommen. Das Wacken-Team hatte Fraunhofer Aviation and Space kontaktiert. Jedes Jahr gibt es bei Wacken ein anderes Motto, und dieses Mal sollte es um den Weltraum gehen. Meine Frau, die bei Fraunhofer arbeitet, hat dem Wacken-Team erzählt: „Übrigens, die Leute vom Radioteleskop machen viel mit Astronomie – wollt ihr die nicht auch anfragen?“ Und dann kam eins zum anderen. Wir hatten schon 2024 mit der Planung begonnen. Viel wurde vom Fraunhofer-Office und vom Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) organisiert.

Welche Kosten sind bei der Organisation auf Sie zugekommen?
Winkel: Finanziell war das eine Herausforderung. Wacken konnte uns nur anbieten, die Ausstellung zum Selbstkostenpreis umzusetzen, da sie selbst das notwendige Equipment einkaufen müssen. Normalerweise zahlen Unternehmen für so einen Stand mehrere Zehntausend Euro. Für uns war es schwierig, das Geld aufzutreiben, da in unserem Institut kein großes Budget für solche Aktivitäten vorhanden ist. Wir mussten also weitere Astro-Institute anschreiben, um das stemmen zu können.
Was für ein Fazit ziehen Sie aus dem Spacecamp?
Józsa: Ich denke, das ist tatsächlich ein Format, das sehr erfolgversprechend ist. Ich schätze, dass es auch für andere Veranstalterinnen und Veranstalter interessant sein könnte, Wissenschaftskommunikation in Musikfestivals zu integrieren. Ein Musikfestival wie Wacken bringt man im ersten Moment nicht mit Wissenschaft in Verbindung. Das erzeugt einen irritierenden, aber netten Effekt. Für uns war es sehr lohnenswert. Ich würde es auf jeden Fall noch einmal machen.
Winkel: Mein persönliches Fazit ist, dass es Spaß gemacht hat. So anstrengend es auch war, hatten wir dort eine gute Zeit, weil die Community einfach super ist. Es gab keinen Ärger und keinen Müll, was ebenfalls bemerkenswert ist.
Könnte die positive Resonanz, die Sie bekommen haben, dazu führen, dass es in Zukunft mehr Budget für solche Veranstaltungen gibt?
Winkel: Ich kann mir gut vorstellen, dass es in Zukunft einfacher wird, weil wir gezeigt haben, dass es funktioniert und etwas bringt. Wacken hat positives Feedback bekommen. Viele Leute, die beim Spacecamp dabei waren, hoffen, dass es noch einmal stattfindet, weil sie so viel Spaß hatten. Ansonsten müssen wir uns überraschen lassen!