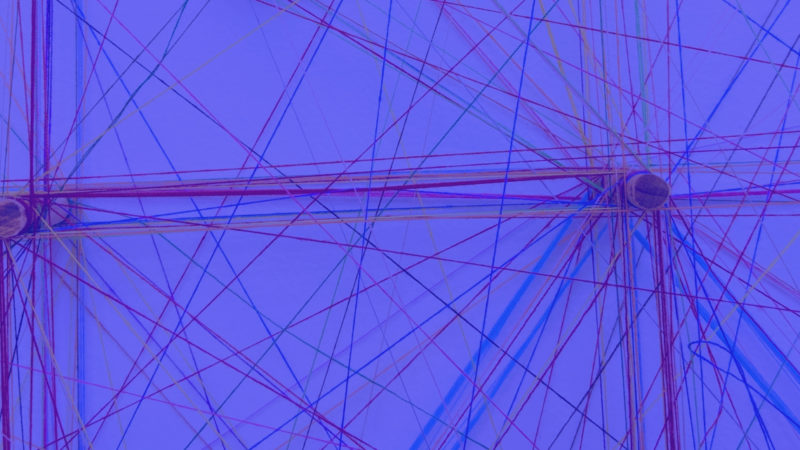Hinter dem ungewöhnlichen Begriff verbirgt sich die Idee, Unternehmer*innentum als soziales Handeln zu verstehen. Gastautor Steffen Farny erklärt, warum gemeinschaftliches Wirtschaften kein Idealismus ist, sondern ein realistisches und lohnenswertes Modell. Dafür müssen jedoch drei zentrale Bedingungen erfüllt sein.
Wie ‚Communicorns‘ die Unternehmenswelt neu denken
Einhörner, Zebras und jetzt „Communicorns“? Die Gründungswelt ist reich an kreativen Begriffserfindungen. Mit dem Begriff „Communicorn“ versuchen wir, eine Gruppe forschender Personen an der Leuphana Universität Lüneburg, diese bunte Welt mit einem Fokus auf gemeinschaftliches Unternehmertum zu erweitern.
„Communicorn“ steht für Community Unicorn. „Unicorn“ beschreibt Start-ups oder Unternehmen, die besonders schnell wachsen und enorme Bewertungen erzielen. Diesen Gedanken greift der Begriff auf, aber nicht im finanziellen Sinne. Uns geht es darum, wie wir möglichst stark in eine Community hineinwirken können – sozusagen „eine Milliarde Mehrwert“ schaffen.
Warum ist das wichtig?
Unternehmer*innentum zeichnet vor allem aus, in Problemen Chancen zu sehen und diese kreativ anzugehen. Das ist meist ausschließlich auf ökonomische Profite ausgerichtet. Aber wir können diesen Ansatz auch übersetzen, indem sich Gemeinschaften zusammentun, unternehmerisch agieren und gemeinschaftlich Lösungen entwickeln. Wenn lokale Gemeinschaften Probleme in ihrer Nachbarschaft angehen und nachhaltige Lösungen schaffen, steckt darin sehr viel Potenzial.1
Der lokale Bezug spielt dabei eine besondere Rolle, da Entrepreneurship immer einem sozio-ökologischen System entspringt. Dafür ist es zentral, dass die Akteur*innen sich kennen und dieselben Orte besuchen. In unserem Fall schaffen wir mit der Leuphana Social Innovation Community gemeinsam mit dem Lüneburger Gründungszentrum Utopia Räume und neue Anlässe für einen kreativen Austausch.
Ein Beispiel: die Communicorn Konferenz Mitte September 2025 an der Leuphana und im Stadtraum. Etwa 150 Gestaltungswillige kamen zusammen, um in Bereichen wie Jugend und Bildung, Ernährung und Landwirtschaft, kommunale Verwaltung oder Handwerk und Technik über Fragestellungen und gemeinschaftliche Lösungsansätze zu sprechen. Ko-kreativ erarbeiteten Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen gemeinsam Visionen einer lebenswerten Zukunft und wirkungsvollen Ideen. Ein Zukunftsbild für resiliente Ernährung beschrieb, wie gute Lebensmittel auf gesunden Böden entstehen, unter fairen Arbeitsbedingungen, in einem Rhythmus, der Natur- und Stoffkreisläufen folgt.
In Zukunftsmethoden-Workshops erlernten Teilnehmer*innen Methoden der kollaborativen Zusammenarbeit. Ein anderer Workshop entwickelte mithilfe von generativen Modellen kreative Szenarien für eine nachhaltige Wirtschaft im Jahr 2050. Erste Gruppen haben uns bereits rückgemeldet, dass sie sich zusammenschließen und weiter gemeinschaftlich vorangehen möchten. Das sind tolle Ergebnisse, die uns in unserer Arbeit bestärken – die Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis wirkt somit direkt in unserer Region.
Wie gelingen „Communicorns“?
Gute Beispiele für Communicorns aus der Region zeigt auch unser gleichnamiger Podcast. Entstanden aus der Idee, unseren Studierenden reale Fallbeispiele näherzubringen, beleuchten bisher acht Episoden, wie communitygetriebene Unternehmen funktionieren und welche Hürden es zu bewältigen gilt.
Erstens ist Humankapital wichtig, also die Ressourcen in der Gemeinschaft. Zweitens sind physische Orte entscheidend, an denen neue Ideen entstehen und gemeinschaftlich bearbeitet werden können. Und drittens braucht es gute Vorbilder in der Umgebung. 2
Wenn diese Faktoren gegeben sind, ist eine Kollaboration viel wahrscheinlicher erfolgreich, als wenn der Profit im Zentrum steht. Mit dem Podcast, der Konferenz sowie den anderen Aktivitäten der „Social Innovation Community“ möchten wir das hiesige Ökosystem in all diesen Faktoren stärken.
Ein berühmtes Beispiel für communitygetriebenes Unternehmertum ist der Fußballbundesligist FC St. Pauli. In einem kompetitiven Umfeld schafft es der Verein, mit einer genossenschaftlichen Logik erfolgreich zu sein. Vizepräsidentin Esin Rager spricht im Podcast darüber, wie die gemeinschaftsgetragene Finanzierung Fans zu Mitgestalter*innen macht. Es werden dabei nicht nur die demokratischen Strukturen gestärkt, sondern auch die wirtschaftliche Resilienz gefördert. Sie zeigt also, wie soziale Innovationen auch in scheinbar tradierten Systemen etabliert werden können. Die Community ist nicht Mittel zum Zweck, sondern konstitutiver Teil einer zukunftsorientierten Organisationsform.

Entscheidende Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg
Beispiele wie dieses zeigen eine neue Denkweise, bei der gemeinsames Handeln über der Gewinnmaximierung steht. Das kann aber nur nachhaltig wirken, wenn auch die Wirtschaftlichkeit stimmt. Für den ökonomischen Erfolg sozialer Unternehmen sind drei Pfeiler zentral34:
Haltung, also der Wille, inklusiv zu denken und partizipativ zu handeln. Ebenso die Arbeitskultur, also partizipative Prozesse, um Entscheidungen effektiv zu treffen, bei denen sich alle Mitarbeitenden gehört und mitgenommen fühlen. Und zuletzt sind Strukturen wichtig, Räume für Feedback, klare Regeln, um Konflikte zu lösen und Möglichkeiten, sich zu beteiligen.
Dieses Mindset in bestehende Unternehmen zu integrieren, ist natürlich schwieriger, als es bei einer Neugründung zu etablieren. Mittlerweile wissen wir, dass es in Zeiten multipler Krisen aber schlichtweg ökonomisch notwendig ist. Uns begegnen immer wieder Unternehmen, die zunächst skeptisch sind. Sie haben Angst, soziales Unternehmer*innentum sei ineffizient und funktioniere im Alltag nicht.
Aber erste Analysen in unseren Forschungsprojekten zeigen: Sobald es echten Kontakt mit diesen Modellen gibt, verschwinden die Ängste. Unternehmen berichten dann von mehr psychologischer Sicherheit, besserer Zusammenarbeit, sogar von neuen Ideen.
Viele Unternehmen verändern Prozesse, weil sie denken: „Das fühlt sich richtig an.“ Aber sie wissen nicht genau, warum es klappt – oder warum nicht. Und genau da kommen wir ins Spiel.
Wir prüfen wissenschaftlich: Welche Faktoren tragen zum Erfolg bei? Was lässt sich übertragen? Außerdem kann die Wissenschaft Konzepte und Lösungen entwickeln, die eine Transformation positiv beeinflussen oder inspirieren.
Wichtig ist, man darf nicht nur an einer kleinen Stellschraube drehen. Es braucht immer die drei großen Schalter: Haltung, Kultur und Struktur. Nur dann gelingt die Transformation.
- Bacq, S., Hertel, C., & Lumpkin, G. T. (2022). Communities at the nexus of entrepreneurship and societal impact: A cross-disciplinary literature review. Journal of Business Venturing, 37(5), 106231. ↩︎
- Mitzinneck, B. C., Coenen, J., Noseleit, F., & Rupietta, C. (2024). Impact creation approaches of community-based enterprises: A configurational analysis of enabling conditions. Journal of Business Venturing, 39(6), 106420. ↩︎
- Farny, S., Kibler, E., Hai, S., & Landoni, P. (2019). Volunteer retention in prosocial venturing: The role of emotional connectivity. Entrepreneurship Theory and Practice, 43(6), 1094-1123. ↩︎
- Muñoz, P., Farny, S., Kibler, E., & Salmivaara, V. (2024). How founders harness tensions in hybrid venture development. Business & Society, 63(8), 1842-1886. ↩︎