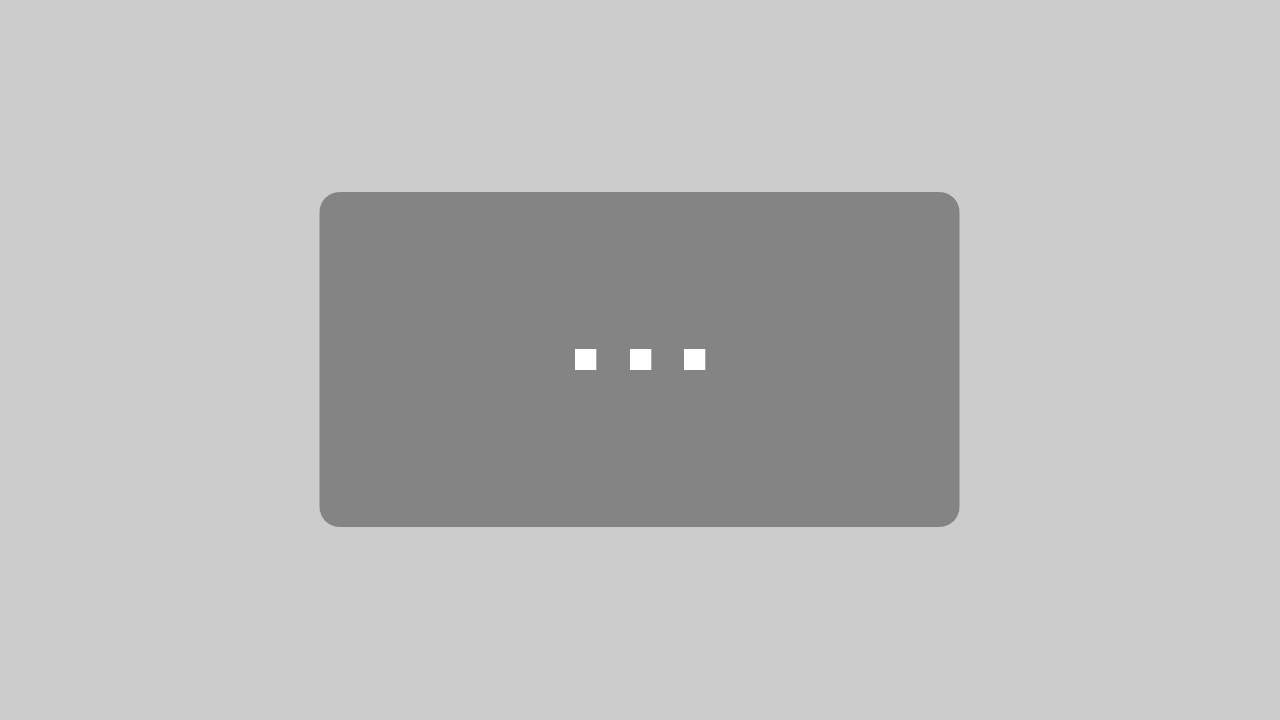Populismus nutzt Emotionen und Vereinfachungen. Kann die Wissenschaft dagegenhalten? Der Komplexitätsforscher Dirk Brockmann sagt: Ja, wenn sie klug kommuniziert.
Herr Brockmann – wie kommuniziert man klüger als der Populismus?
Herr Brockmann, Sie sind Komplexitätsforscher. Führt eine komplexere Welt dazu, dass Menschen sich ab einem bestimmten Punkt überfordert fühlen und umso schwerer zu erreichen sind?

Manchmal habe ich das Gefühl, das Problem ist nicht die Komplexität, sondern die Intensität. Die Menschen haben oft gar nicht mehr die Gelegenheit, über politische Situationen oder wissenschaftliche Themen wirklich nachzudenken, weil es ständig neue Eindrücke gibt.
Was dazukommt, ist, dass in der öffentlichen Kommunikation oft stark vereinfacht wird. Und dann entsteht eine Spannung, weil man spürt: Moment mal, das ist doch eigentlich viel komplizierter, darüber müsste man mal nachdenken. Im Kern glaube ich, dass Menschen über komplexe Sachen sehr wohl nachdenken können. Sie sind neugierig. Und sie brauchen Zeit, um sich mit komplexen Themen auseinanderzusetzen.
Ein praktisches Beispiel sind die Brandenburgischen Konzerte von Bach. Das ist wunderschöne, wenn auch komplizierte Musik. Wenn ich diese am Stück durchhöre, kann das überfordern. Alles auf einmal ist zu viel. Aber es ist nicht zu komplex. Ich sollte mir dafür einfach mehr Zeit nehmen.
Sie haben kürzlich Ihr Buch Survival of the Nettest veröffentlicht, indem Sie unterschiedliche komplexe Ökosysteme beschreiben – mit Symbiosen und Kooperationen zwischen Tier, Pflanze, Bakterien und Pilzen. Ein Vorbild für die Suche nach Antworten auf komplexe Fragen von heute?
Ja und zwar im Widerspruch zu dem weit verbreiteten Mantra, dass Wettstreit Innovation fördere. Was ich mit dem Buch zeigen will, ist: In der Natur ist dies nur ein Teil der Wahrheit. Wettbewerb spielt eine Rolle, etwa bei der Optimierung bestehender Prozesse oder Organismen. Das hat Darwin gut beschrieben. Aber neue Dinge entstehen in der Natur nicht durch Wettstreit, sondern fast ausschließlich durch Kooperation.
Innovation entsteht durch Verbindung, durch Zusammenspiel. Multizelluläres Leben, Bakterien und Photosynthese – das sind alles Prinzipien, die durch Kooperation entstanden sind und bis heute überdauert haben.
Das, was sich wirklich bewährt, entsteht nicht im Kampf, sondern im Miteinander. Wir sollten deshalb verstärkt auf Kooperation bauen, wenn wir Antworten auf heutige Fragen suchen.
Was bedeutet das für die Kommunikation mit und über Wissenschaft?
Man müsste überlegen, wie Diversität unter den Akteur*innen einen Vorteil bringen kann. Denn eine hohe Vielfalt schafft Chancen, dass ganz neue Ansätze entstehen.
Das lässt sich gut auf die Wissenschaftskommunikation übertragen. Wir sollten überlegen, Räume für Akteure zu schaffen, die Dinge anders machen und Mechanismen, die diese Vielfalt erhalten, auch wenn sie kurzfristig nicht immer den größten Erfolg bringen.
Interessanterweise gibt es in der Natur viele Systeme, die gerade bei hoher Konkurrenz eine hohe Diversität aufrechterhalten. Das scheint widersprüchlich, aber Korallenriffe sind zum Beispiel extrem artenreich, obwohl sie in sehr ressourcenarmen Meeren leben. Darwin hat sich darüber gewundert, weil er dachte, bei so viel Konkurrenz müsste die Vielfalt sinken.
Aktuell haben wir beispielsweise im Bereich der Social Media keine solche Vielfalt. Im Gegenteil. Es gibt nur wenige große Firmen, die den Markt dominieren. Wenn jetzt eine Krise passiert, ist das problematisch, weil es wenig Vielfalt gibt, um flexibel zu reagieren.
Die Corona-Pandemie war ein virologisches Problem, aber auch ein wirtschaftliches, kulturelles und medizinökonomisches. Kann man daraus etwas für die Art und Weise schließen, wie wir mit unterschiedlichen Expertisen bei der Behandlung eines Problems umgehen?
Schon nach einiger Zeit wurde deutlich, dass nicht allein die Expertisen von Virolog*innen zur Eindämmung der Pandemie gefragt sind. Sie verstehen das Virus an sich. Aber Epidemiolog*innen erforschen beispielsweise die Krankheitsverläufe oder Sozialwissenschaftler*innen analysieren, wie die Gesellschaft darauf reagiert.
Während der Pandemie wurde außerdem deutlich, dass viele Expert*innen Schwierigkeiten hatten, die Perspektiven der anderen Fachbereiche einzunehmen. Expert*innen fühlen sich in ihrem eigenen Fachgebiet oft besonders sicher und verlassen diesen vertrauten Raum nur ungern. Dadurch messen sie ihrem eigenen Bereich häufig eine übertriebene Bedeutung für das große Ganze bei.
Wichtig für die Kommunikation unter Expert*innen ist deshalb auch, dass es okay ist, „doof“ zu sein. Es ist völlig in Ordnung, mal eine Frage zu stellen, die vielleicht einfach oder naiv wirkt. Wenn sich niemand traut, offene Verständnisfragen zu stellen, macht dies den Austausch langsam und ineffizient. Dabei wäre es viel besser, mit einer Haltung wie der eines Kindes an die Sache heranzugehen. Richard Feynman, der Nobelpreisträger, hat das mal sehr schön gesagt: Wenn du der klügste Mensch im Raum bist, dann bist du im falschen Raum.
In solchen Konsortien mit Expert*innen aus verschiedenen Bereichen werden Personen ausgewählt, die in ihren Fachbereichen etabliert sind. Das klingt doch nach einer guten Strategie?
Das ist eher, als würde ich erfolgreiche Bundesligatrainer nehmen und aus ihnen die Nationalmannschaft zusammenstellen. Bei komplexen Problemen – wie einer Pandemie – kann es ein Nachteil sein, wenn vor allem etablierte Fachleute zum Zug kommen. Häufig liegt das Mindestalter solchen Gremien bei 40 oder 50 Jahren. Diese Personen bringen zwar Erfahrung und Überblick mit, sind aber bereits weniger flexibel im Denken und Handeln – und vor allem im Fragen. Die Art von „Fitness“, die Darwin meinte – also Anpassungsfähigkeit und Offenheit – zeigt sich zum Beispiel darin, ohne Scheu sagen zu können: „Davon habe ich keine Ahnung, könnt ihr mir das erklären?“ Gerade das fällt erfahreneren Menschen oft schwer.
Deshalb wäre es klug, bei solchen Herausforderungen ganz bewusst auch junge, unerfahrene Menschen einzubeziehen. Denn bei neuartigen Problemen wie einer Pandemie hilft Erfahrung nur bedingt. Es gibt schlicht keine Vergleichswerte. Natürlich ist es richtig, Expert*innen aus unterschiedlichen Fachrichtungen zusammenzubringen. Aber wenn man nur auf etablierte, bereits „gesättigte“ Köpfe setzt, verschenkt man viel Potenzial.
Sie haben sich während der Pandemie öffentlich in laufende Diskurse eingebracht. Wie erlebten Sie die Spannung zwischen sachlich-komplexer Kommunikation und politisierten beziehungsweise polarisierten Öffentlichkeiten? Was haben Sie daraus für Ihre heutige Kommunikation abgeleitet?
Für mich war die Pandemie ein äußerst lehrreicher Kommunikationsprozess. Gerade in Bezug auf die Spannung zwischen wissenschaftlicher Komplexität und öffentlicher Wahrnehmung. Es ging nicht nur um die bekannten Schlagzeilen, etwa „Lockdown-Macher“ in der Bild-Zeitung, sondern auch um grundlegende Erfahrungen mit der Öffentlichkeit.
Ein Schlüsselmoment war ein Auftritt in einer Talkshow. Dort sagte ich: „Wenn die gesamte Menschheit vier Wochen lang keine Kontakte hätte, wäre das Virus verschwunden.“ Das war natürlich ein Gedankenexperiment. Ich wollte verdeutlichen, dass sich das Virus ausschließlich über unsere Kontakte verbreitet, und dass wir als Gesellschaft aktiv beeinflussen können, wie stark es sich ausbreitet.
Ich dachte damals, das sei gut erklärt. Doch am nächsten Tag musste ich in einer Tageszeitung lesen: „RKI-Experte sagt: Pandemie in vier Wochen vorbei“. Das war mein erster großer Aha-Moment. Ich hatte verstanden: Auch gut erklärte Gedankenexperimente können aus dem Zusammenhang gerissen und missverstanden – oder sogar bewusst falsch dargestellt – werden. Das hat mich zunächst frustriert. Denn Gedankenexperimente sind ja ein wertvolles Werkzeug, um Zusammenhänge zu veranschaulichen. Ich habe gelernt: In öffentlichen Kommunikationsräumen muss man noch präziser und vorsichtiger formulieren.
Wie kann Wissenschaft mit dem weltweit zunehmenden politischen Populismus umgehen, welcher komplexer und faktenbasierter WissKomm diametral gegenübersteht?
Wir müssen mindestens genauso klug kommunizieren wie diejenigen, die bewusst einfache, emotional starke Botschaften setzen – nur eben mit dem Ziel, die Realität richtig abzubilden.
Ein berühmtes Beispiel ist die Bild-Schlagzeile „Wir sind Papst“. Emotional aufgeladen, extrem eingängig, identitätsstiftend, das muss man erstmal hinbekommen. Und in der Pandemie war es ähnlich. Begriffe wie „Lockdown-Macher“ funktionierten auf dieser simplen, affektiven Ebene und eben deshalb so gut. Dagegen hilft es nicht, komplexe Tabellen oder Klimakurven zu zeigen, die zwar inhaltlich korrekt, aber schwer zugänglich sind. Man könnte genauso gut chinesische Schriftzeichen zeigen. Die Information wäre da, aber sie erreicht niemanden.
Deshalb denke ich viel darüber nach, wie man wissenschaftliche Inhalte so kommuniziert, dass sie verständlich, einprägsam und trotzdem korrekt sind. Es geht darum, starke, wahre Bilder zu schaffen. Prägnant genug, dass sie sich nicht leicht verzerren lassen. Wenn man es schafft, solche klaren und gleichzeitig realitätsgetreuen Botschaften zu formulieren, dann hat man in diesem Kommunikationsspiel tatsächlich eine Chance.
Wie kann das gelingen?
Ich habe ehrlich gesagt kein Rezept dafür. Mir passiert das manchmal einfach aus Versehen, dass etwas, was ich sage, sehr wirksam ist. Ich erinnere mich an ein Interview bei Jung & Naiv, in dem Thilo Jung mich fragte, ob das politische Vorgehen in der zweiten Welle nicht wie Russisch Roulette sei. Und ich sagte spontan: Ja, nur dass alle Kammern mit Patronen gefüllt sind. Das war natürlich drastisch, hat für Lacher gesorgt und auch für viel Kritik. Aber, es hat funktioniert. Das Bild hat sich eingeprägt, weil es das Risiko auf sehr eindrückliche Weise sichtbar gemacht hat.
Hat eine faktenorientierte und komplexe, offene Debattenkultur auf lange Sicht überhaupt eine Chance gegen den Populismus, der Massen bewegt?
Ja, ich glaube schon. Aber wir müssen neue Wege finden. Denn wir wissen inzwischen: Reines Faktenvermitteln funktioniert nicht. Wenn Fakten jedoch mit Emotionen verknüpft werden, dann kann das sehr wohl etwas bewirken. Populist*innen arbeiten mit Propaganda. Das bedeutet: extreme Vereinfachung, eine klare Trennung in „wir“ und „die“, und eine starke Emotionalisierung. Wenn man die Verzerrung und das Schwarz-Weiß-Denken weglässt, aber die emotionale Kraft und eine vereinfachte Darstellung nutzt, ohne die Realität zu verfälschen, dann hätte man vielleicht etwas, das dagegenhalten kann.
Ich stelle mir manchmal vor, wie es wäre, wenn in Berlin Plakate hingen, die ganz einfach Größenverhältnisse sichtbar machen. Etwa, Steuerhinterziehung verursacht 100 Milliarden Euro Schaden pro Jahr – versus Sozialleistungsbetrug liegt bei 50 Millionen. Das ist ein Faktor von 2000. Das ließe sich visuell extrem verdeutlichen – ein riesiger Fleck versus ein winziger Punkt. Warum kämpfen wir also nicht dort, wo der größte Schaden entsteht? So etwas bleibt hängen.
Was mich auch stört, ist, wie entemotionalisiert Wissenschaft oft dargestellt wird. Dabei macht niemand diesen Job, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Es sind keine Roboter, die Daten zusammentragen, sondern Menschen mit Haltung und Motivation. Wenn wir das vermitteln könnten, ohne die Inhalte zu verlieren, würde Wissenschaft ganz anders wahrgenommen.
Wir brauchen Geschichten und Bilder, die hängen bleiben, ohne zu verfälschen. Nur dann hat faktenbasierte Aufklärung wirklich eine Chance.