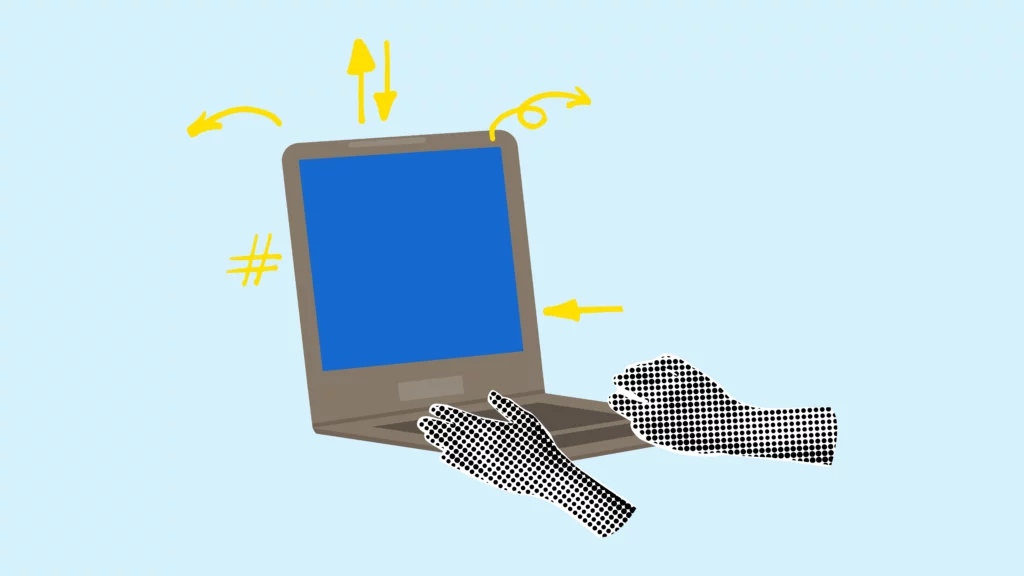Leistungsorientierte Mittelvergabe, Publikationsdruck und ein scharfer Wettbewerb um Drittmittel – Diese Mechanismen führten bei Forschenden dazu, Hypes hinterherzulaufen, anstatt originelle Forschung zu betreiben. Philosoph Torsten Wilholt im Gespräch über die Unabhängigkeit der Forschung und den Wert des Wissens.
Wie beeinflussen Wettbewerbsmechanismen die Freiheit der Forschung?
Herr Wilholt, Sie argumentieren dafür, dass die Forschungsfreiheit nicht absolut gilt. Darf der Staat also den Wissenschaftlern Weisungen erteilen?
Es spricht nichts prinzipiell dagegen und es würde die Kreativität der Wissenschaft nicht unbedingt zum Stillstand bringen. Aber man muss klug vorgehen, wenn man der Wissenschaft Themen vorgeben will. Man müsste dazu in Politik und Verwaltung

Kompetenzen aufbauen, die Bürger auf eine sinnvolle Weise einbinden und die Forschungshorizonte genau kennen. Es wäre abwegig, wenn die Politik zum Beispiel von der Wissenschaft verlangen würde, jetzt endlich schnell den Krebs zu besiegen, weil sie nicht weiß, welche wissenschaftlichen Ziele realistisch sind. Wissenschaft ist kein Wunschkonzert, in dem man Lösungen für seine Probleme bestellen kann. Diese Klugheitserwägungen sprechen dafür, nicht leichtfertig in wissenschaftliche Prozesse einzugreifen. Aber ich spreche hier nur als Philosoph und argumentiere aus der Sicht der Erkenntnistheorie und der politischen Philosophie. Was im Rahmen der deutschen Gesetze möglich und geboten ist, kann ich nicht besser beurteilen als andere Laien.
Hält sich die Politik an die philosophischen Kriterien, die Sie gerade genannt haben?
Sicher nicht immer. Wissenschaftspolitik wird oft genutzt, um auf anderen Politikfeldern zu punkten: etwa die Standort- oder die Umweltpolitik. In Niedersachsen hat die letzte rot-grüne Regierung zum Beispiel ein großes Förderprogramm für Nachhaltigkeitsforschung aufgelegt. Das schien mir zu sehr darauf zu setzen, kurzfristig Aufmerksamkeit zu erzeugen, und es führte wie üblich dazu, dass sich viele Forscher dachten: „Diese Fördermittel nehme ich mit.“ Ein positives Beispiel ist hingegen die Suche nach Gravitationswellen, die in Niedersachsen seit Jahrzehnten konsequent und mit langem Atem gefördert wurde und letztlich erfolgreich war.
Dieses Beispiel zeigt, dass erfolgreiche Forschung nicht immer nützlich sein muss.
Nein, es gehört zu einem erfüllten Leben, dass Menschen versuchen, die Welt zu verstehen. Und die Politik darf und sollte dieses Ziel fördern. Von Fortschritten im wissenschaftlichen Verständnis der Welt profitieren dann schnell gleich viele Generationen von Menschen. Ich würde daraus aber nicht schließen wollen, dass Wissen ein Wert an sich sei. Das ist eine philosophische Fehlkonstruktion. Man kann sich jede Menge Wissen denken, das uninteressant ist. Und man darf auch immer fragen, für wen eine bestimmte Art von Wissen wichtig ist und ob es wichtig genug ist, um die Investitionen zu rechtfertigen. Wissen zu generieren ist keine pauschale Begründung für Forschungsförderung und Forschungsfreiheit.
Wie steht es Ihrer Ansicht nach um die Forschungsfreiheit in Deutschland?
Es gibt nach wie vor große Freiräume, aber das unterscheidet sich von Fach zu Fach. In manchen Disziplinen braucht man viele Ressourcen, um forschen zu können. Da ist die individuelle Freiheit kleiner. In der Philosophie hingegen ist sie ziemlich groß. Eine andere Frage ist aber, wie Wissenschaftler ihre Freiheit nutzen – und hier sehe ich Besorgnis erregende Veränderungen. Man kann sie unter dem Stichwort künstliche Wettbewerbsmechanismen zusammenfassen: die leistungsorientierte Mittelvergabe, der Druck in hochrangigen Fachjournalen zu publizieren und der scharfe Wettbewerb um Drittmittel. Das alles setzt Anreize, Hypes hinterherzulaufen, und die Wissenschaft nimmt diese Arbeitsumstände immer mehr als gegebene Tatsache hin. Dabei sollte Forschungsfreiheit eine lebendige Vielfalt von Ansätzen und einen munteren Austausch von Kritik ermöglichen, denn das ist das einzige, was gegen Scheuklappen und Tunnelblick hilft.
Sie sehen in den aktuellen Entwicklungen also keine Einschränkung der Forschungsfreiheit, sondern nur falsche Anreize?
Ja. Unfrei wäre ein Wissenschaftler, wenn er gar keine Chance hätte, seine Arbeit zu finanzieren. Aber in Deutschland setzt die Politik eher positive Anreize, wenn sie ein Förderprogramm an ein bestimmtes Thema knüpft. Wissenschaftler können sich darauf einlassen, aber sie haben zumeist noch andere Möglichkeiten, Geld für ihre Forschung aufzutreiben.
Auch wenn die Industrie Hörsäle und Lehrstühle finanziert?
Die Universitäten sind nicht gezwungen, die Angebote anzunehmen. Sie sind allerdings verlockend, weil der Hochschuletat knapp bemessen ist. Diese Knappheit scheint mir politisch gewollt zu sein, um Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern.
Es gibt inzwischen einige Ansätze, um die Auswüchse des Wettbewerbs und des Publikationsdrucks zu mildern. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft lässt bei Anträgen zum Beispiel nur noch Publikationslisten mit fünf Fachartikeln zu. Und Berufungskommissionen achten stärker darauf, die Kandidaten nicht nur nach einfachen Kennzahlen wie der Zitationshäufigkeit zu beurteilen.
Es wird Zeit brauchen, diese Ideen durchzusetzen. Selbst wenn sich einige Berufungskommissionen mehr Mühe machen, werden sich die Kandidaten trotzdem überlegen, wie sie ihre Publikationsliste aufblähen können, weil andere Kommissionen eben doch noch die Einträge zählen. Das System ist keine bösartige Erfindung, sondern eine Reaktion auf Trends – etwa auf das unglaubliche quantitative Wachstum der Wissenschaft. Ein einzelner Wissenschaftler kann das nicht alles überblicken und nutzt daher einfache Indikatoren, um vorzusortieren: welche Artikel er lesen muss und welche Kandidaten für einen Probevortrag infrage kommen. Jeder weiß, dass es eigentlich doof ist, so vorzugehen. Aber wie will man es sonst machen?
Wie schlimm sind diese Entwicklungen für die Wissenschaft?
Ich halte sie für gravierend. In der Wissenschaft sollten zwei Kriterien, die in einem ständigen Spannungsverhältnis zueinander stehen, immer gut austariert sein, nämlich einerseits Originalität und andererseits Anschlussfähigkeit. Forschung sollte ins Unbekannte vorstoßen, aber den Kontakt zu den etablierten Praktiken und Theorien halten. Ich habe den Eindruck, dass sich dieses Verhältnis stark in Richtung Anschlussfähigkeit verschoben hat. Es gibt immer noch originelle Forschung, aber sie wird mehr und mehr zur Ausnahme. Dieses System ist schwer zu ändern.
Was kann man tun?
Man könnte bei Projektanträgen stärker auf die Originalität achten. Die VolkswagenStiftunghat zum Beispiel einige lobenswerte Initiativen, die das tun. Und man kann die Grundfinanzierung ins Spiel bringen, denn eine größere Grundfinanzierung der Universitäten fördert die Originalität und die Bereitschaft von Wissenschaftlern, mit ihrem Projekt ein Risiko einzugehen. Risiko, weil immer die Gefahr besteht, dass doch nichts Interessantes herauskommt.
Ist die Wissenschaftskommunikation Ihrer Ansicht nach Teil dieses schwer zu ändernden Systems?
Nein, das ist eher eine wissenschaftsinterne Sache. Die meisten Wissenschaftler freuen sich zwar, wenn sie in den Medien gut dastehen, aber sie richten nicht ihre Arbeit darauf aus. Wichtiger ist ihnen, vor den Fachkollegen zu bestehen, denn die entscheiden über den nächsten Förderantrag. Die Wissenschaftskommunikation kann eher das öffentliche Klima und damit die Wissenschaftspolitik beeinflussen: zum Beispiel indem sie Verständnis dafür weckt, dass die Förderung von Wissenschaft einen langen Atem braucht.
Die Fragen stellte Alexander Mäder, der Torsten Wilholt seit der gemeinsamen Promotionszeit an der Universität Bielefeld kennt.