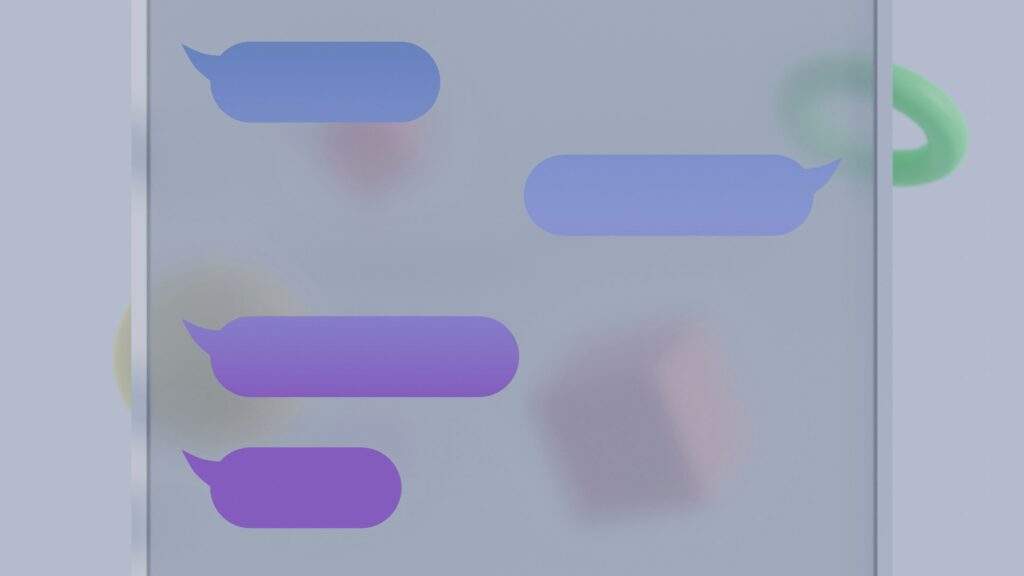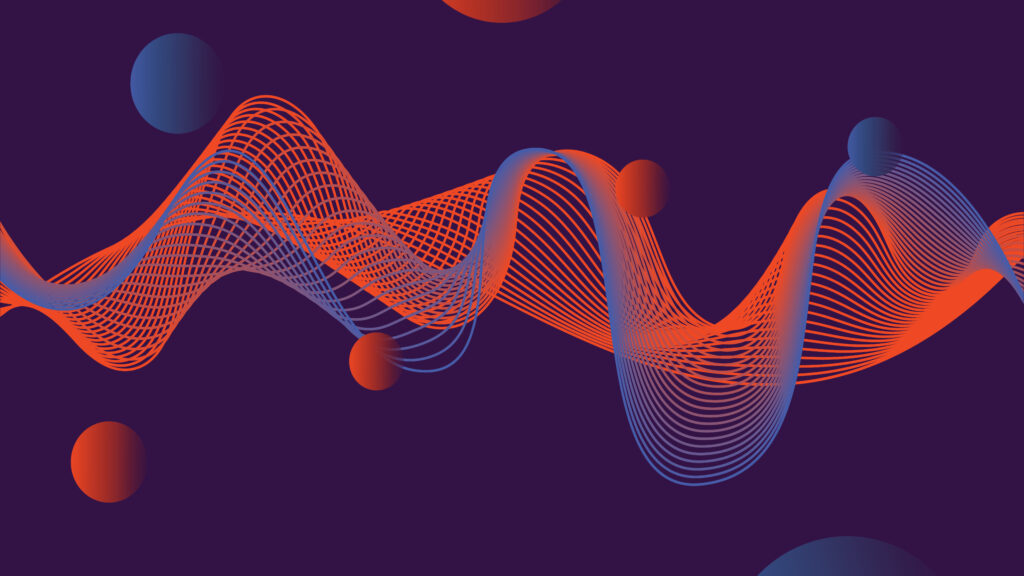Pseudowissenschaften ahmen die Sprache der Wissenschaft nach, um Seriosität zu erzeugen, wo Fakten fehlen. Warum das funktioniert? Weil viele Menschen die Feinheiten wissenschaftlicher Sprache nicht kennen, sagt unser Gastautor Udo Endruscheit – und sieht die Wissenschaftskommunikation in der Pflicht.
Wenn Pseudowissenschaften wissenschaftlich klingen wollen
Wissenschaftliche Sprache ist präzise, aber nicht populär. Sie ist zurückhaltend, aber nicht unentschieden. Und sie ist offen – aber nicht beliebig. Wenn Forschende sagen, „es gibt bislang keinen belastbaren Beleg für die Wirksamkeit“, dann ist das keine höfliche Ausflucht, sondern eine klare Aussage: Die Hypothese hat dem bisherigen Erkenntnisstand nicht standgehalten.
Doch im öffentlichen Diskurs wird diese Formulierung oft anders gelesen. Sie klingt nach: „Da könnte noch was sein“, oder: „Man weiß es eben nicht so genau.“ Und genau hier beginnt das Missverständnis – nicht aus bösem Willen, sondern aus unterschiedlichen Sprachlogiken:
- Die Wissenschaft formuliert prinzipiell vorläufig, weil sie weiß, dass Erkenntnis nie absolut ist.
- Die Öffentlichkeit erwartet eindeutige Urteile, weil sie Orientierung sucht.
- Und die Medien übersetzen oft vorsichtige Aussagen in scheinbare Offenheit – aus dramaturgischen, nicht erkenntnistheoretischen Gründen.
So entsteht eine semantische Lücke, in der sich Zweifel, Meinung und Ideologie einnisten können. Und diese Lücke wird nicht nur zufällig übersehen – sie wird gezielt genutzt. Die Homöopathie ist ein Paradebeispiel: Sie nutzt die semantische Lücke zwischen wissenschaftlicher Präzision und öffentlicher Erwartung, um den Anschein einer offenen Debatte zu erzeugen – obwohl die empirische Lage längst eindeutig ist.
Die Mimikry der Pseudowissenschaft – Homöopathie als Fallbeispiel
Ihre Vertreter*innen haben über Jahrzehnte gelernt, die methodische Zurückhaltung der Wissenschaft in eine rhetorische Strategie zu verwandeln: In der Diskussion mit Vertreter*innen der Homöopathie ist es alltäglich, dass die Aussage, es gebe keine belastbaren Belege, umgedeutet wird – etwa in „noch nicht belegt“ oder „bislang nicht widerlegt“. Studienergebnisse zählen dort nur, wenn sie für die Homöopathie zu sprechen scheinen; methodische Einwände werden überhört. Wo Studien keinen Wirkungsnachweis zeigen (und das trifft auf alle methodisch einwandfrei durchgeführten zu), muss im Zweifel die „individuelle Erfahrung“ herhalten.
Selbst das Einfordern eines Negativbeweises kommt immer wieder vor. Im Jahr 2017 unterlief dies sogar einer großen Krankenkasse in einer Online-Diskussion1 zur Frage, warum sie Homöopathie erstatte – was erhebliche Aufregung in der kritischen Netzgemeinde nach sich zog und exemplarisch zeigt, wie tief die Missverständnisse über wissenschaftliche Sprachbedeutung reichen.
Diese Beispiele zeigen epistemische Verschiebungen – doch ihre Wirkung beruht auf semantischer Umdeutung. Denn wer „nicht widerlegt“ sagt, meint nicht nur etwas anderes als „nicht belegt“, sondern erzeugt auch eine andere kommunikative Realität2.
Wer behauptet, es gebe „noch keine Beweise gegen die Homöopathie“, sagt damit nicht, dass sie wirkt – sondern nutzt die Sprachstruktur der Wissenschaft, um Unsinn als Möglichkeit erscheinen zu lassen.
Dabei ist genau das ein kategorialer Fehlschluss:
Wissenschaft kann keine Negativbeweise führen. Sie kann nicht beweisen, dass etwas nicht wirkt – sie kann nur zeigen, dass es keinen belastbaren Hinweis auf eine spezifische Wirkung gibt. Wer dennoch – implizit oder explizit – nach einem „Beweis des Gegenteils“ verlangt, stellt eine epistemologisch unlösbare Forderung – und instrumentalisiert die Offenheit der Wissenschaft, um den Anschein von Legitimität zu erzeugen, wo längst Klarheit herrscht.
Diese Strategie ist keine Naivität, sondern gezielte Wissenschaftsmimikry: Sie ahmt die Sprache der Wissenschaft nach, um den Anschein von Seriosität zu erzeugen, wo es keine epistemologisch gesicherte Basis gibt. Und sie profitiert davon, dass viele Menschen die semantischen Unterschiede nicht kennen – oder sie als akademische Spitzfindigkeit abtun.
Dabei ist die Lage eindeutig3:
- Die Homöopathie hat in kontrollierten Studien keine über den Placeboeffekt hinausgehende Wirkung gezeigt.
- Ihre Grundannahmen widersprechen den physikalischen und chemischen Grundlagen moderner Wissenschaft.
- Und ihre therapeutische Praxis basiert auf Suggestion, Ritual und Erwartung durch Wiederholung – nicht auf überprüfbarer Evidenz.
Zwischen Klartext und Erkenntnisgrenze – Das epistemische Scharnier
Doch genau hier liegt das „epistemische Scharnier“:
Wissenschaft ist nicht semantisch offen, weil sie unsicher ist – sondern weil sie methodisch und damit auch epistemisch redlich bleibt. Sie kann keine absoluten Urteile fällen, weil sie sich der Vorläufigkeit ihrer Erkenntnis verpflichtet weiß.
Die Herausforderung liegt darin, diese Offenheit nicht als Beliebigkeit erscheinen zu lassen.
Und hier beginnt die Aufgabe der Wissenschaftskommunikation: Sie muss die epistemische Struktur sichtbar machen, ohne sie zu glätten. Sie muss erklären, warum „kein Beleg“ nicht „unsicher“ heißt, sondern „nicht haltbar“. Und sie muss die semantische Architektur der Wissenschaft nicht nur übersetzen, sondern verteidigen.
Die Spannung zwischen epistemologischer Vorsicht und semantischer Eindeutigkeit ist kein Widerspruch, sondern ein Prüfstein für verantwortliche Wissenschaftskommunikation. Sie erinnert uns daran, dass sprachliche Präzision kommunikativ riskant sein kann – gerade dann, wenn sie auf populäre Deutungsmuster trifft. Und sie fordert zu Recht, dass Wissenschaft sich ihrer Wirkung im öffentlichen Raum bewusst bleibt, ohne sich zwischen erkenntnistheoretischer Redlichkeit und alltagssprachlicher Anschlussfähigkeit entscheiden zu müssen.
Die Lösung liegt nicht in dogmatischer Festlegung – sondern in semantischer Aufklärung. Denn wer Wissenschaft ernst nimmt, muss auch ihre Sprache ernst nehmen. Und wer sie öffentlich vermittelt, muss das epistemische Scharnier nicht überbrücken, sondern sichtbar machen.
Was zu tun wäre – für eine aufgeklärte Wissenschaftskommunikation
Die Lösung liegt in der bewussten und gezielten Verständigung über die Funktion von Sprache im Kontext von Erkenntnis – und in der Bereitschaft, diese Funktion auch öffentlich zu erklären.
Was wäre zu tun?
- Übersetzen statt glätten: Wissenschaftliche Aussagen müssen nicht vereinfacht, sondern kontextualisiert werden. „Kein Beleg“ heißt nicht „unsicher“, sondern „nicht haltbar“. Diese Differenz muss erklärt werden – nicht übergangen.
- Offenheit erklären, nicht ausnutzen: Die methodische Vorsicht der Wissenschaft ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Aber sie braucht sprachliche Begleitung, damit sie nicht als Beliebigkeit missverstanden wird.
- Medienbildung als demokratische Aufgabe: Wer Wissenschaft vermitteln will, muss auch Sprachlogik vermitteln. Das gilt für Schulen, Redaktionen, Universitäten – und für alle, die sich öffentlich äußern.
- Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen als öffentliche Akteure stärken: Viele Forschende scheuen den öffentlichen Diskurs, weil sie wissen, wie leicht ihre Sprache missverstanden wird. Sie brauchen Unterstützung, Schulung und Räume, in denen sie sprechen können, ohne sich verbiegen oder Angst vor Fehldeutungen haben zu müssen.
- Journalistische Verantwortung ernst nehmen: Wer über Wissenschaft berichtet, muss deren Sprachstruktur kennen – und darf sie nicht dramaturgisch verzerren. Oder, wie Klaus Koch es formuliert hat:
„Ziel ist es, Patienten und die breite Öffentlichkeit unverzerrt und verständlich zu informieren.“
Wissenschaft ist keine Meinung, sondern Methode. Und ihre Sprache ist kein rhetorisches Beiwerk, sondern Ausdruck dieser Methode. Wer ihre Formulierungen als Unsicherheit liest, verkennt ihre Struktur. Wer sie rhetorisch ausnutzt, untergräbt ihr Fundament.
- Das Beispiel ist exemplarisch. Nachzulesen sind einige (aber nicht alle) Aspekte der Diskussion in folgendem Artikel: https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/homoeopathie-warum-zahlt-die-krankenkasse-a-1137637.html ↩︎
- Vertiefende Informationen über Wissenschaftsmimikry und die Unwissenschaftlichkeit von Homöopathie finden sich in diesem Blogbeitrag von Natalie Grams und Udo Endruscheit https://www.bdwi.de/forum/archiv/archiv/10801937.html ↩︎
- Vgl. etwa EASAC 2017 („no robust evidence for efficacy beyond placebo“), House of Commons Science and Technology Committee 2009 („no evidence that homeopathy is effective“), Russische Akademie der Wissenschaften 2017 („pseudoscience“), sowie Ernst/Mukerji 2023: „Homeopathy is Pseudoscience“, in: Synthese. Diese Stellungnahmen belegen die epistemische Einordnung der Homöopathie und reflektieren zugleich die semantischen Strategien, mit denen wissenschaftliche Offenheit rhetorisch umgedeutet wird.
Die Unvereinbarkeit homöopathischer Grundannahmen mit biologischen, physikalischen und chemischen Prinzipien ist in diesen Quellen implizit mitgedacht – etwa durch die Kritik an der „potentization“ und der „memory of water“-Hypothese. ↩︎
Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider. Die redaktionelle Verantwortung für diesen Beitrag lag bei Sabrina Schröder.