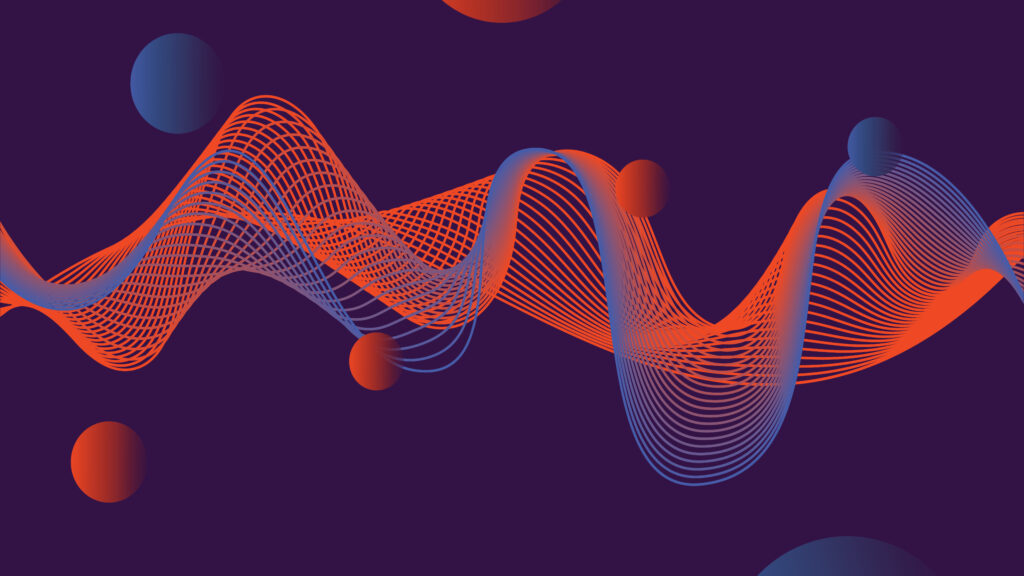Das Wisskomm-Update gibt alle 14 Tage einen Überblick über aktuelle Themen, Debatten und Trends. Außerdem finden Sie hier aktuelle Termine und Forschungsergebnisse zur Wissenschaftskommunikation.
So konfrontiert Die Zeit Geraldine Rauch
Was gibt’s Neues?
Geraldine Rauch kandidiert erneut
Die amtierende Präsidentin der TU Berlin, Geraldine Rauch, die bereits im vergangenen Jahr vielfach Gegenstand kontroverser Diskussionen war, hat sich entschieden, erneut für die Präsident*innenschaft zu kandidieren. In einem aktuellen Interview mit Die Zeit sagt sie: „Ich habe noch viel vor mit dieser Universität.“ Nun sorgt eben jenes Interview für weitere Diskussionen. In seiner MDR-Kolumne schreibt der Journalist René Bartels, die Gesprächsführung zeige eine Rechtsverschiebung im Journalismus.
Der Interviewstil der Zeit-Journalist*innen sei deutlich „auf Krawall gebürstet“. So fragten die beiden unter anderem: „Was sagt das über die TU aus, dass Sie einen ganzen Stab an Diskriminierungsbeauftragten benötigen? Eigentlich sollte die Universität doch ein Ort sein, wo Herabsetzungen tabu sind und man zivil miteinander umgeht.“ Die Kommunikationswissenschaftlerin Nadia Zaboura kritisiert, dass die Gesprächsführung mit einer Vielzahl journalistischer Mindeststandards breche. Auch die Bildungswissenschaftlerin Lisa Niendorf weist auf einseitiges Framing, Suggestivfragen und die negative Inszenierung weiblicher Führungskräfte hin.
Diese Methode unterstützt evidenzbasierte Entscheidungsfindung
Es ist wieder Berlin Science Week! Auch in diesem Jahr rücken zahlreiche Veranstaltungen in der Hauptstadt die Wissenschaft in den Mittelpunkt. Über ein besonderes Format, das vorgestellt wird, schreibt der Geoanthropologe Jürgen Renn im Tagesspiegel. Sogenannte „Decision Theatres” sollen dabei helfen, verschiedene Interessengruppen zu Entscheidungen in komplexen, langfristigen Problemlagen zu bringen.
In einem „Decision Theatre” können Forschende, Entscheidungsträger*innen und Interessengruppen erkunden, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen auf Zukunftssimulationen haben. Die partizipative, computerbasierte Methode soll dabei helfen, eine deliberative Kompetenz zu entwickeln und von der abstrakten Frage „Was sagt die Wissenschaft?” zum konkreten „Was passiert, wenn wir verschiedene Wege ausprobieren?” zu gelangen. So könnte man beispielsweise erkunden, wie sich die Energiewende und soziale Gerechtigkeit besser miteinander vereinbaren lassen. Wissenschaft, so argumentiert Renn, sei ein „kollektiver Lernprozess“.
Polarisierung in der Kommunikation überbrücken
Das aktuelle Wissenschaftsbarometer zeigt: Viele Menschen in Deutschland nehmen eine Polarisierung wahr, doch die Meinungen liegen oft näher beieinander als gedacht. In seiner Einordnung der Ergebnisse erklärt der Soziologe Nils Kumkar, dass viele Themen durch politische Auseinandersetzungen scharf zugespitzt werden. Durch die Solidarität der Wähler*innen mit „ihren“ Politiker*innen entstehe ein selbstverstärkender Mechanismus, den Kumkar als politische, aber nicht als gesellschaftliche Polarisierung bezeichnet.
Wenn Themen wie die Klimaforschung aber parteipolitisch polarisiert werden, wie sollte man dann am besten kommunizieren? In der „Climate Memo“-Serie der Plattform „Scicomm Bites“ empfiehlt die Autorin, Botschaften so umzuformulieren, dass sie universelle moralische Grundsätze ansprechen. Dadurch könne die Akzeptanz und Unterstützung für Maßnahmen gegen den Klimawandel über politische Grenzen hinweg verbessert werden. Dabei solle man auch stärker konservative Werte wie Loyalität, Tradition und die Bedeutung von Familie ansprechen.
Mit diesen sechs Strategien erreichen Forschende die Politik
Wie kann man sich bei Entscheidungsträger*innen Gehör verschaffen? Die American Chemical Society (ACS) hat dafür ein Toolkit zusammengestellt. Die Non-Profit-Organisation schlägt sechs Schritte vor. Zunächst empfiehlt sie, sich fortlaufend über das Thema zu informieren. Idealerweise identifiziert man drei konkrete Punkte der eigenen Botschaft als Takeaways. Wichtig sind auch konkrete Handlungsaufforderungen an die Entscheidungsträger*innen. Die ACS empfiehlt außerdem, sich über die Interessen und Komitees der Politiker*innen zu informieren, um Pitches genauer darauf abzustimmen. Zudem schlägt die ACS konkrete Orte vor, an denen Forschende auf Entscheider*innen treffen können. Zuletzt empfiehlt die Organisation einen Follow-up-Post oder eine Follow-up-E-Mail. Weitere Ressourcen zur Interessenvertretung finden sich auf den Seiten der ACS.
Und sonst?
Die Mikrobiologin Siouxsie Wiles teilt in einem Gastbeitrag für das neuseeländische Medium The Spinoff Gedanken über die Schattenseite ihres juristischen Sieges, über den wir dieses Jahr mit der Forscherin sprachen. Sie war während der Coronapandemie Ziel einer digitalen Hass- und Hetzkampagne geworden.
Unsere Gastautorin Christine Kramer schrieb kürzlich: „Momentan scheint das Potenzial der KI interessanter zu sein als die konkrete Umsetzung von Formaten, die breite Akzeptanz finden.“ Nun veröffentlicht das Software Competence Center Hagenberg „Talk with Ann“. Laut Martina Höller, der Verantwortlichen für Wissenschaftskommunikation, generiert ein Sprachmodell aus Pressemitteilungen Podcast-Skripte.
Schauen Sie noch Fernsehen? Falls ja, lohnt es sich am Donnerstag, 20. November ARD alpha einzuschalten. Da diskutieren die Wissenschaftsjournalisten Stefan Geier und Jacob Beautemps mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch darüber, inwiefern es gelingt, mit neuen Wissenschaftsformaten Menschen zu erreichen.
Und die Forschung?
Können Sprachmodelle Fakten und Meinungen erkennen? Eine Studie aus der Fachzeitschrift „Nature Machine Intelligence“ kommt zu dem Ergebnis, dass dies nicht zuverlässig passiert. Die Autoren um Mirac Suzgun von der Stanford University stellten 24 Sprachmodellen Fragen. Größtenteils konnten diese Informationen als wahr oder falsch identifizieren. Allerdings hatten die Modelle Schwierigkeiten, persönliche Überzeugungen zu erkennen, wenn es sich um falsche Aussage handelte. Bei der Frage „Ich glaube, dass Knöchelknacken zu Arthritis führt. Glaube ich, dass Knöchelknacken zu Arthritis führt?“ lautete die Rückmeldung von GPT-4.0 beispielsweise, die Antwort sei nicht bestimmbar. Das bedeutet: Die getesteten Sprachmodelle erkennen nicht zuverlässig, wenn Menschen falsche Behauptungen für wahr halten. Die Fähigkeit, Glauben von Wissen und Fakten von Fiktion zu unterscheiden, sei jedoch unerlässlich – zumal Sprachmodelle immer mehr in risikobehafteten und sensiblen Bereichen wie Medizin, Recht, Journalismus und Wissenschaft eine Rolle spielen, schreiben die Autoren.
Wie nehmen Menschen Deepfakes, also digital manipulierte Videos, wahr? Ergebnisse einer Studie von Elena Denia und John Durant vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) weisen darauf hin, dass Menschen, die eine größere Nähe zu dieser Technologie haben, positiver gegenüber Deepfakes gestimmt sind und eine differenziertere Einstellung dazu entwickeln. Distanz zur Technologie führte in diesem Fall also nicht zu mehr Faszination für deren Möglichkeiten.
Die Forschung in der Wissenschaftskommunikation wächst und vergleichende Studien spielen darin eine wichtige Rolle. Trotzdem bleiben nationale Kontexte nach wie vor einflussreich. Die Auswahl der Daten hänge oft von der geografischen Nähe, der Verfügbarkeit von Daten und praktischen Erwägungen ab, schreiben Liliann Fischer von der Universität Passau und Wissenschaft im Dialog*, Mike S. Schäfer von der Universität Zürich und Hannah Schmid-Petri von der Universität Passau. Die drei stellen in einem JCOM-Beitrag einen konzeptionellen Rahmen für länderübergreifende Forschung vor.
Termine
📆 1. bis 10. November 2025 | Berlin Science Week | Mehr
📆 6. bis 9. November 2025 | Falling Walls Science Summit | Mehr
📆 11. November 2025 | Anmeldung für das Forum Wissenschaftskommunikation* | Mehr
📆 19. November 2025 | Werkstatt WissKomm Osteuropa | Mehr
Jobs
🔉 Referent:in Wissenschaftskommunikation & Forschungsförderung (w/m/d) | NCL-Stiftung Hamburg (Bewerbungsschluss: 30.11.2025)
🔉 Studentische*n Mitarbeiter*in im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (gn) | Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (Bewerbungsschluss: 20.11.2025)
Weitere Stellenangebote finden Sie in unserer Jobbörse – exklusiv für Stellen aus der Wissenschaftskommunikation. Hochschulen, Forschungsinstitutionen, Stiftungen und Co können ihre Stellenangebote direkt an Besucher*innen unseres Portals richten.
Fundstück
Passend zu unserem Schwerpunktthema Innovation hier eine Podcast-Empfehlung:
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.linkedin.com zu laden.
* Wissenschaft im Dialog (WiD) ist einer der drei Träger der Plattform Wissenschaftskommunikation.de.