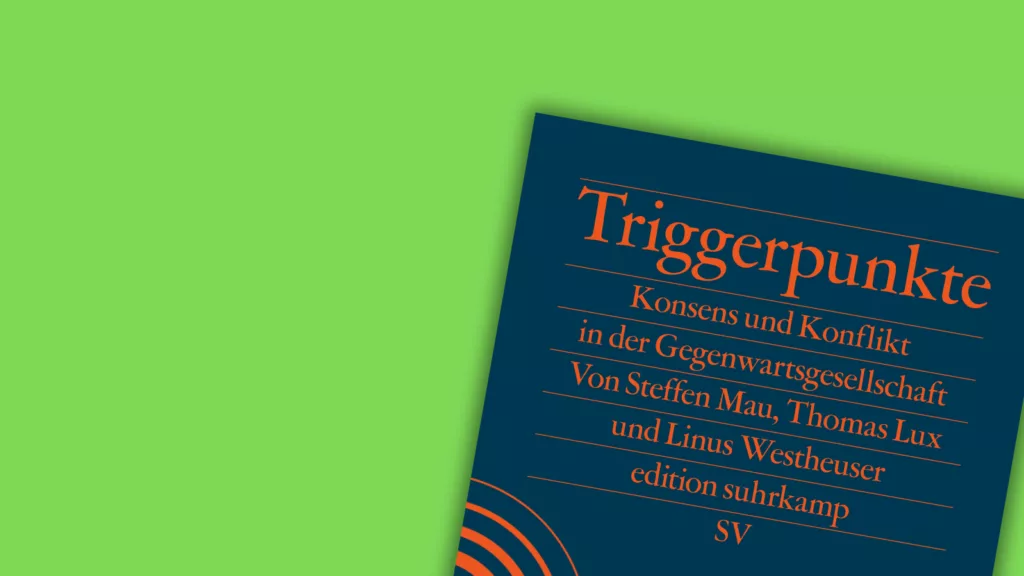Wenn es darum geht, ihre Gegner*innen zu schwächen, setzen extrem rechte Akteur*innen auf einfache Muster. Im Interview erklärt die Politikwissenschaftlerin Paula Diehl, wie Plagiatsvorwürfe wirken und warum die Wissenschaft so anfällig für diese Taktiken ist.
„Der Klassiker der Diskreditierung ist der Plagiatsvorwurf“
Die SPD hat die Rechtswissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht nominiert. Die Wahl verläuft üblicherweise reibungslos. Die für den 25. Juli geplante Wahl im Bundestag wurde jedoch verschoben, da die Union ihre Zustimmung zurückgezogen hatte. In der Talkshow von Markus Lanz berichtete Brosius-Gersdorf, dass sie und ihr Umfeld zuvor massiven Drohungen ausgesetzt waren und Falschinformationen über ihre Person in großem Stil verbreitet wurden. Angesichts des Widerstands aus der Union, der eskalierenden Debatte und möglicher Schäden für das Bundesverfassungsgericht zog Brosius-Gersdorf im August 2025 ihre Kandidatur zurück.
Frau Diehl, häufig ist von einem rechten Playbook die Rede, das typische Methoden beschreibt, mit denen versucht wird, Personen zu diskreditieren. Welche dieser Methoden haben Sie im Fall der Rechtswissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf wiedererkannt?

Playbooks der extremen Rechten arbeiten häufig mit typischen Narrativen und Triggerthemen wie Migration, Diversität oder wie im Fall von Brosius-Gersdorf Schwangerschaftsabbruch, die emotional stark aufgeladen werden. Dabei werden Techniken des Populismus mit Inhalten aus dem rechtsradikalen Spektrum vermischt. Das Interessante dabei ist, dass unterschiedliche Themen aneinandergereiht und als Teil desselben dargestellt werden.
In dem Fall von Brosius-Gersdorf mischte sich diese Rhetorik mit der Kakophonie der sozialen Medien und rechtsradikale Medien. Unwahrheiten wurden mit einseitigen Interpretationen ihrer Arbeit, diffamierenden Etiketten und mit Vorwürfen des Plagiats vermischt. Am Ende stand ein Bild der Wissenschaftlerin, die nicht mehr so viel mit der Person zu tun hatte.
Brosius-Gersdorf wurde nicht nur als Person, sondern auch als Wissenschaftlerin angegriffen. Ihr wurde linker Aktivismus vorgeworfen. Der Plagiatsvorwurf genügte, um ihre Wahl zur Verfassungsrichterin aufzuschieben – obwohl sich selbst der Plagiatsjäger zunächst von dem Vorwurf distanzierte. Warum genügen bereits Vorwürfe, um Schaden anzurichten?
Das liegt in der Natur der Wissenschaft selbst. Wissenschaft reagiert sehr sensibel auf das Nicht-Einhalten ihrer eigenen Methoden und Regeln. Genau darauf zielen diese Angriffe ab. Insofern sind das raffinierte Attacken, da sie einer Person die Wissenschaftlichkeit absprechen.
Dazu kam, dass die argumentative Auseinandersetzung einer Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers mit einem Thema – die ja zum normalen wissenschaftlichen Arbeiten gehört – mit politischem Aktivismus gleichgesetzt wurde. Notorisch war das Etikett „ultralinks“, das aus einer anonymen CDU-Quelle unkommentiert von der FAZ zitiert wurde.
Damit wurde eine Nähe zum Linksradikalismus suggeriert und implizit angedeutet, dass Brosius-Gersdorfs Positionen außerhalb der Demokratie stünden. Ihr wird vorgeworfen, politisch motiviert aktivistisch vorzugehen und dafür die Wissenschaft zu missbrauchen. Wichtig ist: Dieser Vorwurf wurde so konkret nicht artikuliert. In dieser ganzen Debatte wurden viele Vorwürfe nicht konkret gesagt. Es genügten ambivalente Hinweise, die funktionieren können, weil andere diffamierende Narrative außerhalb des traditionellen Journalismus zirkulieren.
Der Klassiker der Diskreditierung ist der Plagiatsvorwurf. Jede*r von uns Wissenschaftler*innen wäre am Boden zerstört, wenn nachgewiesen würde, dass er oder sie plagiiert hat. Der Plagiatsvorwurf ist so erfolgreich, weil bereits der Verdacht genügt, um den Ruf zu schädigen. Denn der Verdacht lässt sich schnell kommunizieren. Eine Klarstellung hingegen nicht, und darüber wird dann auch nicht mehr intensiv diskutiert, weil sie weniger Skandal produziert.
Frau Brosius-Gersdorf entschied sich, in der Talkshow von Markus Lanz Stellung zu den Vorwürfen zu nehmen. Als Grund nannte sie, dass man in ihrer Position zwar Kritik aushalten müsse, es aber Grenzen gebe. Bei ihr sei diese Grenze überschritten gewesen, als Erzbischof Herwig Gössl sie mit falschen Aussagen öffentlich kritisierte. Was denken Sie zu diesem Auftritt?
Wir beobachten eine Veränderung des medialen Umfelds, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in der stärker aufgehetzten Art und Weise, wie allgemein kommuniziert wird. Das färbt auf den Journalismus ab. Journalist*innen haben immer weniger Zeit zu recherchieren und nachzudenken. Zudem entsteht eine Kakophonie. Das heißt, jede*r will etwas sagen, aber niemand hört richtig zu.
Ich glaube, Brosius-Gersdorf hat das erkannt und sich daher zu diesem Schritt entschieden, weil es der einzige Weg zu sein schien, um sich einem großen Publikum ausführlich zu erklären. Tatsächlich wurde ihr in dieser Sendung außergewöhnlich viel Raum gegeben, um sich zu erklären. Die Fragen waren offen und es wurde nicht skandalisiert. Insofern kann ich ihre Entscheidung nachvollziehen.
Im Nachgang wurde ihr unterstellt, mit diesem Auftritt eine Kampagne in eigener Sache zu betreiben. Wenn sie sich nicht erklärt, bleiben die Verzerrungen der rechten Kampagne unwidersprochen im Raum stehen. Wenn sie sich die Deutungshoheit durch einen Talkshowauftritt zurückholt, wird ihr Kampagne unterstellt. Wie können Wissenschaftler*innen mit diesem Dilemma umgehen?
Gute Frage. Der Übersetzungsprozess zwischen Wissenschaftssprache und allgemeiner Sprache wird immer schwieriger. Ich denke, es ist wichtig, sich eine Strategie zu überlegen, wie man mit diesen sozialen und medialen Veränderungen umgeht.
Ein sehr gelungenes Beispiel ist für mich die Epidemiologin Luana de Araújo aus Brasilien, die während der Pandemie in den sozialen Medien sehr präsent war. Sie hat mit Humor gearbeitet, aber auch scharf geantwortet, wenn sie selbst angegriffen wurde. Das kam gut an. Sie hat sich bewusst gemacht, dass die mediale Arena eine andere ist als die wissenschaftliche. Das entspricht jedoch nicht der typischen Kommunikationsweise von Wissenschaftler*innen und kann sicher nicht von allen Wissenschaftler*innen erwartet werden.
Wir können in den etablierten Medien bleiben und nicht über soziale Medien kommunizieren. Damit reduziert man seine Angriffsfläche. Ich selbst handhabe es bisher so. Doch auch wenn die traditionellen Medien immer noch ein wichtiges Forum für die Wissenschaftskommunikation bleiben, wird der wissenschaftlichen Austausch mit der Gesellschaft langfristig nicht ohne soziale Medien funktionieren. Wir brauchen neue Foren und viele Kolleg*innen machen hervorragende Arbeit in sozialen Medien, Podcasts, Blogs oder YouTube Videos.
Sie nannten neben den medialen auch soziale Veränderungen. Was meinen Sie damit?
Wir erleben eine neue Art, wie unsere soziale Realität wahrgenommen und definiert wird. Was ist die Wahrheit innerhalb einer Gesellschaft und der Politik? Es wird immer schwieriger, einen gemeinsamen Boden zu finden, auf dem wir Divergenzen diskutieren können. Ein Beispiel dafür ist das Interview mit der Trump-Beraterin Kellyanne Conway nach dem ersten Wahlsieg Trumps. Auf energische Nachfragen des NBC-Reporters über falsche Aussagen von Trump ging sie nicht ein, sondern sagte, es seien keine Falschheiten, sondern alternative Fakten. Es geht also nicht mehr darum, wie Fakten interpretiert oder anerkannt werden, vielmehr entzieht sich der Debatte mit der Aussage: „Das sind meine Fakten, das sind deine Fakten, wir müssen nicht miteinander sprechen.”
Das ist gefährlich. Viele Kritiker*innen von Brosius-Gersdorf wollten sich nicht inhaltlich mit ihr auseinandersetzen. Die Empörung über ihre Person diente der Verdeckung statt der Klärung von Problemen. Ein Phänomen, das mich im Fall Brosius-Gersdorf ebenfalls sehr beschäftigt, ist die Freude daran, Menschen an den Pranger zu stellen, und teilweise auch die Freude an dieser Demütigung. Diese Entwicklung finde ich für unser gesellschaftliches Zusammenleben sehr bedenklich.
Wenn Wissenschaftler*innen öffentlich diskreditiert werden, welche Gefahren entstehen dadurch für die Wissenschaftskommunikation?
Es gibt Gefahren, die ich in Deutschland aber noch nicht als so hoch einschätze. In Deutschland sehen wir nämlich noch keine Diskreditierung der Wissenschaft als Institution, wie sie beispielsweise in den USA zu beobachten ist. In diesem Fall ging es um die Diskreditierung einer einzelnen Person. Weder die Institution Wissenschaft noch das Bundesverfassungsgericht scheinen durch diesen Fall nachhaltig geschädigt zu sein.
Dennoch sind solche Angriffe eine Einschüchterung von Wissenschaftler*innen und können natürlich dazu führen, dass sie sich zurückziehen. Das ist eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Universitäten müssen Wissenschaftler*innen unterstützen, was Ressourcen kostet. Es handelt sich um strukturelle Probleme, die sich durch den Sparzwang an Universitäten sicherlich verstärken und die Wissenschaftsfreiheit stark gefährden können.