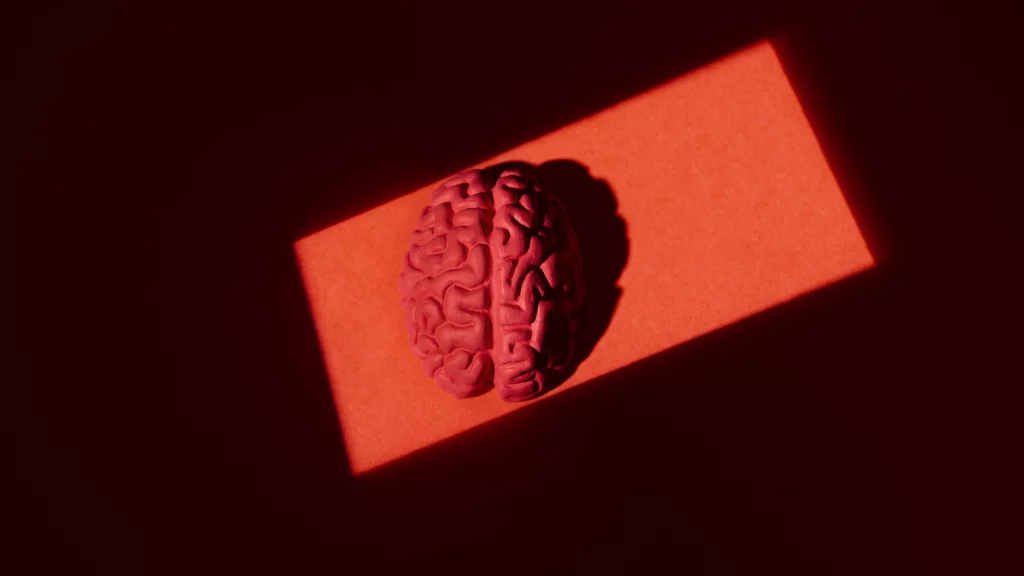Das Technikradar untersucht, was die Deutschen über Technik denken. Die Gastautoren Martin Bimmer und Thomas Sprenger ordnen die Erkenntnisse ein und erläutern, warum die Wissenschaftskommunikation über KI ein Vertrauensproblem hat.
Hat KI ein Kommunikationsproblem in Deutschland?
Die Deutschen stehen Künstlicher Intelligenz grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber: Zwei von drei Nutzenden sind von KI fasziniert. Doch trotz wachsender Offenheit fehlt es an Vertrauen in die Akteur*innen, die über KI informieren. Wie das TechnikRadar 2025 zeigt, hat die Technik- und Wissenschaftskommunikation über neue Technologien wie KI ein Vertrauensproblem.
Seismograf für Technikakzeptanz
Seit 2017 dient das TechnikRadar von acatech* als Seismograf für gesellschaftliche Technikeinstellungen. Die repräsentative Umfrage der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften verfolgt drei Ziele: Sie informiert über technikbezogene Debatten, versachlicht diese durch empirische Daten, liefert Technologieentwickler*innen und der Politik gesellschaftliches Feedback und weist als Frühwarnsystem auf aufkommende Spannungsfelder hin. Methodisch kombiniert das TechnikRadar Fragen zu allgemeinen Technikeinstellungen, Hoffnungen, Wünschen und Bedarfen mit wechselnden Themenschwerpunkten. 2025 standen Einstellungen zu digitaler Transformation und Künstlicher Intelligenz im Fokus.
Technikeinstellungen trotzen Krisen
Trotz multipler Krisen bleiben die Technikeinstellungen der Bevölkerung seit Jahren aufgeschlossen und stabil. Die meisten Deutschen sind überzeugt, dass sich technischer Fortschritt nicht aufhalten lässt. Blinder Technikpessimismus ist ihnen fremd: Kaum jemand glaubt, dass Technik langfristig mehr Problemen schafft, als sie löst. Unentschieden sind die Befragten jedoch, ob Technik einen Beitrag zur Lösung zentraler gesellschaftlicher Probleme leisten kann.
Differenziert, nicht technikfeindlich
Die Bewertungen einzelner Technologien spiegeln moderate und stabile Technikerwartungen wider und widerlegen damit das Klischee der technikfeindlichen Deutschen. Die Deutschen beurteilen Technik weder einseitig positiv noch pauschal ablehnend, sondern differenziert und abhängig vom Nutzungskontext. Das gilt von Anfang an für sämtliche Anwendungsbereiche, auch für das Thema KI.
Die Befragten erkennen den Nutzen von KI für die Gesellschaft, sehen aber auch Risiken. Den Einsatz in der medizinischen Diagnostik bewerten sie überwiegend positiv (nützlich: 66 Prozent, riskant: 34 Prozent). Bei autonomen KI-Agenten (nützlich: 38 Prozent, riskant: 34 Prozent) und KI-generierten Inhalten (nützlich: 52 Prozent, riskant: 44 Prozent) sind sich die Meinungen hingegen gespalten.
Zwei von drei Nutzenden fasziniert von KI
Persönliche Erfahrungen prägen die Haltung zur KI stark: Mehr als die Hälfte der befragten Deutschen hat bereits generative KI-Tools genutzt: Privat verwenden 11 Prozent diese häufig, im Beruf sind es 14 Prozent. Insbesondere jüngere Menschen und Akademiker*innen nutzen KI häufiger. 50 Prozent der Nutzenden haben dabei den Eindruck, dass ihnen KI Arbeit abnimmt. 15 Prozent sagen, dass die Ergebnisse ihre Skepsis gegenüber KI verstärkt haben. Nur 14 Prozent meinen, dass der Einsatz von KI ihnen nichts gebracht hat. Zwei Drittel der Nutzenden zeigen sich von Möglichkeiten der KI-Technologie fasziniert.
Das Vertrauensparadoxon
Obwohl die Bevölkerung neuer Technik aufgeschlossen gegenübersteht, misstraut sie der Kommunikation wichtiger Akteur*innen. Nur neun Prozent der Deutschen fühlen sich von der Bundesregierung ausreichend über Technikfolgen informiert. Als glaubwürdige Instanz in Sachen KI gelten vor allem Verbraucherschutzorganisationen (56 Prozent), weit gefolgt von klassischen Medienanbietern (25 Prozent) und der Politik (16 Prozent). Am wenigsten vertrauen die Menschen Plattformbetreiber*innen und Technik-Influencer*innen (jeweils sieben Prozent).
Transparenz als Grundbedürfnis
84 Prozent der Befragten befürchten, dass die Urheberschaft digitaler Inhalte nicht mehr nachvollziehbar ist. Fast die Hälfte (46 Prozent) glaubt, dass KI-Systeme Inhalte in sozialen Medien manipulieren. Daher fordern 91 Prozent eine klare Kennzeichnung für KI-generierte Inhalte.
Mehr Mitbestimmung bei umstrittenen Technologien
Die Menschen fordern nicht nur mehr Transparenz und Kontrolle, sondern auch mehr Autonomie gegenüber der übermäßigen Marktmacht und der Eigenmächtigkeit der Technologie.
60 Prozent der Befragten sorgen sich über die Machtkonzentration bei wenigen Tech-Konzernen, und 69 Prozent befürchten, dass dies der Gesellschaft schadet. Lediglich 25 Prozent sehen persönliche Vorteile. Ein möglicher Kontrollverlust durch autonome KI-Systeme, militärische Anwendungen oder KI-Agenten stößt auf deutliche Skepsis.
Das Vertrauen der Deutschen in die Expertise der Wissenschaft bei umstrittenen Technologien bleibt mit 48 Prozent stabil. Dennoch fordern 45 Prozent mehr Mitbestimmung für die Bevölkerung, während nur 18 Prozent dies ablehnen. Unter den Wähler*innen von AfD und BSW wollen sogar 65 Prozent mehr Teilhabe.
Über alle Alters-, Bildungs- und Geschlechtergruppen hinweg sind sich die Deutschen einig, dass sich verantwortungsvolle Technologieentwicklung am Gemeinwohl orientieren muss.
Was folgt daraus für die Technik- und Wissenschaftskommunikation?
Die Erkenntnisse des TechnikRadar liefern wertvolle Impulse für die Kommunikation über Technik und KI. Sie sind ebenso relevant für den Umgang mit neuen Systemen in Unternehmen und Organisationen.
1. Persönliche Erfahrungen sind entscheidend, um Urteile zu bilden und Haltungen zu entwickeln. Niedrigschwellige Angebote, Erlebnisräume und Pilotprojekte schaffen die nötigen Rahmenbedingungen. Arbeitgeber*innen sollten den Einsatz von KI strategisch planen und Freiräume schaffen. Der Fortschritt darf nicht nur von der Initiative Einzelner abhängen. Eine fortlaufende Kommunikation über Entwicklungen ist wichtig – zu viel Kommunikation gibt es nicht.
2. Transparenz ist unverzichtbar. Die Forderung nach Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten zeigt, dass Menschen bereit sind, mit KI zu interagieren, aber wissen wollen, womit sie es zu tun haben. Dies gilt sowohl für die persönliche Rechtssicherheit der Nutzenden als auch für die Offenlegung von Interessen beim Einsatz von KI. Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft müssen das Bedürfnis nach Transparenz ernst nehmen und offen über die Möglichkeiten und Grenzen von KI informieren.
3. Risiken sollten weder dramatisiert noch beschönigt werden. Besser ist es, sie als gestaltbar darzustellen und konkrete Kontrollmechanismen zu etablieren. Die Deutschen sind eher bereit, Risiken zu akzeptieren, wenn sie das Gefühl haben, diese beeinflussen zu können oder wenn der Nutzen überwiegt. Sicherheitsnarrative können dabei helfen. Technikerklärungen sollten zeigen, wie Innovation zur gesellschaftlichen Resilienz beiträgt und welchen Nutzen sie für alle hat.
4. Menschen beanspruchen Selbstbestimmung und Kontrolle. Diese Faktoren sind entscheidend für die Akzeptanz von Technik. Das gilt nicht nur für die Gesellschaft insgesamt, sondern auch für Unternehmen. Wenn eine neue Technologie den Arbeitsalltag verändert, sollten Unternehmen ihre Mitarbeitenden daher frühzeitig in die Entscheidungsprozesse einbinden. Sie dürfen nicht nur Objekte der Veränderung sein, denn ein drohender Autonomieverlust beeinflusst die Offenheit gegenüber solchen Prozessen negativ.
5. Die bemerkenswerte Stabilität der Technikeinstellungen trotz multipler Krisen legt nahe, dass dauerhafte Dialog-Plattformen und Content-Formate effektiver sind als kurzlebige Kampagnen. Vertrauen in Technologie entsteht langfristig – durch verlässliche, transparente und zugängliche Kommunikation, die die Menschen als mündige Partner*innen ernst nimmt.
Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider. Die redaktionelle Verantwortung für diesen Beitrag lag bei Michael Wingens.