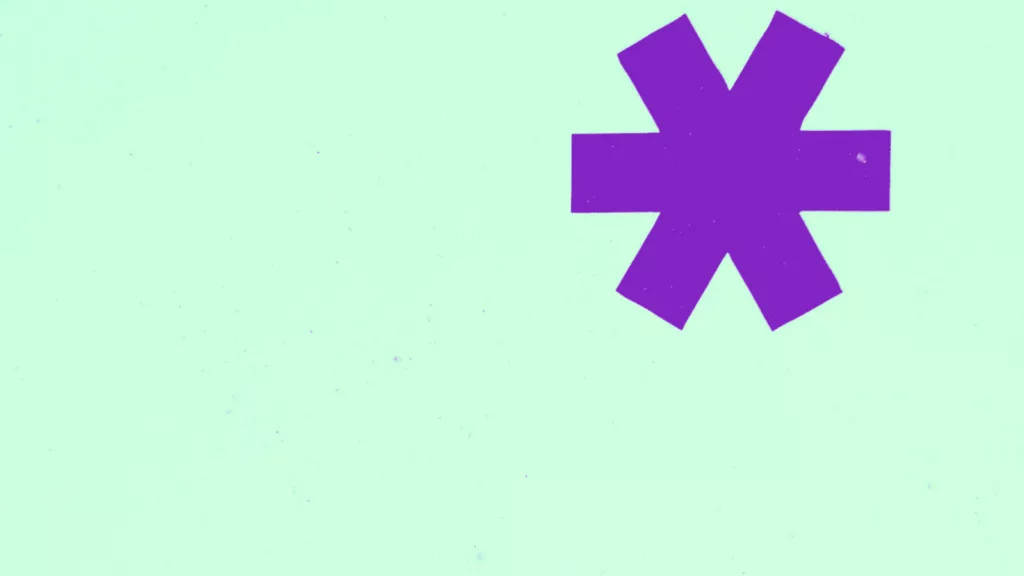An der Universität der Künste (UdK) Berlin findet derzeit ein Prozess der kritischen Diversitätsentwicklung statt. Welche Hindernisse dabei auftauchen und warum viele Diversitätsinitiativen folgenlos verpuffen, darüber berichten Kathrin Peters und Mika Ebbing im Interview.
„Wir können nicht 500 Jahre Universitätsgeschichte in fünf Jahren verändern.“

Im Rahmen eines Aktionstags („Recognizing Barriers“) berichteten anonyme Personen von ihren Diskriminierungserfahrungen an der UdK. Jemand sprach davon, dass bisherige Diversitätsinitiativen oft nur von kurzer Dauer waren und – scheinbar absichtlich – wieder verpufften. Was denken Sie über diese Vermutung?
Mika Ebbing: An der UdK, wie auch an vielen anderen Universitäten, geht die Arbeit zu Diskriminierung und Rassismus sehr stark von den Studierenden aus. Studentische Initiativen haben aber immer eine gewisse Kurzlebigkeit, weil die Studierenden nur für die Dauer ihres Studiums an der Universität sind. Dazu kommt, dass politische Arbeit und Engagement zwischen Studium, Lohnarbeit und anderen Verpflichtungen stattfindet, also häufig unter prekären Bedingungen. Daher ist eine nachhaltige Veränderung von Strukturen schwierig, wenn die Institution transformativen Prozessen ablehnend gegenübersteht. Umso wichtiger ist es, die Stimmen der Studierenden zu zentralisieren. Vor allem diejenigen, die direkt von Marginalisierung betroffen sind, müssen von der Hochschule stärker geschützt, gefördert und in die Prozesse einbezogen werden.
Kathrin Peters: Ich halte es für entscheidend, dass die Professuren mit thematischen Schwerpunkten ausgestattet werden. Beispielsweise, anstatt eine Professur für „Stadtplanung“ auszuschreiben wäre eine für „Stadtplanung unter Berücksichtigung von Gender-Aspekten“ eine gute Möglichkeit. Das ist wichtig, weil Professuren am längsten bestehen bleiben, Themen setzen und eine Diskussionskultur langfristig fördern können. Die Umsetzung ist natürlich schwierig, weil jedes Institut überzeugt werden muss und andere Themen oft als wichtiger angesehen werden.
Häufig setzen sich hauptsächlich Angehörige einer diskriminierten Gruppe mit Diversitätsarbeit auseinander. Wie kann man das ändern?
Peters: Es wird immer Leute geben, die denken, dass sie mit Diversität nichts zu tun haben. Ich finde nicht, dass es die Aufgabe derjenigen sein sollte, die aus der Betroffenenperspektive sprechen, die zu überzeugen, die sich gegen antidiskriminierende Hochschulpolitik stellen. Was wir aber tun können, ist, marginalisierte Gruppen auf hochschulpolitischer, wissenschaftlicher oder künstlerischer Ebene zu unterstützen und ihnen eine Plattform zu bieten, um über ihre Erfahrungen sprechen zu können. Mit unserem Projekt „Unlearning University“ möchten wir genau diesen Austausch fördern. Sensibilisierung ist auch sehr wichtig. Zum Beispiel sollte bei Berufungs- und Einstellungsverfahren Personen mit Führungsverantwortung aktiv angeboten werden, Workshops zu verschiedenen Diversitätsthemen zu besuchen.
Warum müssen wir die Universität als solche „verlernen“ und was bedeutet das konkret?
Peters: „Unlearning“ ist ein Begriff aus der de- und postkolonialen Forschung. Dabei geht es nicht darum, dass Wissen „ausgelöscht“ oder vergessen wird. Unlearning bedeutet vielmehr, an die Grenzen des Wissens zu stoßen und zu zeigen, dass Wissen oder auch Fähigkeiten, über die wir zu verfügen glauben, nicht selbstverständlich sind. Dieser Reflexionsprozess gilt für alle Bereiche der Universität. Die Studierenden werden zum Beispiel oft über ein Bewerbungsverfahren mit einer Mappe oder einem Vorspiel ausgewählt. Das heißt, sie müssen „künstlerische Begabung“ zeigen. Das klingt einerseits nach einem Vorteil, weil die Abiturnoten keine Rolle spielen, aber es gibt doch meist implizite Voraussetzungen. Gerade in der klassischen Musik bestehen Studierende, die keine musikalische Früherziehung genossen haben, diese Prüfungen kaum. Diese Art von Vorwissen, das vorausgesetzt und nicht ausgesprochen wird, also wirklich implizit bleibt, ist eine sehr hohe Barriere. Das Art.School.Differences Projekt aus Zürich hat sich auch damit beschäftigt.
Mika: Im Art.School.Differences Projekt wird der Begriff „Passung“ beschrieben, also es passt oder es passt nicht, das ist sehr flexibel. Das Vorwissen wird nirgendwo explizit genannt und ist daher umso schwieriger zu erlernen.
Welche Rolle spielen Kunst und Kreativität bei der Umsetzung von „Unlearning University“?
Peters: Formate des wissenschaftlichen Arbeitens, Lehrens und Lernens können als sehr hochschwellig wahrgenommen werden. Wir arbeiten mit Kunstvermittler*innen zusammen, die Erfahrung damit haben, Räume zu öffnen, in denen Austausch möglich ist. Eine Gruppe aus der Fakultät Musik wird ein Konzert ausrichten, bei dem wenig gespielte Komponist*innen vorgetragen werden. Eine Kollegin setzt sich in einer Raumintervention mit Tanz und Behinderung auseinander. Und die Gruppe „Eine Krise bekommen“ macht zum Beispiel einen Workshop über Geschmack und Schmecken.
Die UdK hat bereits Ende 2022 eine Critical Diversity Policy verabschiedet. Was für konkrete Auswirkungen hat diese aktuell für den universitären Alltag?
Mika: Die Critical Diversity Policy ist ein wichtiger Schritt. Aus Sicht der Studierenden sind diese Ansätze zur Veränderung auf struktureller Ebene jedoch zu langsam, vor allem angesichts der Dringlichkeit der Probleme. In der Arbeit von „Eine Krise bekommen“ gibt es den Begriff „Institutional Heartbreak“, der auch die Enttäuschung und den Schmerz über diese Langsamkeit beschreibt. Umso wichtiger ist es, die Diskussion weiterzuführen.
Peters: Ich würde sagen, dass der Prozess selbst – das Verfassen der Critical Diversity Policy hat etwa vier Jahre gedauert – durchaus eine große Wirkung hatte. Jetzt gibt es zum Beispiel eine Beauftragte für Antidiskriminierung und Diversität, es wird an einem Code of Conduct gearbeitet, die Verwaltungskommunikation ist inzwischen ganz selbstverständlich geschlechtersensibel. Insgesamt erlebe ich es so, dass Diskriminierungskritik inzwischen viel häufiger geäußert wird. Aber Veränderungen brauchen viel Diskussion, viel Zeit. Wir können nicht 500 Jahre Universitätsgeschichte in fünf Jahren verändern.
Welche Rückmeldungen zur Diversitätsentwicklung, auch von der Leitungsebene, haben Sie bisher erhalten?
Mika: Der Versuch, die Grenzen des Wissens und der Universität als Institution anzuerkennen, ist mit vielen Widerständen verbunden. Er fordert die Universität und alle Beteiligten auf, die grundlegenden Strukturen zu überdenken und führt zu Veränderungen in der Zusammensetzung der Universität. Es gab zum Beispiel sehr lange die Weigerung der Hochschulleitung, an Rassismus-Trainings teilzunehmen.
Peters: Die Leitungsebene spielte eine ganz klare Rolle als Verhandlungspartei bei der Entwicklung der Critical Diversity Policy. Letztendlich ist es die Hochschulleitung, die dem Berliner Senat ein solches Papier vorlegen muss. Was ich oft beobachte, ist, dass manche sich von Diskriminierungskritik persönlich angegriffen fühlen. Bei der Exit-Racism-Initiative an der UdK Berlin wurde zum Beispiel gesagt: „Aber wir sind doch keine rassistische Hochschule.“ Dabei sind das ganz strukturelle Rassifizierungen, die alle Universitäten betreffen, die auch ausgesprochen werden müssen, Strukturen, von denen wir alle ein Teil sind.
Weiterlesen
- Der Critical University Blog an der UdK Berlin
- Unlearning University
- Exit Racism UdK
- Recognizing Barriers
- HRK Initiative „Vielfalt an deutschen Hochschulen“
- Eine Krise bekommen
- Art.School.Differences