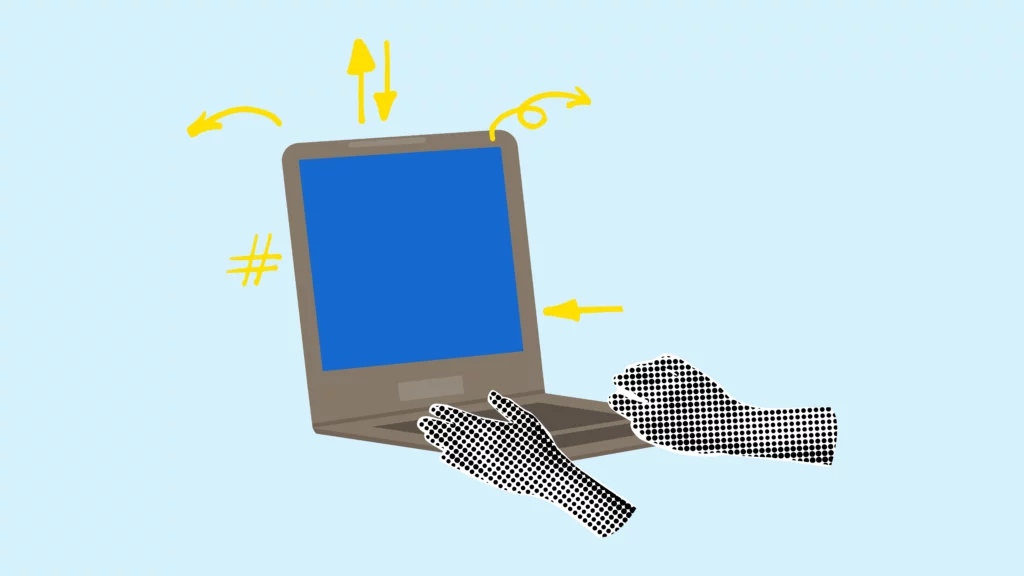Die Philosophie der Wissenschaft spielt auch für die Kommunikation von Forschungsergebnissen eine Rolle. So etwa bei der Frage, was Fakten sind oder als wie gesichert Erkenntnisse gelten können. Ein Gastbeitrag von Gregor Betz und David Lanius vom Karlsruher Institut für Technologie.
Wissenschaftliche Erkenntnis ist eine Frage des Mehr-oder-weniger und nicht des Ja-oder-nein
In den aktuellen Debatten um das Coronavirus wird in der Regel unter Rückgriff auf wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse argumentiert. Eine Liste solcher Untersuchungen zur Verbreitung und Symptomatik des Virus hat beispielsweise das Robert-Koch-Institut zusammengetragen. Dabei sollte allerdings nicht übersehen werden, dass empirische Studien häufig nur mehr oder weniger sichere Erkenntnisse liefern. Gerade bei solchen aktuellen, noch nicht umfassend durch wissenschaftliche Studien untersuchten Sachverhalten ist unser Verständnis in der Regel begrenzt: Wir verfügen lediglich über graduelles Wissen. Die Erwartung, dass Wissenschaftler jede drängende Frage eindeutig beantworten können und sollten („Drücken Sie sich doch nicht so kompliziert aus! Sind Kinder genauso infektiös wie Erwachsene, ja oder nein?“), ist völlig verfehlt.
Der Grund liegt darin, dass die Ergebnisse der empirischen Wissenschaften in der Regel induktiv begründet sind. Bei induktiven Argumenten schließt man von den Eigenschaften einer begrenzten Anzahl von Instanzen auf die Eigenschaften aller Instanzen einer bestimmten Klasse. Allerdings sind die Schlüsse aus solchen Argumenten stets nur plausibel oder wahrscheinlich. Im Gegensatz dazu garantiert in einem deduktiven Argument die Wahrheit der Annahmen die Wahrheit der Schlussfolgerung – das ist beispielsweise in mathematischen Beweisen der Fall.
Weil wissenschaftliche Erkenntnis nicht einfach schwarz-weiß ist, können manche Hypothesen besser oder schlechter als andere gerechtfertigt sein. Deshalb kann auch der Grad der Bestätigung einer Theorie zu- oder abnehmen, wenn neue Daten gesammelt werden. So haben zum Beispiel immer neue empirische Untersuchungen zu einem stetig anwachsenden Grad der Bestätigung jener wissenschaftlicher Theorien geführt, die von einem menschengemachten Klimawandel ausgehen. Als Resultat ist heute die Hypothese, dass sich das Klima aufgrund menschlichen Handelns stark aufheizt, deutlich besser gerechtfertigt als jede gegenteilige Hypothese. Sie ist sogar so gut bestätigt, dass man es als wissenschaftliche Tatsache bezeichnen kann, dass sich das Klima aufgrund menschlichen Handelns stark aufheizt.
Inwieweit eine Hypothese (oder auch eine Theorie oder Vorhersage) als gut bestätigt oder wissenschaftlich fundiert gelten kann, hängt insbesondere davon ab,
- wie gut die Hypothese gegebene Beobachtungen berücksichtigen und systematisch erklären kann;
- wie breit und vielfältig die gesamte Evidenz ist, anhand derer die Hypothese bewertet wird;
- wie gut die Hintergrundannahmen bestätigt sind, auf die sich wissenschaftliche Schlussfolgerungen und Evidenz stützen;
- inwieweit Alternativen zur Hypothese umfassend dargelegt und gründlich untersucht wurden.
Wenn weder eine Hypothese noch ihre Negation ausreichend bestätigt sind, besteht wissenschaftliche Unsicherheit. Diese Unsicherheit ist charakterisiert und bestimmt durch die Grenzen unseres Verständnisses und den Grad der Bestätigung der Hypothese. Wissenschaftliche Unsicherheit kann dementsprechend aus unterschiedlichen Quellen stammen und auf unterschiedliche Weise artikuliert werden. Bei vielen Sachverhalten ist es daher so, dass wir sie weder völlig durchschauen noch gar nicht verstehen.
Manchmal kann die Unsicherheit auf probabilistische Weise quantifiziert werden, zum Beispiel: „Die Wahrscheinlichkeit, dass die Hypothese korrekt ist, beträgt 70 Prozent.“ Manchmal ist die Unsicherheit so tiefgreifend, dass man nur alternative Möglichkeiten aufzählen kann, zum Beispiel: „Es ist möglich, dass es außerirdisches Leben gibt, und es ist möglich, dass es kein außerirdisches Leben gibt. Beide Hypothesen könnten wahr sein.“
Es ist falsch, eine tiefgreifende, möglicherweise nicht auflösbare Unsicherheit über ein bestimmtes Sachgebiet damit gleichzusetzen, dass es überhaupt keine objektive Fakten darüber gibt. Zum Beispiel bedeutet die nicht auflösbare Unsicherheit über das Geburtsdatum des Ilias-Autors nicht, dass es keine Tatsache ist, dass der Ilias-Autor an einem bestimmten Datum geboren wurde.
Dass wissenschaftliche Erkenntnis eine Frage des Mehr-oder-weniger ist, bedeutet auch nicht, dass jeder wissenschaftliche Befund unsicher ist. Viele wissenschaftliche Erkenntnisse – wie viele alltägliche Überzeugungen – können als praktisch sicher angesehen werden. Dies ist beispielsweise bei unseren physikalischen Theorien der Fall, die beschreiben, wie Computer oder Smartphones funktionieren, aber auch bei der Evolutionstheorie oder eben der Erkenntnis, dass der Klimawandel menschengemacht ist.
Aus diesen Gründen müssen wissenschaftliche Erkenntnisse differenziert betrachtet werden. Und Wissenschaftskommunikation sollte – soweit möglich – deutlich aufzeigen, wie robust unser gegenwärtiges Verständnis wissenschaftlicher Sachverhalte ist und welche Unsicherheiten noch bestehen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Besprechung der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori am 10. Juli 2020 im Deutschlandfunk von zwei aktuellen Studien, die die Immunität von Corona-Infizierten untersucht haben. Darin hat sie deutlich gemacht, warum die Aussagekraft der Studien begrenzt ist. Zum einen sind sie bislang weder durch ein geordnetes wissenschaftliches Prüfungsverfahren gelaufen noch können sie (selbst wenn die Ergebnisse der wissenschaftlichen Prüfung standhalten) tatsächlich die Immunität von zuvor Infizierten belegen, da dies auch von Faktoren abhängt, die gar nicht untersucht worden sind.
Eine solch gelungene Wissenschaftskommunikation ist allerdings gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie leider nicht die Regel. So wurden beispielsweise die Stellungnahmen zur COVID-19-Pandemie der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina größtenteils auf eine Weise kommuniziert und diskutiert, die weder die geringe Robustheit unseres gegenwärtigen Verständnisses noch das (momentan noch) hohe Ausmaß der aktuellen Unsicherheit bezüglich des Coronavirus berücksichtigt. Eine Wissenschaftskommunikation, die transparent auch die vorhandenen Unsicherheiten wissenschaftlicher Ergebnisse aufzeigt, schafft auf längere Sicht Glaubwürdigkeit für Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation gleichermaßen und ist damit auch der beste Garant für einen bedachten und auf Fakten basierten Umgang mit der Pandemie.
Dieser Beitrag ist eine adaptierte Übersetzung der ersten von 22 Fragen zur Wissenschaftstheorie im Artikel „Philosophy of science for science communication in twenty-two questions“ in Annette Leßmöllmann et al. (Hrsg.): Science Communication, Berlin: De Gruyter.
Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wider.