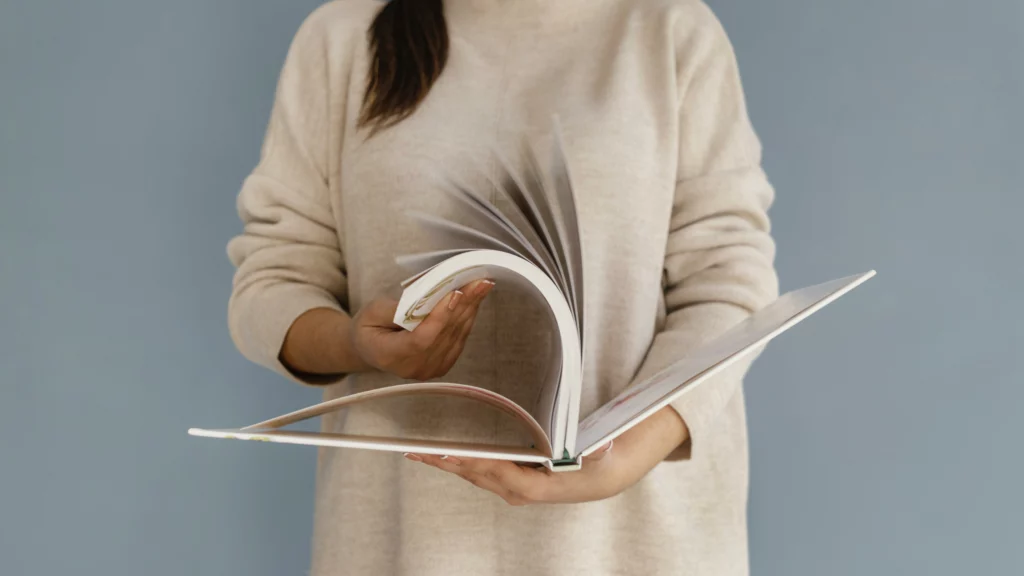Sich unter einer Dusche von Komplimenten berieseln lassen oder einen Mitmenschen an der Schattenwand küssen? Das geht derzeit in der Sonderausstellung „LIEBE.“ im Universum Bremen. Die wissenschaftliche Leiterin Dr. Kerstin Haller erklärt, wie die Ausstellung das Thema Liebe jenseits gängiger Klischees beleuchtet.
So wird Liebe im Museum erklärt
Kaum ein Thema ruft größere Emotionen hervor als die Liebe. Macht es das für eine wissenschaftliche Ausstellung einfacher oder herausfordernder?

Beides. Es ist einfacher, weil jede und jeder einen Anknüpfungspunkt hat. Bei früheren Ausstellungen standen wir vor der Herausforderung, ein vermeintlich trockenes Thema wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz zu emotionalisieren. Das muss man beim Thema Liebe nicht. Auf der anderen Seite ist es herausfordernder, weil es keine ganzheitliche wissenschaftliche Erklärung für alle Aspekte dieses Phänomens gibt. Vielmehr nähern sich unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen verschiedenen Aspekten des Themas. Die Neurobiologie forscht mit anderen Fragestellungen und Methoden als die Soziologie oder die Psychologie.
Wie haben Sie subjektive Erlebnisräume und objektive Wissensvermittlung kombiniert?
Wir hatten das Glück, eine Sonderausstellung in Frankreich zu finden, die das Rückgrat unserer Ausstellung bildet. Wir konnten 14 multimediale Stationen ausleihen, die vom Museum „Palais de la découverte“ in Paris gemeinsam mit der Universität Genf entwickelt wurden. Wir haben diese Stationen in eine neue Gestaltung gebracht und um individuelle Erlebnisräume ergänzt.
Mit welchen inhaltlichen oder gestalterischen Schwerpunkten wollten Sie das Thema Liebe abseits gängiger Klischees beleuchten?
Wir versuchen, Liebe als ein heterogenes Phänomen darzustellen und die Gäste zu ermutigen, den Blick auch auf sich selbst zu richten. Dafür haben wir zum Beispiel eine Station zu Beziehungen und Bindungen, bei der man Gummibänder spannen und sehen kann, mit wem man enge Beziehungen eingeht. Das eigene Beziehungsnetz kann dann mit denen anderer Gäste verglichen werden.
Darüber hinaus gibt es Teile der Ausstellung, die einen größeren kulturellen Überblick ermöglichen. Wir zeigen beispielsweise Fotos aus dem Buch zum Film „Love around the world“ von Davor Rostuhar, in dem Menschen aus 30 Ländern über die Liebe und ihre vielfältigen Ausprägungen erzählen.
Gestalterisch haben wir versucht, die Klischees zu verlassen, indem wir mit Tini Emde eine Künstlerin aus Bremen gefunden haben, die uns durch ihre sehr humorvollen, bunten und vielfältigen Illustrationen von Tieren und deren Zusammenleben begeistert hat.

In Ihrer Ausstellung kann ich mich zum Beispiel auch unter einer Komplimente-Dusche von liebevollen Worten berieseln lassen oder einen Mitmenschen an der Schattenwand ohne Berührung küssen. Welche wissenschaftlichen Inhalte wollen Sie hier vermitteln?
Der Komplimente-Dusche zugrunde liegen Studien mit bildgebenden Verfahren, in denen Leute in einem großen Gehirnscanner untersucht werden. Sie verschicken per Textnachricht ein Kompliment oder bekommen eins. In beiden Situationen sind ähnliche Gehirnareale in der Amygdala aktiv. Das heißt, auch anderen Komplimente zu machen, fühlt sich gut an.
Bei der Schattenwand ist es eher ein physikalisches Phänomen, das man erleben kann. Zwei Menschen können sich mit ein bisschen Abstand die Hand reichen oder so tun, als würden sich die Lippen berühren. Das geht, weil sie sich in unterschiedlichen Abständen von der Lichtquelle aufstellen. Die Szene wird dann auf der Wand zweidimensional abgebildet. Intuitiv lernen die Gäste, dass der Abstand zur Lichtquelle sich in der Größe der Abbildung widerspiegelt. Bei diesem Exponat geht es uns vorrangig um das Erlebnis der Gäste. Es erfreut sich großer Beliebtheit und wird häufig als Fotomotiv auf Social Media geteilt.
Gibt es einen wissenschaftlichen Fakt zur Liebe, der Sie besonders überrascht hat?
Ja, in einem Film, der in der Ausstellung gezeigt wird, spricht der Neurobiologe Marcel Hilbert über die Bedeutung des Hormons Oxytocin bei Wühlmäusen. Er berichtet, dass Prärie-Wühlmäuse ein anderes Paarungs- und Aufzuchtverhalten haben als Berg-Wühlmäuse. Erstere leben monogam und weibliche wie männliche Mäuse kümmern sich gemeinsam um den Nachwuchs. Letztere leben promiskuitiv und kümmern sich wenig um den Nachwuchs.
Beide Arten sind genetisch sehr eng miteinander verwandt, haben aber einen unterschiedlich hohen Oxytocin-Spiegel. In einem Versuch wurde dann bei den einen Mäusen die Oxytocin-Aufnahme im Gehirn gehemmt und bei den anderen erhöht. Das Spannende war, dass viele Mäuse ein komplett anderes Verhalten als zuvor an den Tag gelegt haben. Was das für den Menschen bedeutet, wird nun diskutiert und gibt Anlass, den Oxytocin-Spiegel auch beim Menschen genauer anzuschauen.
Wie gestalten Sie das Lernangebot insbesondere für jüngere Schulklassen?
In unserer Ausstellung thematisieren wir viele verschiedene Facetten der Liebe von freundschaftlicher oder familiärer Liebe bis hin zu Selbstliebe. Darauf fußt auch unser Schulklassen-Programm für 3. und 4. Klassen. Was macht mich besonders, was finde ich an mir gut? Mit wem will ich welche Beziehung eingehen? Was erwarte ich von familiärer Liebe im Unterschied zu freundschaftlicher Liebe? Diese Fragen fächert das Programm für die Jüngeren auf. Wir vermitteln hier keine komplexen Erkenntnisse, sondern wählen diesen subjektiven Zugang. Es gibt aber auch Angebote für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse aufwärts sowie ein Begleitprogramm für Interessierte jeden Alters, zum Beispiel Abendöffnungen oder einen Science Slam rund um das Thema Liebe.
Was sollen Besucher*innen von ihrem Besuch der Ausstellung mitnehmen?
Mit der Ausstellung stellen wir den Gästen zunächst sehr viel bereit. Was die Gäste mit nach Hause nehmen, wird ganz unterschiedlich sein. Ich finde es toll, wenn sie sich mit diesem allgegenwärtigen Thema beschäftigen und mit anderen Menschen darüber ins Gespräch kommen.
Sie sehen vielleicht, wie viele Menschen in einer Patchwork-Situation leben, oder dass es sehr unterschiedlich ist, in welcher Distanzzone sie sich mit anderen Menschen wohlfühlen. Wen würden sie mit in die intime Zone nehmen? Mit wem fühlen sie sich in der freundschaftlichen Zone wohl? Dann fließen vielleicht die wissenschaftlichen Perspektiven in diese Gespräche ein und die Gäste haben einen Eindruck bekommen, mit welchen Fragen und Methoden sich Forschende dem Thema Liebe annehmen.
Welche Themenkomplexe schweben Ihnen für zukünftige Sonderausstellungen vor?
Es wird weiterhin unsere Aufgabe bleiben, wissenschaftliche Themen, die gesellschaftliche Relevanzen haben, so verständlich aufzubereiten, dass unsere Gäste einen Zugang erhalten. Ich bin aber ganz begeistert davon, dass wir in der jetzigen Sonderausstellung den Spieß umgedreht haben und ein allgegenwärtiges Thema mit einer wissenschaftlichen Brille anschauen. Das kann ich mir auch in Zukunft sehr gut vorstellen. Ich denke zum Beispiel an die Themen Angst und Ohnmacht. Das sind Themen, die gerade alle Menschen beschäftigen, sei es durch politische Entwicklungen, sei es durch die Klimakrise. Wie geht man mit Angst und Ohnmacht um? Wie findet man zu den subjektiven Einschätzungen wissenschaftliche Fakten? Können die einen beunruhigen oder beruhigen? Diese Fragen finde ich spannend.
Die Sonderausstellung „LIEBE.“ ist noch bis zum 23. August 2026 im Universum Bremen zu sehen.