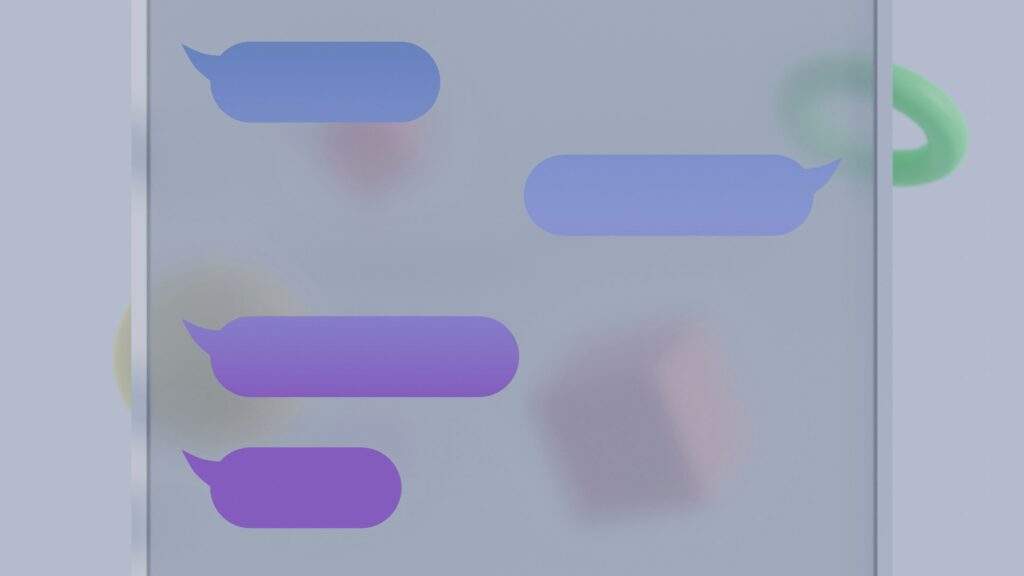Das Wisskomm-Update gibt alle 14 Tage einen Überblick über aktuelle Themen, Debatten und Trends. Außerdem finden Sie hier aktuelle Termine und Forschungsergebnisse zur Wissenschaftskommunikation.
Scicomm-Support bis 2028 gesichert
Was gibt’s Neues?
Bundestag beschließt Förderung des Scicomm-Supports
Wissenschaftler*innen sehen sich zunehmend Hass und Bedrohungen ausgesetzt, gerade wenn ihre Erkenntnisse nicht ins Weltbild mancher Menschen passen. Als Reaktion darauf hat der deutsche Bundestag einen Schritt unternommen, um die Wissenschaftsfreiheit zu schützen. Mit insgesamt einer Million Euro bis 2028 wird die Finanzierung für „Scicomm-Support“ gesichert, eine Anlaufstelle, die bedrohten Forscher*innen Hilfe bietet.
Diese Einrichtung, die bereits seit 2023 agiert, bietet juristische Beratung, psychologische Betreuung und Schulungen für Wissenschaftler*innen an. Die Initiative ist eine direkte Antwort auf die wachsende Zahl von Angriffen auf Forschende, die sich insbesondere seit der COVID-19-Pandemie häufen. Die Förderung aus dem Bundeshaushalt ergänze die finanzielle Unterstützung von Gerda Henkel Stiftung, der Klaus Tschira Stiftung, der VolkswagenStiftung und der ZEIT Stiftung Bucerius und sei essenziell für die Fortführung des Angebots, teilt die Initiative auf ihrer Webseite mit.
US-Wissenschaftler*innen im Dilemma
Forschende in den USA sehen sich wachsendem Druck vonseiten der Regierung ausgesetzt, die ihre Arbeit durch Kürzungen und politische Einmischung zu kontrollieren versucht.
Während sie sich mit Klagen und Protesten verteidigen, warnen die im „The Atlantic”-Artikel zitierten Expert*innen vor einem paradoxen Effekt: Ihr Widerstand könnte das öffentliche Vertrauen in die Wissenschaft weiter erodieren lassen, insbesondere bei jenen, die Forschende bereits als politisch voreingenommen betrachten. Der Kampf um wissenschaftliche Unabhängigkeit drohe so, die Kluft in der öffentlichen Meinung zu vertiefen und das Fundament der wissenschaftlichen Autorität zu schwächen.
„Real Things on the Ground“: Von Hühnern und Elektroautos
In einem aktuellen Beitrag plädiert Tom Sheldon vom Science Media Centre (SMC) UK für eine Rückkehr zu klarer und verständlicher Sprache in der Wissenschaftskommunikation. Er kritisiert die wachsende Tendenz, abstrakten Jargon und „Managementsprech” anstelle von konkreten Beispielen zu verwenden. Diese „Real Things on the Ground” (RTOTG) wie Elektroautos oder Hühner seien essentiell, um komplexe wissenschaftliche Themen für die breite Öffentlichkeit greifbar zu machen. Die Verwendung vager Formulierungen verwirre nicht nur Journalist*innen, sondern entfremde auch das Publikum, was dem Ziel der Wissenschaftskommunikation entgegenstehe. Der Autor appelliert daher, eine ehrliche und direkte Kommunikation zu pflegen, um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen.
Substack als neue Plattform für Forschende
Immer mehr Wissenschaftler*innen nutzen die Plattform Substack, um ihre Forschungsergebnisse und ihr Fachwissen direkt mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ein Artikel von „Nature“ beschreibt diesen Trend und nennt als Beispiel die Epidemiologin Katelyn Jetelina, die nach negativen Erfahrungen mit sozialen Medien zu Substack wechselte. Laut „Nature” biete die Plattform die Möglichkeit, eine eigene Community aufzubauen, längere und detailliertere Inhalte zu veröffentlichen und Geld für die Arbeit zu bekommen. Dies erlaube eine direktere und persönliche Form der Wissenschaftskommunikation, die sich von den Einschränkungen traditioneller Kanäle wie Fachjournalen löse, gleichzeitig jedoch auch Risiken der Pseudowissenschaft und Falschinformationen berge. Somit etabliert sich Substack langsam als wichtige Alternative in der Wissenschaftskommunikation.
Außerdem in diesem Update: …
Wer interessiert sich noch für Fakten? Dieser Frage geht der Podcast „Gedankensprünge” von Lübeck hoch 3 in der Podcast-Folge „Wissenschaftskommunikation” auf den Grund. Die Podcastfolge diskutiert, wie Wissenschaftskommunikation Forschung für die Gesellschaft verständlich, zugänglich und wirksam macht – von Hochschulverantwortung über mediale Übersetzungsarbeit bis hin zu konkreten Projekten wie dem Brahms-Portal.
Ein weiterer neuer Podcast nimmt sich der Wissenschaftskommunikation an. Der Podcast „Stand der Forschung” von Studio ZX und ZEIT Advise beleuchtet den aktuellen Stand der Wissenschaft in zwei Formaten: In „Deep Dive”-Folgen werden in Kooperation mit Forschungsinstitutionen einzelne Fachbereiche beleuchtet, während im „Forschungsbriefing” Wissenschaftsjournalist*innen Einblicke in ihre Arbeit und die neuesten Erkenntnisse geben.
Und die Forschung?
Auch in der Forschung geht es um Podcasts. Sie sind zu einem beliebten Medium der Wissenschaftskommunikation geworden. Aber was steckt eigentlich dahinter? Was motiviert Podcaster*innen? Crystal Ngo, Ann Grand und Heather Bray von der University of Western Australia haben 20 Interviews mit australischen Wissenschaftspodcaster*innen geführt. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem persönliche Beweggründe wie Spaß und Interesse an Wissenschaft ausschlaggebend sind. Die Podcaster*innen wenden zwar verschiedene kommunikative Taktiken an, jedoch nicht bewusst in Form von strategischer Wissenschaftskommunikation.
Auch wissenschaftliche Fachzeitschriften produzieren inzwischen Podcasts – insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Medizin. Ein Forschungsteam um Scott Greeves von der University of Tennessee hat jeweils 40 Episoden von zehn verschiedenen Zeitschriften untersucht. Die meisten von ihnen konzentrieren sich auf Studien, die in der jeweiligen Zeitschrift veröffentlicht wurden und werden meistens von Forscher*innen moderiert. Der Stil ist „wissenschaftlich“, emotionale und narrative Elemente werden selten verwendet.
Und als drittes ein ganz anderes Thema: Wie kann Kommunikation dazu beitragen, nachhaltigen Wandel in Städten voranzubringen? Hilmar Mjelde von der Western Norway University of Applied Sciences in Bergen und Anders Tønnesen von CICERO Center for International Climate Research in Oslo haben untersucht, wie Beamt*innen in drei mittelgroßen norwegischen Städten strategische Kommunikation einsetzen, um klimafreundliche Verkehrspolitik voranzutreiben, die als gerecht und legitim empfunden wird. Sie zeigen dabei, dass Spannungen thematisiert werden müssen und geben Empfehlungen, wie Widerstände abgebaut werden können.
Termine
📆 1. Oktober | Vertrauen in generative KI – Wissenschaft und Politik im Dialog | Mehr
📆 10. Oktober 2025 | MediaCon Tagung Wissenschaftskommunikation: Brücken zur akademischen Welt (Lissabon) | Mehr
📆 1. bis 15. Oktober 2025 | Call for Abstracts der Zeitschrift Media and Communications:Journalism as a Science Watchdog: Theories, Practices, and Implications | Mehr
Jobs
🔉Volontär*in Wissenschaftskommunikation | Leibniz-Institut SAFE (Bewerbungsschluss: 30.09.2025)
🔉Studentische Hilfskraft | Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (Bewerbungsschluss: 30.09.2025)
Weitere Stellenangebote finden Sie in unserer Jobbörse – exklusiv für Stellen aus der Wissenschaftskommunikation. Hochschulen, Forschungsinstitutionen, Stiftungen und Co können ihre Stellenangebote direkt an Besucher*innen unseres Portals richten.
Impressionen
Das Wissenschaftsbarometer Schweiz ist erschienen – mit Einblicken in die Entwicklung von Vertrauen in die Wissenschaft.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.linkedin.com zu laden.