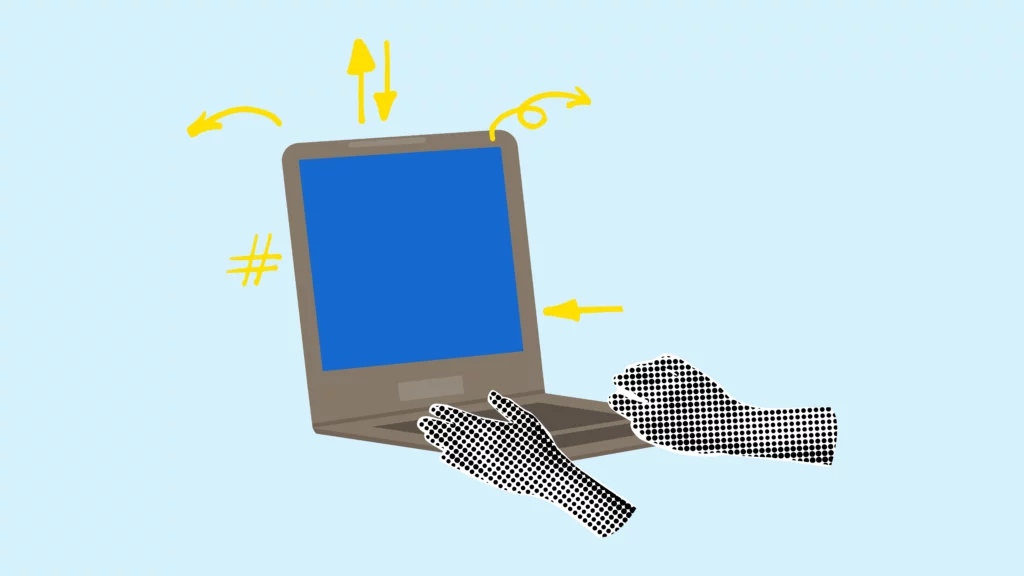Die öffentliche Verwaltung muss sich stets sachlich und ausgewogen äußern. Wie verträgt sich das mit zeitgemäßer Hochschulkommunikation? Der Rechtswissenschaftler Tobias Gostomzyk von der Technischen Universität Dortmund erklärt, welche juristischen Vorgaben es für den Diskurs auf Twitter & Co gibt.
Objektiv, sachlich, neutral – was dürfen Hochschulen im Netz wie kommunizieren?
Herr Gostomzyk, auf der letzten Tagung des Bundesverbands Hochschulkommunikation sagten sie, viele Pressesprecherinnen und Pressesprecher von Hochschulen seien verunsichert darüber, was sie in welcher Form kommunizieren dürfen. Warum gibt es dieses Problem?
Wenn ich mit den Kommunikationsverantwortlichen von Hochschulen rede, tritt regelmäßig ein Spannungsfeld zutage. Auf der einen Seite wollen Hochschulen zeitgemäß kommunizieren, um sichtbar zu sein. Auf der anderen Seite gehört ihre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit formal zur öffentlichen Verwaltung, weshalb es dafür andere Schranken gibt als für private Unternehmen. Verwaltungskommunikation soll – kurz gesagt – objektiv, sachlich, neutral und transparent sein.

Sie verweisen vor allem auf die sozialen Medien. Warum ist das dort relevanter als bei anderen Formen der Hochschulkommunikation?
Vor dem Aufstieg sozialer Medien haben Hochschulen ebenfalls schon über eigene Publikationen, Webseiten oder Veranstaltungen kommuniziert. Der Großteil der Berichterstattung erfolgte aber nicht unmittelbar durch die Hochschulen, sondern vermittelt über die Medien. Das verändert sich bei direkter Kommunikation über Social Media. Und mehr noch: Zwar hat erfolgreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit schon immer versucht, Nachrichtenfaktoren von Medien zu bedienen wie etwa Aktualität, Relevanz oder Personalisierung, um eine größere Chance auf Berichterstattung zu haben. Doch unter Netzbedingungen gelten verschärfte Aufmerksamkeitslogiken. Häufig erreichen nur Inhalte Aufmerksamkeit, die plakativ sind, emotionalisieren oder gar polarisieren. Nüchterne Posts im reinen Beamtendeutsch bleiben dagegen regelmäßig ohne Likes. Deswegen besteht verständlicherweise die Versuchung, so zu kommunizieren, wie es auf Social Media üblich ist – also auch mal ironisch zu sein, sich gesellschaftlich zu positionieren oder pointiert um Studierende zu werben. Und rasch kollidiert das tatsächliche Sein mit dem rechtlichen Sollen.
Was ist unter rechtlichen Kriterien für Verwaltungskommunikation, die Sie genannt haben, genau zu verstehen, etwa unter Sachlichkeit?
Das Bundesverwaltungsgericht sieht Sachlichkeit als gegeben an, wenn Tatsachen im Wesentlichen zutreffend wiedergegeben werden und Werturteile nicht auf „sachfremden Erwägungsgründen“ beruhen. Es geht also im Kern um den Austausch rationaler Argumente, ohne andere Positionen von vornherein auszugrenzen oder zu diskreditieren. Sachliche Korrektheit in der Forschungskommunikation könnte etwa bedeuten, dass Ergebnisse nicht zu stark verkürzt, vereinfacht oder gar zugespitzt weitergegeben werden. Oder dass die Ergebnisse anderer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ebenfalls erwähnt werden, wenn diese notwendig sind, um die neuen Erkenntnisse einzuordnen zu können. Rechtlich ist aber letztlich der Einzelfall maßgeblich, was es nicht einfacher macht: War eine Äußerung in einen bestimmten Kontext sachlich? Deswegen würde es für die tägliche Hochschulkommunikation wohl nur helfen, typische Konstellationen ausfindig zu machen und hierfür genauere Maßstäbe zu entwickeln. Das könnte Kommunikatorinnen und Kommunikatoren zu mehr Sicherheit verhelfen.
Das heißt, Hochschulpressestellen wollen hip und lustig kommunizieren, es ist aber zumindest fraglich, ob sie das überhaupt dürfen?
Es bietet sich ja oftmals an, lustig zu sein – also etwa mal ein Meme vom Dirigenten des Uniorchesters oder Fotos von den Hasen auf dem Uni-Gelände zu posten. Das ist auch nicht völlig verboten, aber dennoch besteht eine Zwickmühle: Nutze ich die neuen Möglichkeiten, um Studierende zielgruppenadäquat zu erreichen? Setze ich beispielsweise das Stilmittel der Ironie ein oder verwende ich witzige Sprache und Bilder? Oder poste ich nur Informationen, die zwar eindeutig als sachlich und neutral durchgehen, laufe dadurch aber Gefahr, dass mein Account als belanglos wahrgenommen wird? Nach den Kriterien, die durch die Rechtsprechung entwickelt wurden, darf sich die Hochschulkommunikation durchaus neuen Öffentlichkeitsbedingungen anpassen. Dennoch bleiben Grenzen – insbesondere im Fall der Sachlichkeit – bestehen. Denn letztlich kommuniziert hier die Verwaltung. An ihre Posts bestehen besondere Erwartungen in Bezug auf die Glaubwürdigkeit.
Finden Sie es denn generell problematisch, wenn Hochschulen in den sozialen Netzwerken aktiv sind?
Die unbestreitbaren Chancen bleiben – wie gesagt – leider nicht ohne rechtliche Risiken; gerade wenn man sich der Aufmerksamkeitslogik der sozialen Medien unterwirft. Das gilt nicht nur für den Grundsatz der Sachlichkeit, sondern etwa auch der Objektivität, Neutralität und Transparenz. Und vom Datenschutzrecht ganz zu schweigen: 2018 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Datenschutzbehörden bei Verstößen nicht nur gegen die Betreiber sozialer Netzwerke vorgehen können, sondern auch gegen deren Nutzer. Die Entscheidung wurde durch das Bundesverwaltungsgericht im letzten Jahr in ein lesenswertes Urteil überführt. In Folge hielt es etwa der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg für untragbar, weiterhin auf Twitter aktiv zu sein – und schloss kurzerhand seinen Account.
Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es konkret für die Pressestellen von Hochschulen?
Leider nur wenige: Aus dem Verfassungsrecht lässt sich ableiten, dass Verwaltungen – also auch die Pressestellen der Hochschulen – über ihre eigenen Angelegenheiten mit der Bevölkerung kommunizieren dürfen. Dieser Grundsatz spiegelt sich ausdrücklich in vielen Hochschulgesetzen wider. Das gilt auch für die Verbreitung von Forschungsergebnissen. Manchmal sind auch strategische Ziele vorgegeben. So sind beispielsweise in Berlin Hochschulen dazu angehalten, mit der Öffentlichkeit so zu kommunizieren, dass auch benachteiligte Bevölkerungsgruppen zur Aufnahme eines Studiums motiviert werden sollen. Darüber hinaus gab es bislang aber keine wesentlichen Konkretisierungen, die für die tägliche Praxis wichtig wären. Vielmehr ist auf die genannten, von der Rechtsprechung entwickelten Standards zurückzugreifen, die sich aber im Alltag einer Pressestelle schwer konkretisieren lassen. In anderen Bereichen sieht das anders aus. Beispielsweise verfügen Polizei und Justiz über genauere Richtlinien, weil hier das Kommunizieren seit jeher risikobehaftet war. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Hochschulen zwar kommunizieren sollen, doch wenig gesetzlich bestimmt wird, wie sie das tun sollen.
Hochschulen haben eine andere Notwendigkeit, zu kommunizieren, als viele Behörden. Sollten aus Ihrer Sicht deshalb für sie auch größere Freiheiten gelten?
Hochschulen sind bereits ein besonderer Fall, weil hier zwei verschiedene Standards gelten: Da ist zum einen die Freiheit der Forschung und Lehre, die sich auch auf die Kommunikation bezieht. Einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können sich Medien gegenüber frei äußern. Dabei gilt natürlich ein Mäßigungsgebot, was allerdings plakative Äußerungen oder Verkürzungen nicht ausschließt. Das gilt selbst, wenn es um politische Implikationen ihrer Forschung geht, beispielsweise wenn sie zum Klimawandel oder zu Migration forschen. Zum anderen aber sind die Pressestellen eindeutig Teil der öffentlichen Verwaltung. Sie unterliegen deshalb den genannten Einschränkungen.
Können sie die Kommunikationsgrenzen für Forscher und Forscherinnen noch genauer definieren?
Für sie gilt bisweilen eine Verschwiegenheitspflicht, die sich teilweise aus den Hochschulordnungen selbst ergibt. Beispielsweise finden Sitzungen der Prüfungsausschüsse unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch der Datenschutz kann zur Verschwiegenheit verpflichten, so dass Noten nicht einfach im Internet veröffentlicht werden dürfen. Außerdem gibt es eine Treuepflicht gegenüber der Institution: Forscherinnen und Forscher als Angestellte im öffentlichen Dienst oder gar Beamte dürfen zum Beispiel ihr Rektorat nicht öffentlich lächerlich machen. Allein sachliche Kritik wäre zulässig. Auch gilt das Gebot der Verfassungstreue, was etwa politische Mäßigung umfasst. Aber davon abgesehen dürfen Forschende einem Journalisten oder einer Journalistin im Prinzip erzählen, was sie wollen, ohne dass die Pressestelle das absegnen müsste. Manchmal natürlich sehr zum Leidwesen der Kommunikationsverantwortlichen.
Was ist mit Bereichen, in denen sich Verwaltung und Forschung überschneiden, wie bei Drittmitteln?
Da wird es komplizierter. Drittmittel betreffen einerseits die Verwaltung: Über sie laufen die Finanzströme, und die Hochschulen selbst behalten ja auch einen Overhead ein. Aber andererseits gilt für Drittmittelverträge inhaltlich die Wissenschaftsfreiheit. Forschende dürfen sich – wie schon gesagt – grundsätzlich selbst überlegen, wann sie mit wem über ihre Arbeit kommunizieren. Müssten sie Drittmittelverträge jederzeit öffentlich machen, wäre diese Freiheit beschnitten. Deshalb befürworten viele Juristen einen Kompromiss, der sich bereits in einigen Hochschulgesetzen wiederfindet: Die Hochschulverwaltung muss demnach auf Anfrage den formalen Rahmen von Drittmittelprojekten offenlegen, also welche Summen welches Institut von welchen Partnern erhält. Zu inhaltlichen Details – was geforscht wird, welche Ergebnisse erwartet werden und so weiter – muss sie aber keine Auskunft geben. Aktuell möchten sich einige Hochschulen freiwillig auch zu mehr inhaltlicher Transparenz verpflichten, was grundsätzlich zu befürworten ist.
Die Hochschul-Pressestellen haben sich schon selbst konkrete Vorgaben gesetzt – mit den Leitlinien zur guten Wissenschafts-PR. Reichen die nicht aus?
Das ist ein guter Schritt, aber darin wird rein normativ festgelegt, wie der Dialog zwischen Wissenschaft, Journalismus und Öffentlichkeit aussehen sollte. Was den Mitarbeitenden in den Pressestellen meiner Erfahrung nach fehlt, ist eine Übersicht auf verwaltungsrechtlicher Ebene, also nicht: Wie sollte ich kommunizieren, sondern wie darf ich rechtlich gesehen überhaupt kommunizieren? Darf ich als Pressestelle den vermeintlichen Troll, der auf Twitter gegen meine Hochschule lästert, durch den Kakao ziehen? Darf ich ihn sogar sperren? Die rechtlichen Vorgaben sind wie gesagt dünn und die Rechtsprechung entwickelt erst nach und nach Vorgaben, die sich meist auch nicht direkt auf Hochschulen beziehen. Daher bräuchte es dazu noch eine Sammlung an konkreten Beispielen, welche Kommunikation im Einzelfall noch als sachlich oder neutral bewertet werden kann und was zumindest als grenzwertig anzusehen ist. So eine Übersicht gibt es leider bislang noch nicht. Sie wäre aber – meine ich – ein lohnender Schritt hinaus aus der kommunikativen Unsicherheit.