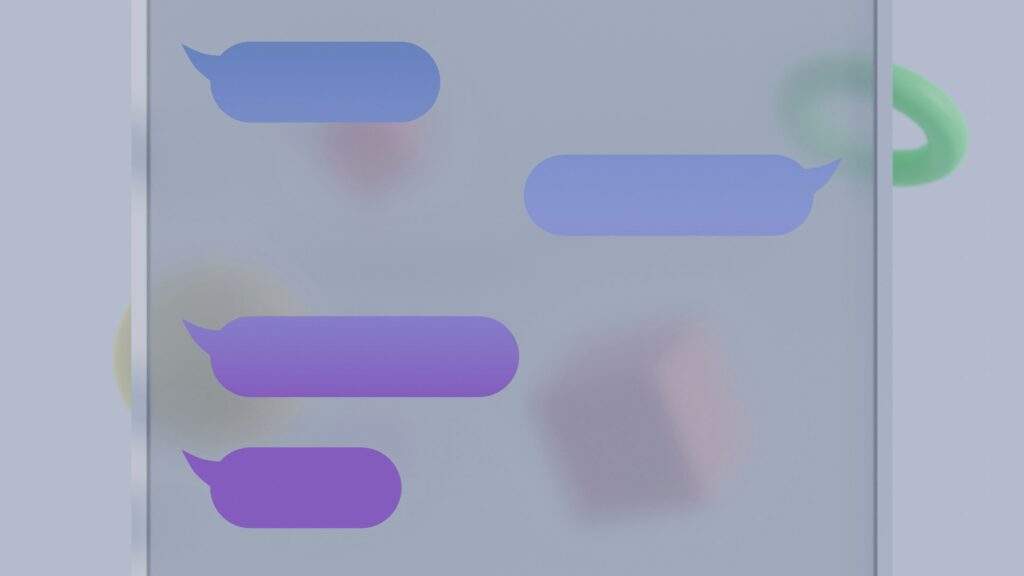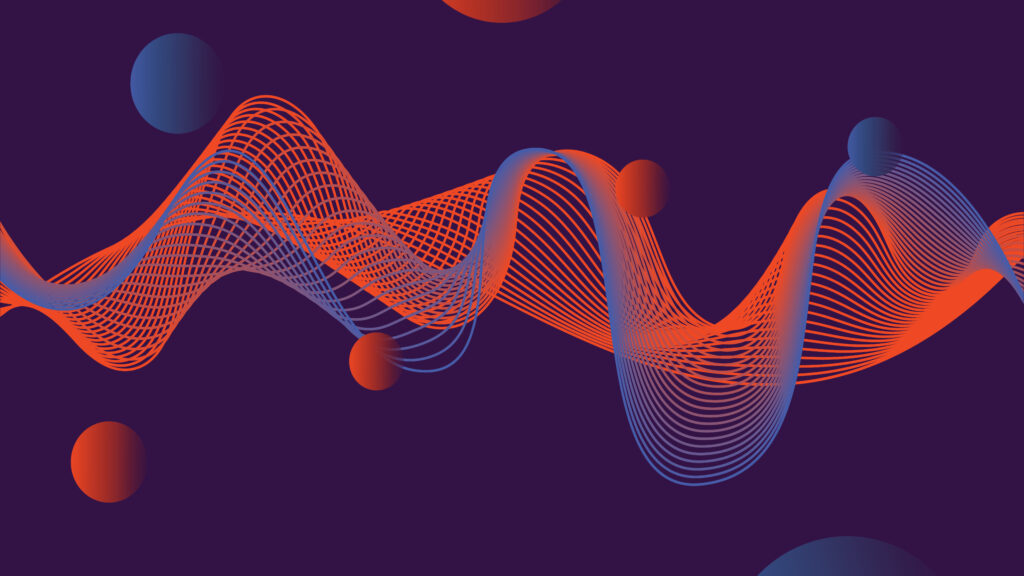Vor rund einem Jahr eröffnete in Berlin-Neukölln ein neues Innovationszentrum für Journalismus und Demokratiebildung. Intendantin Maria Exner spricht im Interview über die Bedeutung guter Recherchen für die demokratische Willensbildung, Angriffe von rechts und die Rolle des Hauses zur Stärkung von Resilienz.
Publix als Ort für den Journalismus?
Das Publix soll so eine „neue Heimat“ für Journalismus sein. Was bedeutet das?
Die Schöpflin Stiftung hatte als Initiatorin die Grundidee, Journalist*innen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich um die Rahmenbedingungen für gute öffentliche Kommunikation kümmern, einen Ort zu geben.

Denn die Stiftung hat festgestellt, dass solche Organisationen insbesondere in Berlin häufig kurzfristig aus ihren Räumlichkeiten ausziehen müssen, weil Mietverträge nicht verlängert oder Gelder gekürzt werden. Das sorgt natürlich für eine Menge Unruhe. Eine weitere Beobachtung war, dass von Akteur*innen, die sich mit der Frage von gemeinwohlorientierter Öffentlichkeit beschäftigen, mehr Sichtbarkeit brauchen.
Ein Ansatz, um das zu erreichen, war der Bau eines Ortes, an dem wir gemeinsam unter einem Dach arbeiten und uns miteinander austauschen. Aus dem Haus heraus können wir unsere Arbeit sichtbarer machen – zum Beispiel durch Veranstaltungen. Im ersten Jahr haben wir mit diesem Konzept bereits wirklich gute Erfahrungen gemacht Die Menschen, die im Publix arbeiten, fühlen sich weniger allein, weil sie wissen: Hier sind Kolleg*innen, die an den gleichen Fragen arbeiteten. Wenn man auf bestimmte Ereignisse reagieren muss, kann man sich auch mal über den Flur hinweg austauschen.
Einerseits geht es also um eine Stärkung nach innen. Ein Ziel von Publix ist aber auch, nach außen zu wirken und demokratische Strukturen stärken. Wie kann das funktionieren?
Journalistische Geschäftsmodelle sind in den letzten 20 Jahren in eine Krise gerutscht. Durch die Digitalisierung haben Journalist*innen an Agenda-Setting-Kompetenz verloren. Wir möchten Akteur*innen unterstützen, die im Journalismus Recherche und Faktenkompetenz stärken – wie beispielsweise Correctiv und den Verein Netzwerk Recherche, der in ganz Deutschland Reporter*innen vernetzt und weiterbildet. Denn gründlich recherchierte Informationen sind ein Kernelement einer gemeinwohlorientierten Öffentlichkeit, die für die Demokratie essenziell ist. Es braucht nachvollziehbare, belegbare, wissenschaftsbasierte und glaubwürdige Informationen, um eine geteilte Informationsgrundlage in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Sie ist die Grundlage der demokratischen Willensbildung und für die Verständigung über politische Ziele unersetzlich.
Wir merken, dass es entlang bestimmter Themen inzwischen sehr schwierig ist, politische Kompromisse zu finden. Die Parteien reagieren auf das Gefühl, dass die Menschen sehr unterschiedliche Dinge wollen – beispielsweise in Bezug auf das Thema Migration. Bei einem Vortrag im Publix hat die politische Philosophin Annette Zimmermann gesagt: „Demokratie ist nicht nur, wenn Leute zur Wahl gehen. Demokratie ist auch, wenn das Gemeinwesen gemeinsam entscheidet, worüber politisch entschieden werden soll.“ Viele der hier im Haus ansässigen Organisationen beobachten eine Entkopplung von dem, was Menschen laut Umfragen wichtig ist und was die öffentlichen Debatten tatsächlich prägt. Die Migrationsfrage ist dafür wahrscheinlich das Beste, aber nicht einzige Beispiel.
Was können Medien besser machen?
Ein Beispiel ist das Agenda-Setting. Darüber haben wir bei einer Veranstaltung mit Korbinian Frenzel und Julia Reuschenbach diskutiert. Frenzel ist Journalist, Reuschenbach Politikwissenschaftlerin. Gemeinsam haben sie das Buch „Defekte Debatten“ geschrieben. Sie zeigen, dass wir Debatten führen, die zum Selbstzweck werden und überhaupt kein Ziel mehr verfolgen. Es ist kein Wunder, dass wir ein Demokratieproblem bekommen, wenn Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass die Medien bestimmte Debatten katalysieren, damit sie politisch gelöst werden können. Stattdessen führen Politik und Medien eine Art Endlosschleife von Diskussionen, während die Themen, die den Menschen wichtig sind, nicht vorankommen. Wir wollen im Haus über diese und weitere Mechanismen in unseren Medien sprechen und sie ins öffentliche Bewusstsein rücken. Das muss ja nicht so sein. Man kann Dinge auch anders machen.
Das Publix wurde vor etwas mehr als einem Jahr eröffnet. Haben sie das Gefühl, dass das Haus dazu beiträgt, die Resilienz des Journalismus zu stärken – auch angesichts der Herausforderungen, die Sie skizziert haben?
Wir haben ja gerade erst angefangen, aber ich habe den Eindruck, dass das Haus mit dieser Mission sehr gut angenommen wird. Es gibt eine breite Anerkennung dafür, dass es wichtig ist, diesen Themen Aufmerksamkeit und einen Ort zu widmen. Ich erhalte viele Anfragen von Leuten, die mehr über unsere Arbeit erfahren und ausloten wollen, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Das werte ich grundsätzlich erst einmal als Legitimation. Die Organisationen hier im Haus, die wir regelmäßig bei Treffen sehen, bestätigen, wie sehr sie es schätzen, mit ähnlichen Organisationen unter einem Dach zu sein. Innerhalb eines Jahres ist es uns zudem gelungen, mit den kleinsten und größten Akteur*innen der Branche gemeinsam Projekte zu gestalten: Wir unterstützen das Netzwerk „Die neuen Medien“ in dem sich junge, unabhängige Journalismusorganisationen zusammenschließen, bei der Außenkommunikation und dem Mitgliederwachstum. Mit dabei sind zum Beispiel die Krautreporter, das MagazinNeue Narrative, das Wirtschaftsmagazin Surplus oder der Social Media Watchblog. Daneben arbeiten wir an einem Kooperationsprojekt mit ARD und ZDF, bei dem auch die FAZ, die Funke Mediengruppe und RTL dabei sind: Im November diskutierten wir anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der ARD gemeinsam mit 120 Journalist*innen unter 35 bei der Konferenz „Beyond News“ über die Zukunft des Journalismus. Diese Mischung würde ich als gelungenen Start bewerten.
Es gibt positiven Zuspruch, aber auch Kritik. Anfang des Jahres stellte die AfD-Fraktion eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung, in der es um die öffentliche Förderung des Hauses und einzelner Organisationen ging. Angemerkt wurde unter anderem, dass bei Publix alle Leitungspositionen von Frauen besetzt sind. Hat Sie die Anfrage überrascht?

Dass die AfD eine Partei ist, die einer faktenbasierten und journalistisch sauber recherchierten Öffentlichkeit feindselig gegenübersteht, ist keine Überraschung. Wir wissen schon lange, dass die AfD in den Bundesländern, in denen sie stark ist, Stimmung etwa gegen die Öffentlich-Rechtlichen macht.
Grundsätzlich verfügt jede im Parlament vertretene Partei völlig zurecht über das Mittel der Kleinen Anfrage, etwa um öffentlich zu machen, welche Organisationen mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. Wenn man sich die Fragen der AfD aber genauer anguckt, stellt man fest, dass allerlei Dinge insinuiert werden, die mit unserer Arbeit nicht viel zu tun haben. Ich würde progressiven und demokratischen Akteur*innen empfehlen, legitime und illegitime Kritik sehr klar auseinanderzuhalten. Legitime Kritik muss immer beantwortet werden. Politisch motivierte, illegitime Kritik kann man zurückweisen.
Wenn man ein Gesellschaftsmodell vor Augen hat, in dem die Bürger*innen nur noch einer einzigen politischen Ideologie folgen sollen – was die AfD offensichtlich präferiert – dann ist unabhängig recherchierender Journalismus nicht erwünscht. Mir ist die Diskussion darüber manchmal deutlich zu entgegenkommend. Denn wenn man sich Länder in Europa anguckt, in denen rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien an der Macht sind, dann ist völlig klar, dass die Demontage der freien Medienlandschaft zu den ersten politischen Zielen dieser Parteien gehört.
Sehen Sie die Kleine Anfrage als Bestätigung der Ziele von Publix?
Auf jeden Fall. Aus dieser politischen Ecke wird auch ein Großteil der sogenannten „alternativen Medien“ finanziert. Was wir bei der gescheiterten Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin erlebt haben, war der Beweis der Agenda-Setting-Power des völlig außerhalb jeden journalistischen Maßstabs agierenden Mediums Nius. Dass rechte Kampagnen dazu führen können, dass Bundesrichterinnen nicht vom Parlament bestätigt werden können, ist äußerst besorgniserregend. Insofern ist es wichtig, Medien zu stärken, die nach journalistischen Kriterien arbeiten, bei denen es eine Rechenschaftspflicht gibt und bei denen auch die Gegenseite gehört wird. Wenn Fehler gemacht werden, müssen diese transparent gemacht und korrigiert werden. Würde man diese Prinzipien auf Nius anwenden, würde man innerhalb von zwei Sekunden sehen, dass das alles Mögliche ist, aber kein Journalismus. Auch das wird mir häufig nicht klar genug benannt.
Wie können Medien die Unterschiede zwischen denjenigen deutlich machen, die nach journalistischen Qualitätskriterien arbeiten – und solchen, die es nicht tun?
Alle journalistischen Organisationen wären gut beraten, ihre Arbeitsweise transparenter zu kommunizieren. Als ich Chefredakteurin von Zeit Online war, haben wir den Transparenz-Blog „Glashaus“ eingerichtet. Darin haben wir immer wieder anlassbezogen darüber berichtet, warum wird in einer bestimmten Nachrichtenlage dieses oder jenes Thema aufgegriffen haben und die grundlegenden Prinzipien der Nachrichtenauswahl erläutert.
Es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu machen. Man kann Leser*innen einladen, an Redaktionskonferenzen teilzunehmen. Der Presserat könnte eine deutlich öffentlichkeitswirksamere Rolle spielen. Wir hätten schon Möglichkeiten, die handwerklichen Prinzipien und Methoden des Journalismus klarer zu benennen und daraus abgeleitet zu erklären, warum bestimmte Informationen mehr Vertrauen verdienen als andere.
In der Forschung wird deutlich, dass in der digitalen Mediennutzung Einzelpersonen mehr Vertrauen genießen als Medienorganisationen oder -marken. Das heißt, wir müssen das gesamte Publikum in die Lage versetzen, vertrauenswürdige Absender von Manipulation und Meinungsmache zu unterscheiden. Diesem Problem können wir nur mit breit angelegten Medienkompetenzprogrammen begegnen. Wir haben zu spät erkannt, dass der digitale Wandel eine Bildungsanstrengung erfordert, damit die Menschen sich in dem Informationsökosystem, mit dem sie tagtäglich konfrontiert sind, auch zurechtzufinden.
Wie geht es nach dem ersten Jahr mit Publix weiter?
Wir wollen uns auch weiterhin der Unterstützung von Journalist*innen und der Medienvielfalt widmen. Ich bin beispielsweise Jurymitglied des Media Forward Fund, einer neuen Funding-Organisation für gemeinwohlorientierte Medien in der Wachstumsphase. Es ist klar, dass wir außerhalb der großen Medienhäuser Weiterbildungs- und Capacity-Bildungsmaßnahmen brauchen, um modernes Medienmanagement des 21. Jahrhunderts zu lehren. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Medienkompetenz. Idealerweise wollen wir im Haus ein kostenloses Angebot für Bürger*innen entwickeln. Die Frage ist, wie man Erwachsenen, die nicht mehr zur Schule oder an die Uni gehen, dabei helfen kann, sich im Informationsökosystem zurechtzufinden. Wir bemühen uns derzeit um eine Partnerschaft mit der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB).
Ein dritter Schwerpunkt, der auf die Stärkung einer informierten Öffentlichkeit einzahlt, ist, dass wir mit diesem Haus dafür sorgen, dass Organisationen wie Reporter ohne Grenzen und der Think Tank „More in Common“, der zu gesellschaftlicher Polarisierung arbeitet, eine gute und sichere Arbeitsumgebung haben. Damit wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass sich diese Organisationen angesichts der zunehmenden Angriffe von rechts resilient aufstellen. Denn die sind zu erwarten.