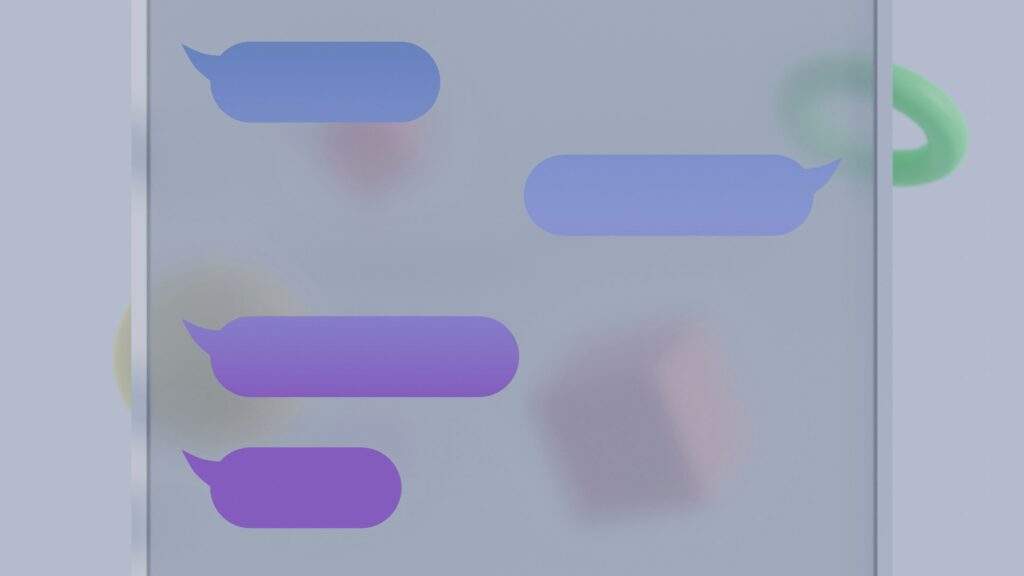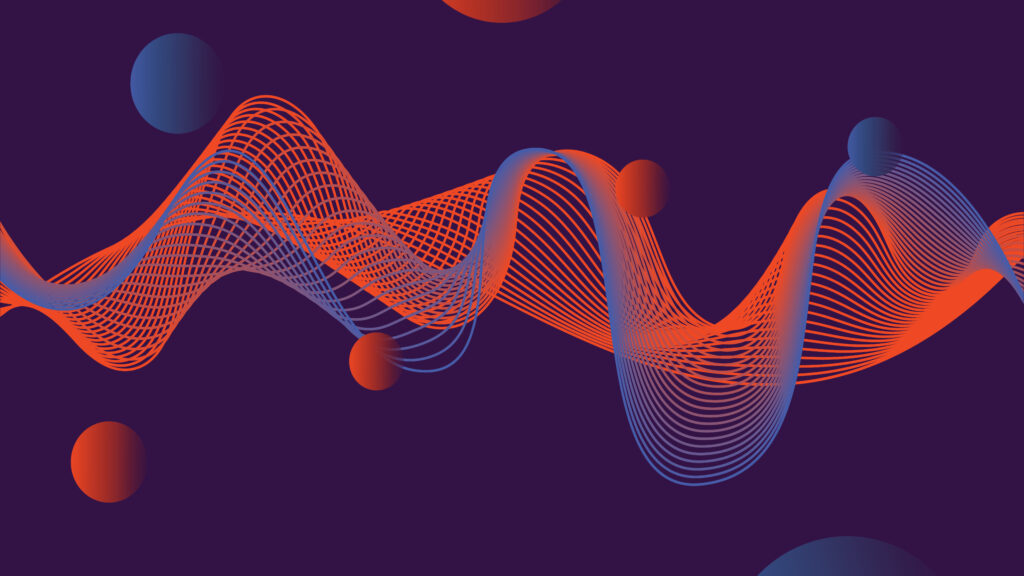Statt sich zurückzuziehen, haben sich Forschende unterschiedlicher Disziplinen zusammengeschlossen. In Potsdam ist so das Postcolonial Studies Collective entstanden. Die Wissenschaftskommunikatorin Anna von Rath erzählt in ihrem Gastbeitrag, wie kollektive Resilienz in der Forschung entsteht.
Wie sich die Postcolonial Studies gegen Angriffe von rechts wehren
Die Postcolonial Studies sind ein Querschnittsthema, in dem es um die Erforschung des Kolonialismus und seiner Nachwirkungen geht. Seit den 1990er Jahren gewinnt dieses Forschungsfeld in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften auch in Deutschland zunehmend Beachtung. Forschende dieses Bereichs tragen mitunter auch zu gesellschaftspolitischen Debatten bei. Mediale Aufmerksamkeit erhielten beispielsweise Beiträge zur Anerkennung und Aufarbeitung des Völkermordes an den Nama und Herero sowie die Rückgabe von kolonialen Raubgütern1.
Gezielte Angriffe auf bestimmte Forschungsfelder können ihren Ruf ruinieren – mit ernst zu nehmenden Folgen
Doch mit der wachsenden Sichtbarkeit der Postcolonial Studies haben sich in den letzten Jahren auch die Angriffe auf dieses Forschungsfeld vermehrt. Vor allem rechte Parteien und Medien neigen dazu, diesen Forschungsbereich als Aktivismus oder „Agendawissenschaft“ zu bezeichnen. 2023 forderte die AfD-Fraktion im Bundestag eine umgehende Evaluation sogenannter Agendawissenschaften durch den Wissenschaftsrat.
Dahinter stand die Unterstellung, dass die Postcolonial Studies, aber auch die Gender und Disability Studies, ein ideologiegeleitetes gesellschaftspolitisches Programm vorantreiben würden, das nicht den üblichen Qualitätskriterien des wissenschaftlichen Arbeitens entspräche2. Zwar stellte Katrin Staffler von der CDU/CSU klar, dass die Wissenschaftsfreiheit durch Anträge wie diese in Gefahr geraten würde3, dennoch folgten seitdem zahlreiche weitere parlamentarische Anfragen der AfD zur postkolonialen Forschung an deutschen Hochschulen in verschiedenen Bundesländern4.
Derartig gezielte Angriffe auf bestimmte Forschungsfelder können ihren Ruf ruinieren – mit ernst zu nehmenden Folgen. Damit wird öffentlich der Eindruck vermittelt, mit diesen Forschungsfeldern würde etwas nicht stimmen oder sie seien nicht legitim. Universitäten und Forschende distanzieren sich dann vielleicht von diesem Bereich, um sich keine Probleme einzuhandeln – etwa Stellung zu kleinen Anfragen nehmen zu müssen. Wenn rechte Angriffe die gesellschaftliche Perspektive auf bestimmte Forschungsfelder erfolgreich verschieben, könnte es sein, dass diese künftig weniger Finanzierung erhalten.
Mit dem Zusammenschluss zum Kollektiv ein Gegengewicht schaffen
Damit Betroffene sich vor falschen Unterstellungen oder öffentlichen Angriffen schützen und das eigene Forschungsfeld in unsicheren Zeiten resilienter machen können, hilft in vielen Fällen der Austausch mit Kolleg*innen. An der Universität Potsdam haben sich dieses Jahr an der philosophischen Fakultät zahlreiche Wissenschaftler*innen zusammengefunden, um ein Kollektiv zu gründen: das Potsdam Postcolonial Studies Collective. An vielen Lehrstühlen sind Wissenschaftler*innen tätig, die sich in ihrer Forschung dem Querschnittsthema der Postcolonial Studies widmen. An dem Kollektiv beteiligen sich bisher die Anglistik, Amerikanistik, Global History, Slawistik und Osteuropastudien, Klassische Philologie und Romanistik.
In regelmäßigen Vernetzungstreffen können sich die Mitglieder über ihre aktuellen Forschungsvorhaben und die Herausforderungen in ihrer Arbeit austauschen und sich gegenseitig stärken. Die Amerikanistin Nicole Waller, eine der Sprecherinnen des Kollektivs, erklärt: „Da die Postcolonial Studies im öffentlichen Diskurs häufig pauschal als negativ dargestellt werden, möchten wir mit unserer Arbeit so ein Gegengewicht schaffen.“
Kommunikationsarbeit für mehr Resilienz
Die Universität Potsdam legt Wert auf die Profilbildung in Bereichen, die besonders innovativ und forschungsstark sind, und somit erhält das Potsdam Postcolonial Studies Collective in den nächsten drei Jahren institutionelle Unterstützung als sogenannter Potenzialbereich. Zu den zentralen Anliegen gehört, so Waller, „unsere Forschung in den Postcolonial Studies an der Universität und darüber hinaus zu stärken und sichtbar zu machen und uns mit anderen Teilen der Gesellschaft auszutauschen und zu vernetzen.“
Um diese Ziele zu erreichen, werden die Mitglieder und ihre Forschung in wöchentlichen Beiträgen auf LinkedIn und Instagram vorgestellt und neben einer öffentlichen Ringvorlesung im Wintersemester 2025/2026 werden auch Veranstaltungen außerhalb der Universität organisiert. Im Juli 2025 tauschte sich das Kollektiv beispielsweise mit der Kuratorin des Brandenburg Museums, Dr. Katalin Krasznahorkai, über die Ausstellung „Signale der Macht. Nauen, Kamina, Windhoek“ und die effektive Sichtbarmachung kolonialer Zusammenhänge aus.
Für den 30. Oktober 2025 ist eine öffentliche Veranstaltung zu afrikanischen Werktätigen in der DDR in Kooperation mit Das Minsk – Kunsthaus Potsdam geplant. Niedrigschwellige und kostenfreie Angebote für interessierte Menschen vor Ort und im Internet sollen helfen, sich eine fundierte Meinung über postkoloniale Themen bilden und an Diskursen beteiligen zu können. Neben der internen Vernetzung erachtet das Kollektiv verschiedene Formen der Wissenschaftskommunikation als ausschlaggebenden Faktor für die Resilienz des eigenen Forschungsgebiets.
Eigene Themen setzen
Das Kollektiv ist aber keine reine Reaktion auf rechtspopulistische Angriffe auf das eigene Forschungsfeld, vielmehr forschen die Beteiligten zu den Krisen der heutigen Zeit, inklusive rechter Meinungsmache. Die Postcolonial Studies können helfen, historisch gewachsene Machtkonstellationen und Interessenskonflikte zu verstehen, zu hinterfragen und weiterzudenken. Als Potenzialbereich an der Universität Potsdam strebt das Potsdam Postcolonial Studies Collective nun die Etablierung eines internationalen Graduiertenkollegs zum Thema „Repairing Cultures“ an.
Die Kulturwissenschaftlerin Anja Schwarz, Mitglied und designierte Sprecherin des Kollegs, erklärt: „Mich interessiert das Thema ‚Repair‘, weil es einen alternativen Zugang zum gegenwärtigen Krisenzustand westlicher Moderne eröffnet. Während diese Moderne auf Fortschritt und Innovation fokussiert ist, blendet sie häufig die damit verbundenen Geschichten von Gewalt, Ausbeutung und ökologischer Zerstörung aus – und erweist sich als unzureichend, um mit zerstörerischen Mensch-Umwelt-Beziehungen umzugehen.“
Ziel ist es, Stellen für Nachwuchswissenschaftler*innen an der Universität Potsdam zu schaffen und sich gemeinsam mit Beschädigungen, Brüchen und Verlusten auseinanderzusetzen und darin Anknüpfungspunkte für eine bessere Zukunft zu finden.Schwarz ergänzt: „Repair steht für mich damit auch für die Frage: Wie können wir in einer beschädigten Welt leben – nicht trotz, sondern mit den Rissen?“ und betont damit die gesellschaftspolitische Relevanz des Vorhabens.
In dem aktuell polarisierenden Klima müssen Forschende nach Wegen suchen, die Postcolonial Studies resilienter zu machen. Das Potsdam Postcolonial Studies Collective versucht, dies mit der Etablierung von Kollektivstrukturen, neuen Maßnahmen in der Wissenschaftskommunikation, dem Austausch innerhalb und außerhalb der Universität sowie der selbstbewussten Setzung eigener Forschungsthemen zu erreichen. Gerade der Schwerpunkt auf ‚Repair‘ geht über die Idee der Resilienz, also das Weitermachen nach einer Krise, hinaus: Die beteiligten Forschenden fragen an dieser Stelle nach der historischen Verantwortung für heutige Krisen und verschiedenen Möglichkeiten für systemische Veränderung. Welche Strukturen sollten erhalten werden und welche vielleicht auch nicht?