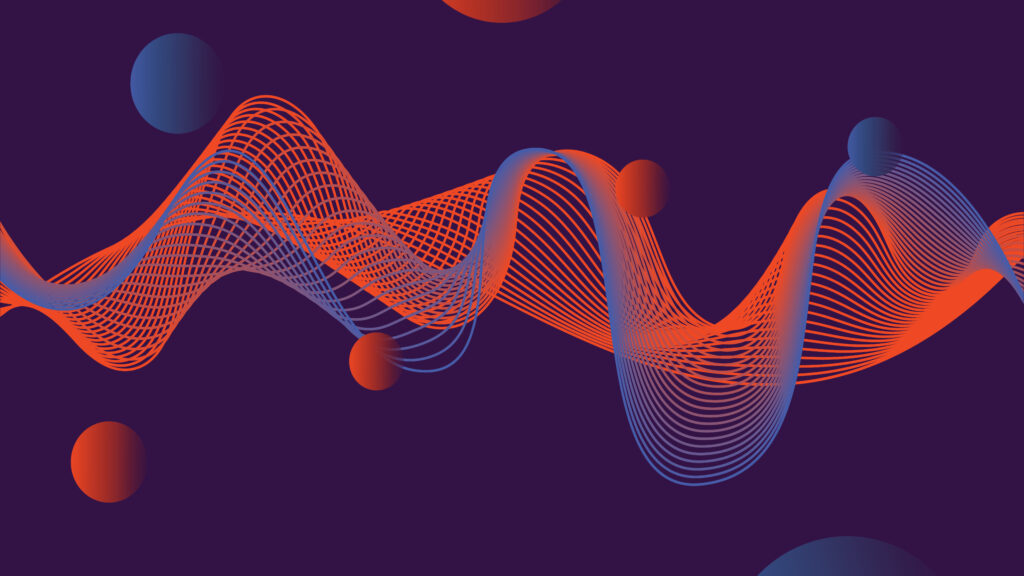Helfen bildliche Vergleiche beim Verständnis komplexer Konzepte? Welche Vorstellungen herrschen in der Öffentlichkeit von wissenschaftlicher Unsicherheit? Und welche Formen von Partizipation dominierten beim Wissenschaftsjahr 2022?
Nützen Metaphern der Umweltkommunikation? Neues aus der Forschung
In unserem monatlichen Forschungsrückblick besprechen wir aktuelle Studien zum Thema Wissenschaftskommunikation. In diesem Monat geht es um folgende Themen:
- Was verstehen Nicht-Expert*innen unter wissenschaftlicher Unsicherheit? Forscher*innen um Dietram A. Scheufele haben sich dieser Frage in Gesprächsgruppen angenähert – und eine Skala entwickelt, mit der sich das Verständnis für wissenschaftliche Unsicherheit messen lässt.
- Helfen uns Metaphern wie „Treibhauseffekt“, wissenschaftliche Konzepte zu verstehen? Oder erwecken sie nur diesen Eindruck? Forscher*innen aus Amsterdam haben das in einem Experiment getestet.
- Lösen partizipative Projekte die hohen Erwartungen ein, die in sie gesetzt werden? Forschende aus Berlin haben Koordinator*innen von Projekten im Wissenschaftsjahr 2022 „Nachgefragt!“ dazu befragt, welchen Einfluss die Formate auf Wissenschaft, Gesellschaft und Politik haben könnten.
- In der Rubrik „Mehr Aktuelles aus der Forschung“ geht es um den Klimawandel, Energiewende und Satire in der Wissenschaftskommunikation.
Was verstehen Nicht-Expert*innen unter wissenschaftlicher Unsicherheit?
Wissenschaft produziert ständig neue Erkenntnisse. Gerade bei gesellschaftlich heiß diskutierten und umstrittenen Themen ist es mitunter herausfordernd, wissenschaftliche Unsicherheiten zu kommunizieren. Becca Beets von der University of Maryland, Dominique Brossard und Dietram A. Scheufele von der University of Wisconsin-Madison wollten mithilfe von Fokusgruppen-Gesprächen ein besseres Verständnis dafür entwickeln, was Menschen gemeinhin unter „wissenschaftlicher Unsicherheit“ verstehen. In einer zweiten Studie haben die Autor*innen eine Skala entwickelt und getestet. Mit der Skala lässt sich messen, wie groß das Verständnis von Menschen für solche Unsicherheiten sind.
Methode Studie 1: Mithilfe des Marketing- und Kommunikationsforschungsunternehmen KW2 haben die Autor*innen Ende 2023 sieben Fokusgruppen-Gespräche mit insgesamt 38 Teilnehmenden aus den USA organisiert. Die moderierten und über Zoom geführten Gesprächsrunden folgten einem Interviewleitfaden, der drei Hauptthemen umfasste: Unsicherheit im täglichen Leben, Unsicherheit in der Wissenschaft und Kommunikation über wissenschaftliche Unsicherheit. Die Gespräche dauerten etwa 60 Minuten, wurden aufgezeichnet und automatisiert transkribiert. Die Texte wurden mithilfe der Software MAXQDA kodiert, um Themen und Muster zu identifizieren.
Ergebnisse Studie 1: In den Gesprächsrunden ging es darum zu verstehen, was die Teilnehmenden unter wissenschaftlicher Unsicherheit verstehen. Dabei kristallisierten sich drei zentrale Aspekte heraus:
- Prozessbezogene Unsicherheit: Unsicherheitsquellen, die im Prozess der wissenschaftlichen Forschung auftreten, wurden am häufigsten diskutiert. Dabei wurden vier Unterthemen identifiziert: Unsicherheit in Bezug auf Methodiken, die Interpretation von Daten, die Reproduzierbarkeit von Studien und die Natur sich ständig weiterentwickelnder wissenschaftlicher Erkenntnisse (zum Beispiel bei Ernährungsthemen).
- Kontextbezogene Unsicherheit: Das zweite Thema bezieht sich auf Unsicherheiten, die je nach wissenschaftlichem Fachgebiet variieren können. Bei sozialwissenschaftlicher Forschung gebe es beispielsweise mehr Raum für Interpretation als bei physikalischer, hieß es in den Gesprächen.
- Ein zentrales Thema waren auch Unsicherheiten, die sich auf die Auswirkungen von Wissenschaft beziehen. Bei einigen wissenschaftlichen Entdeckungen seien die Ergebnisse sofort sichtbar, andere seien langfristiger Natur, beispielsweise beim Thema Klimawandel. Die Teilnehmenden diskutierten auch über Risiken, beispielsweise in Bezug auf Nebenwirkungen von medizinischen Behandlungen, Impfungen und KI-Anwendungen.
Schlussfolgerungen Studie 1: Die Studie diente dazu, Themen zu identifizieren, die in einer Skala zur Messung vom öffentlichen Verständnis wissenschaftlicher Unsicherheit (public understanding of scientific uncertainty, „PUSU“) berücksichtigt werden sollten. In allen Gesprächen waren die am häufigsten genannten Quellen von Unsicherheit solche, die mit wissenschaftlichen Prozessen zusammenhängen. Bei den kontextbezogenen Unsicherheiten zeigte sich, dass häufig die jeweilige wissenschaftliche Disziplin als Quelle von Unsicherheit thematisiert wurde.
Außerdem zeigte sich, dass komplexe Probleme als Bereiche angesehen werden, in denen große Unsicherheit herrscht. Dies stehe im Einklang mit dem Konzept „postnormaler“ Wissenschaft (Funtowicz & Ravetz, 1991), schreiben die Autor*innen. Dabei gehe es darum, dass die Gegenwart durch Unsicherheiten, hohe Risiken von Entscheidungen und gesellschaftliche Wertediskussionen geprägt sei. Viel steht auf dem Spiel, wie sich beispielsweise beim Klimawandel zeigt. Das Ergebnis unterstreiche, dass Fragen postnormaler Wissenschaft in der Wissenschaftskommunikationsforschung stärker berücksichtigt werden müssten, folgern die Autor*innen. Sie heben auch hervor, dass Risiken in den Fokusgruppen oft im Zusammenhang mit unbekannten Folgen von Forschung diskutiert wurden. Risiko werde als „Unsicherheit über die Folgen (oder Ergebnisse) einer Aktivität und deren Schweregrad“ charakterisiert.
Die identifizierten Quellen wissenschaftlicher Unsicherheit integrierten die Autor*innen in die von ihnen entwickelte Skala zur Messung vom öffentlichen Verständnis wissenschaftlicher Unsicherheit.
Methode Studie 2: In der zweiten Studie untersuchten die Autor*innen, inwiefern bestimmte soziodemografische Merkmale und charakterliche Eigenschaften mit der Einstellung von Nicht-Expert*innen gegenüber wissenschaftlicher Unsicherheit (PUSU) zusammenhängen. Auch prüften sie den Zusammenhang mit Messgrößen für die allgemeine Einstellung gegenüber der Wissenschaft (beispielsweise Achtung vor wissenschaftlicher Autorität, Vertrauen in Wissenschaftler*innen und Wahrnehmung von Risiken und Vorteilen der Wissenschaft).
Die Studienteilnehmenden machten Angaben zu soziodemografischen Merkmalen, ihren Einstellungen gegenüber der Wissenschaft und gegenüber Unsicherheit im Allgemeinen. Dazu beantworten sie unter anderem Fragen zu ihrem „Wunsch nach Kognition“, also ihrer Neigung, sich auf anstrengende Denkaufgaben einzulassen und Freude daran zu haben.
Die Autor*innen entwickelten eine Online-Umfrage, die von Februar bis März 2024 über den Panel-Anbieter Forthright durchgeführt wurde. Die Stichprobe umfasste knapp 2000 Erwachsene, die hinsichtlich der Verteilung von Alter, Geschlecht, Ethnizität, Bildung und geografischer Region die US-Bevölkerung widerspiegelte.
Die Autor*innen entwickelten auf Grundlage der Fokusgruppengespräche in Studie 1 und etablierter Messgrößen eine Liste mit Themen und Unterthemen zu wissenschaftlicher Unsicherheit. Die Teilnehmenden der Umfrage sollten angeben, wie sehr sie diesen Aussagen zustimmen (von 1 „überhaupt nicht“ bis 6 „voll und ganz“ oder „weiß nicht“). Ein Beispiele lautet: „Es gibt immer mehrere Wege, um ein wissenschaftliches Problem zu lösen“. Die Antworten wurden statistisch ausgewertet und die Validität der Skala geprüft.
Ergebnisse Studie 2: Die Teilnehmenden beantworteten durchschnittlich 6,3 der neun Fragen richtig (69,6 Prozent). Um zu testen, ob sich die Skala wie erwartet verhält, untersuchten die Autor*innen den Zusammenhang zu etablierten Messgrößen für Wissenschaftskompetenz. Es zeigte sich, dass Menschen mit größerer Nähe zur Wissenschaft und solche mit einem höheren Bildungsniveau ein größeres Verständnis für wissenschaftliche Unsicherheiten zeigten. Religiösere Menschen hingegen wiesen ein geringeres Verständnis für wissenschaftliche Unsicherheit auf. Die politische Einstellung, die Nutzung wissenschaftlicher Nachrichten und ein naturwissenschaftlicher Abschluss zeigten keinen Einfluss.
Menschen, die ein besseres Verständnis für wissenschaftliche Unsicherheit hatten, zeigten weniger Respekt vor wissenschaftlicher Autorität und weniger Vertrauen in Wissenschaftler*innen. Diese Personen vertraten auch seltener die Überzeugung, dass der Nutzen der Wissenschaft deren negative Folgen überwiegt. Diese Zusammenhänge waren jedoch eher gering. Wer mehr Verständnis für wissenschaftliche Unsicherheit hatte, war im Allgemeinen toleranter gegenüber Unsicherheit und zeigte beispielsweise ein geringeres Bedürfnis nach Kognition.
Insgesamt lieferte die neu entwickelte, neun Punkte umfassende Skala laut der Autor*innen konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
Schlussfolgerungen Studie 2: Durch die Berücksichtigung der Fokusgruppengespräche konnten die Autor*innen sicherstellen, dass die PUSU-Skala sowohl die Vorstellungen von Nicht-Expert*innen von wissenschaftlicher Unsicherheit als auch die Ansichten von Wissenschaftler*innen widerspiegelt. Die zweite Studie bestätigte die Zuverlässigkeit, Reproduzierbarkeit der entwickelten Skala – und dass diese tatsächlich misst, was gemessen werden soll. Wie die Autor*innen vermutet hatten, steht das Verständnis von wissenschaftlicher Unsicherheit in einem eindeutigen Zusammenhang zur allgemeinen Wissenschaftskompetenz.
Der Zusammenhang zwischen dem Verständnis von wissenschaftlicher Unsicherheit auf der einen Seite und Vertrauen in Wissenschaftler*innen sowie der Wahrnehmung vom Nutzen der Wissenschaft auf der anderen Seite war eher gering ausgeprägt. Möglicherweise hänge PUSU nur geringfügig mit diesen allgemeinen Einstellungen gegenüber der Wissenschaft zusammen, überlegen die Autor*innen.
Die Ergebnisse zeigen, dass das Verständnis für wissenschaftliche Unsicherheit mit einer toleranteren Haltung gegenüber Unsicherheit im Allgemeinen verbunden ist. Auch hier war der Zusammenhang jedoch eher schwach ausgeprägt. Das deute darauf hin, dass die PUSU-Skala nur schwach mit diesen beiden Aspekten von Unsicherheit zusammenhängt.
Für die Forschung zur Kommunikation wissenschaftlicher Unsicherheit biete die PUSU-Skala ein Instrument, um zu untersuchen, inwieweit bestehende Klassifizierungen wissenschaftlicher Unsicherheit mit dem öffentlichen Verständnis der Ursachen von Unsicherheit in der Wissenschaft übereinstimmen, schreiben die Autor*innen. Nützlich könne sie auch für die Erforschung von Einstellungen gegenüber komplexen und kontroversen wissenschaftlichen Themen sein.
Einschränkungen: Die Ergebnisse der Fokusgruppengespräche in Studie 1 geben einen Einblick in die öffentliche Wahrnehmung von wissenschaftlicher Unsicherheit, können aber nicht verallgemeinert werden. In Studie 2 ist es möglich, dass die Befragten die Aussagen eher als Fragen nach ihren Einstellungen anstatt nach ihrem Wissen interpretierten, überlegen die Autor*innen. Zudem umfasse die endgültige Skala nur falsche Aussagen. Zukünftige Studien könnten mit einer Mischung aus wahren und falschen arbeiten, schlagen die Autor*innen vor.
Beets, B., Brossard, D., & Scheufele, D. A. (2025). A Mixed-Methods Study of Public Understanding of Scientific Uncertainty. Science Communication, 0(0). https://doi.org/10.1177/10755470251348142
Wie nützlich sind Metaphern in der Umweltkommunikation?
„Die Menschheit befindet sich auf dünnem Eis – und dieses Eis schmilzt schnell“, sagte UN-Generalsekretär Guterres in seiner Videobotschaft zur Vorstellung des IPCC-Berichts im Jahr 2023. In der Umweltkommunikation werden häufig Metaphern verwendet. Sie sollen dazu beitragen, komplexe wissenschaftliche Konzepte zugänglicher, verständlicher und anschaulicher zu machen, indem sie Verbindungen zwischen komplexen Konzepten und menschlichen Erfahrungswelten herstellen. Ein Beispiel ist beim „Treibhauseffekt“ der Vergleich mit Gewächshäusern im Garten. Tragen Metaphern aber tatsächlich zum besseren Verständnis bei? Oder führen sie nur dazu, dass Menschen den Eindruck bekommen, die Informationen seien verständlicher? W. Gudrun Reijnierse und Ellen Droog von der Vrije Universiteit Amsterdam haben mit Britta C. Brugman von der University of Amsterdam in einem Experiment die Effekte von Metaphern untersucht.
Methode: Die Autorinnen untersuchten die Wirkung von drei Umweltmetaphern auf (1) die wahrgenommene Verständlichkeit eines Textes, (2) das individuelle wahrgenommene Verständnis des Textes und das (3) tatsächliche Verständnis des Inhalts. Sie wollten dabei auch herausfinden, ob es einen Unterschied macht, wenn nur eine oder Kombinationen von mehreren Metaphern verwendet werden. Für das Experiment wählten sie drei sehr verbreitete metaphorische Konzepte aus dem Umweltbereich aus, um deren Wirkung zu vergleichen: „Treibhauseffekt“, „CO2-Fußabdruck“ und „Greenwashing“.
Über das Online-Datenpanel Prolific wurden im Juni 2023 englischsprachige, erwachsene Studienteilnehmende aus Großbritannien rekrutiert. Letztlich wurden Antworten von 510 Teilnehmenden in die Untersuchung einbezogen.
Die Teilnehmenden bekamen eine von neun Versionen eines Textes, der wie ein Wikipedia-Eintrag aussah. Die unterschiedlichen Versionen erläuterten jeweils eines der drei Umweltkonzepte – entweder ohne Metapher, mit einer einzigen Metapher (die mit dem Konzept selbst übereinstimmte, z.B. „Treibhauseffekt“ anhand eines Gewächshauses erklärt) oder mithilfe mehrerer Metaphern, die teilweise nichts mit dem Konzept selbst zu tun hatten (zum Beispiel Vergleich von Treibhausgasen mit Instrumenten in einem Orchester).
Nach dem Lesen des Wikipedia-Eintrags füllten die Teilnehmenden einen Fragebogen aus, in dem die wahrgenommene Verständlichkeit und Aussagekraft des Textes, das wahrgenommene Verständnis der Informationen und das tatsächliche Verständnis der Informationen abgefragt wurden. Beim Thema Verständlichkeit sollten die Teilnehmenden beispielsweise auf einer Skala bewerten, wie schwierig, komplex und unklar – beziehungweise klar – sie den Text fanden. Um das tatsächliche Textverständnis zu messen, füllten sie einen Lückentext aus. Auch Vorwissen über das jeweilige Umweltkonzept, das Umweltbewusstsein und das wahrgenommene wie tatsächliche Wissen zum Thema Nachhaltigkeit wurden gemessen.
Alle Texte wurden als relativ informativ eingestuft, aber die Texte zum Treibhauseffekt wurden als deutlich aussagekräftiger wahrgenommen als die zum CO2-Fußabdruck. Die nicht-metaphorischen Texte wurden als informativer empfunden als die Texte mit mehreren Metaphern.
Ergebnisse: Die Texte mit einer Metapher wurden als verständlicher wahrgenommen und schnitten auch beim wahrgenommenen individuellen Verständnis besser ab als die anderen Texte. Zwischen denjenigen mit keiner oder mit mehreren Metaphern zeigten sich kaum Unterschiede.
Auch beim tatsächlichen Textverständnis schnitt die Variante mit einer Metapher am besten hab. Hier hatten die Unterschiede jedoch keine statistische Relevanz. Ob Metaphern verwendet werden oder nicht, spielt also laut der Ergebnisse keine Rolle dabei, ob die Studienteilnehmenden die Texte tatsächlich besser verstanden.
Mit weiteren statistischen Analysen wollten die Autorinnen herausfinden, in welcher genauen Beziehung wahrgenommene Textverständlichkeit, wahrgenommenes Verständnis und tatsächliches Verständnis stehen. Dabei zeigten sich weder direkte noch indirekte Effekte. Das heißt: Die Autorinnen fanden keine Belege für die Annahme, dass sich die wahrgenommene Textverständlichkeit auf das tatsächliche Verständnis eines Textes auswirkt. Zwar führten höhere Werte bei der wahrgenommenen Textverständlichkeit zu höheren Werten beim wahrgenommenen Verständnis. Keines von beidem jedoch führte zu einem besseren tatsächlichen Verständnis. Diese Ergebnisse waren laut der Analysen unabhängig von den jeweiligen Vorkenntnissen der Teilnehmenden.
Schlussfolgerungen: Die Studie weist darauf hin, dass Metaphern zur wahrgenommenen Verständlichkeit eines Textes wie auch zum wahrgenommenen Verständnis eines Textes beitragen können. In dem Experiment war das bei solchen Metaphern der Fall, die sich direkt auf das beschriebene metaphorische Konzept beziehen – also zum Beispiel mit dem Bild des Fußabdrucks arbeiten, wenn das Konzept des CO2-Abdrucks erklärt werden soll.
Es zeigte sich auch, dass unterschiedliche Formen von Metaphern zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. So boten zusätzliche Metaphern, die sich nicht auf das zu erklärende Konzept selbst beziehen, keinen Vorteil gegenüber Texten ohne Metaphern. Die Autorinnen überlegen, ob die Auswahl der Metaphern zu wild gemixt und eventuell als unpassend empfunden worden ist. Sie unterstreichen aber auch, dass die Varianten mit mehreren Metaphern die Verständlichkeit nicht negativ beeinflusst habe.
Die Teilnehmenden hatten den Eindruck, sie würden Texte mit einer einzigen Metapher besser verstehen, zeigten aber tatsächlich kein besseres Verständnis. Das könnte laut der Autorinnen darauf hinweisen, dass sich Metaphern womöglich in erster Linie auf die Wahrnehmung auswirken und keinen tatsächlichen Lerneffekt haben. Allerdings wurde das Wissen mit einem einfachen Lückentext abgefragt. Eventuell würde es sich lohnen, das Textverständnis umfassender zu untersuchen, zum Beispiel mithilfe einer Zusammenfassung in eigenen Worten.
Die Teilnehmenden der Studie neigten also dazu, ihr eigenes Verständnis der Konzepte etwas zu überschätzen. Die Autorinnen weisen jedoch darauf hin, dass zwar das wahrgenommene Verständnis höher war als das tatsächliche. Trotzdem aber hatten Teilnehmenden durchaus viel verstanden.
Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafür, dass die Wissenschaftskommunikation von Metaphern profitieren kann. Allerdings sollten sich Kommunikator*innen Gedanken über deren Auswahl und Zusammenstellung machen. Eine offene Frage bleibt, inwieweit sich das tatsächliche im Vergleich zum wahrgenommenen Verständnis auf Einstellungen und Verhaltensabsichten auswirkt.
Einschränkungen: Die Autorinnen haben für das Experiment weit verbreitete Konzepte und Metaphern ausgesucht. Möglicherweise wäre es lohnenswert, in weiteren Experimenten andere Beispiele zu verwenden, über die die Studienteilnehmenden noch nicht viel wissen. Eventuell wären die Effekte beim Wissenserwerb dann höher. Denn insgesamt war das Wissen zu den Themen in der Stichprobe (eher weiblich, eher links, eher formal gebildet) bereits recht hoch. Auch hier könnte der Vergleich mit anderen Zielgruppen aufschlussreich sein.
Reijnierse, W. G., Brugman, B., Droog, E. (2025) The differential effects of metaphor on comprehensibility and comprehension of environmental concepts. JCOM 24(04), A01. https://doi.org/10.22323/150520250702095506
Wissenschaftsjahr „Nachgefragt!“: Wie wirkt partizipative Wissenschaftskommunikation?
Partizipative Projekte sind oft mit hohen Erwartungen verknüpft – beispielsweise, was Vertrauensbildung, Engagement und die Entwicklung von nachhaltigem Interesse angeht. Aber kann das auch eingelöst werden? Sabrina Kirschke und Jannis Glahe vom Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung in Berlin haben mit Dieter Kirschke von der Humboldt-Universität untersucht, welche Auswirkungen partizipative Projekte in der Wissenschaftskommunikation auf Wissenschaft, Gesellschaft und Politik haben können. Dazu führten sie Interviews mit Koordinator*innen von 20 Projekten des Wissenschaftsjahres 2022.
Methode: Mit dem Wissenschaftsjahr 2022 unter dem Motto „Nachgefragt!“ wollte das damalige Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft fördern. Bürger*innen wurden gebeten, Fragen einzureichen, die Forscher*innen und Politiker*innen in Diskussionen, in der Forschung und in der Forschungspolitik aufgreifen sollten. Die Autor*innen der Studie verglichen 20 der 25 partizipativen Wissenschaftskommunikationsprojekte, die im Rahmen der Förderinitiative realisiert wurden.
Ende 2022 bis Anfang 2023 führten die Autor*innen Online-Interviews mit einer*m oder zwei Projektkoordinator*innen, die durchschnittlich 90 Minuten dauerten. Sie stellten Fragen zu den Zielen des Projekts, zum partizipativen Ansatz, Hindernissen bei der Umsetzung, Lösungsstrategien sowie zu wahrgenommenen Auswirkungen auf Gesellschaft, Wissenschaft und Politik. Die Befragten sollten angeben, inwieweit diese drei Gruppen auf einer Skala von 0 (keine) bis 4 (hohe positive Auswirkungen) potenziell von den Wissenschaftskommunikationsaktivitäten betroffen waren. Sie sollten außerdem einordnen, welche Relevanz (auf einer Skala von 1 bis 4) folgende Beteiligungsformate in ihrem Projekt hatten:
- „Einfache Informationsübermittlung“
- „Informationsübermittlung nach Bedarf“
- „Bilaterale Informationsübermittlung“
- „Bereitstellung von Empfehlungen für die Forschung“
- „Gemeinsame Entscheidungsfindung in der Forschung“
Die Antworten mit Zahlenangaben wurden statistisch analysiert, die Interviews automatisiert transkribiert und qualitativ untersucht.
Ergebnisse: Formate, die ein eher geringes Maß an Partizipation aufweisen, wurden häufiger umgesetzt als solche mit einem höheren Maß an Partizipation. „Informationsübermittlung nach Bedarf” erhielt die höchste Punktzahl, dicht gefolgt von „bilaterale Informationsübermittlung” und „einfacher Informationsübermittlung”. Die Bereitstellung von „Forschungsempfehlungen” war eher selten und „gemeinsame Forschungsentscheidungen” kamen so gut wie nicht vor.
Als Beispiele für „einfache Informationsübermittlung“ nannten die Befragten besonders häufig einführende Präsentationen von Wissenschaftler*innen bei Veranstaltungen und Workshops, außerdem Podcasts, Ausstellungen und die Weitergabe von Informationsmaterial (z. B. Poster und Flyer). 19 Projekte gaben zusätzliche Informationen zum Thema „Informationsübermittlung nach Bedarf“. Sie beantworteten beispielsweise Fragen und suchten Diskussionsthemen aus, die in einer bestimmten Region von Relevanz waren. Alle Projekte berichteten, wie sie im bilateralen Austausch Informationen lieferten, beispielsweise in Gesprächen, Diskussion, bei Exkursionen, über Online-Plattformen und in Co-Design- und Co-Creation-Prozessen. 18 Projekte berichteten von Empfehlungen für die Forschung, beispielweise in Form von Hinweisen zu Prozessen durch zivilgesellschaftliche Partner*innen und von Impulsen von Bürger*innen während der Projekte. 15 Projekte gaben Informationen über gemeinsame Forschungsentscheidungen – zum Beispiel in Bezug auf studentische Projekte oder die Planung von Folgeprojekten.
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die erwarteten Auswirkungen auf Gesellschaft und Wissenschaft sehr hoch sind, während die Auswirkungen auf die Politik als sehr niedrig eingeschätzt werden. Die Teilnehmenden sagten unter anderem, dass die Projekte die Wissenschaftskommunikation von Wissenschaftler*innen und die Entwicklung von Folgeprojekten fördern würden. Als Auswirkungen auf die Forschung wurde genannt, dass die Projektergebnisse für Veröffentlichungen und Präsentationen genutzt würden, neue Erkenntnisse gewonnen und Forschungsfragen entwickelt würden und dass Empfehlungen und Impulse von gesellschaftlichen Akteur*innen in die Forschung flössen.
Als beispielhafte Auswirkungen auf die Gesellschaft wurden direkte Reaktionen wie gewecktes Interesse, Offenheit für Gespräche, Neugier, Spaß, Selbstwirksamkeit, inhaltliches Wissen, ein besseres Verständnis wissenschaftlicher Prozesse und eine stärkere Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft erwähnt. Seltener wurden langfristige Auswirkungen auf das Verhalten von Menschen genannt.
Die möglichen politischen Auswirkungen auf Bundesebene bezogen sich meist auf Forschungspolitik, Bildungspolitik und auf Diskussionen mit Politiker*innen. Auf Landesebene wurden unter anderem Diskussionen und „neue Perspektiven“ genannt. Auf lokaler Ebene wurden Beiträge zu lokalen politischen Themen, neue Perspektiven durch Diskussionen und die Vernetzung mit Politiker*innen hervorgehoben. Auch wurden eher übergreifende Auswirkungen auf die Politik genannt, wie das geweckte Interesse politischer Organisationen und Impulse für die Politik durch das Engagement beteiligter zivilgesellschaftlicher Akteure, sowie die Förderung der Demokratie.
Den Auswirkungen partizipativer Wissenschaftskommunikationsformate auf verschiedene Zielgruppen wollten die Autor*innen auch mithilfe quantitativer Analysen näherkommen. Statistisch gesehen seien die Ergebnisse wenig aussagekräftig, dennoch weisen die Autor*innen auf einige Zusammenhänge hin, die in Zukunft genauer untersucht werden könnten. Zum einen zeigte sich ein positiver Einfluss von „Informationsvermittlung nach Bedarf“ auf die Wissenschaft. Dies könne darauf hindeuten, dass ein geringeres Maß an Beteiligung, das jedoch besonders breit gestreut ist, mit einer höheren Auswirkung auf die Wissenschaft verbunden sein könnte als ein höheres Maß an Beteiligung, das weniger häufig vorkommt. Auch beim Einfluss der verschiedenen Formate auf die Gesellschaft könnten höhere, aber weniger verbreitete Beteiligungsformate mit geringeren Auswirkungen verbunden sein als niedrigere, aber häufigere Beteiligungsgrade.
Bei den Auswirkungen auf die Politik hingegen zeigen sich „gemeinsame Forschungsentscheidungen“ als positiv und einflussreich. Ein Beispiel ist die Sammlung von Bürger*innenfragen als Mittel zur Beeinflussung der Forschungspolitik. Die Forscher*innen überlegen, ob hier ein höheres Maß an Beteiligung mit einem höheren Maß an politischer Wirkung verbunden sein könnte.
Schlussfolgerungen: Die Forscher*innen unterstreichen, dass die statistischen Ergebnisse auf einer begrenzten Datenbasis beruhen. Sie seien jedoch nicht unplausibel. Die starke Wirkung der „Informationsübermittlung auf Bedarf“ lege nahe, dass ein auf die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppen zugeschnittener Informationsaustausch wichtiger sein könnte als breit angelegte Informationskampagnen.
Interessant sei, dass sich kein deutlicher Einfluss von Aktivitäten mit einem höheren Maße von Beteiligung auf die Wissenschaft zeige. Die als positiv eingeschätzten Auswirkungen gemeinsamer Forschungsentscheidungen auf die Politik könnten auf die grundlegende Idee des Wissenschaftsjahres zurückzuführen sein, bei dem der Einfluss von partizipativer Wissenschaftskommunikation auf die Forschungspolitik im Zentrum stand.
Die Studie zeige insgesamt, dass es kein einheitliches Modell der Beteiligung gibt, sondern ein Konglomerat vielfältiger Interaktionen mit geringerem oder höherem Maß an Beteiligung. Diese verschiedenen Formate können unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Gruppen haben. Es zeigten sich jedoch selten deutliche positive oder negative Auswirkungen der Beteiligungsformate auf Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. Dies werfe die Frage auf, ob sowohl die positiven als auch die Auswirkungen der Beteiligung in der Forschung überschätzt werden, überlegen die Autor*innen.
Einschränkungen: Über die Befragung von Wissenschaftskommunikator*innen anstelle der Teilnehmenden kann die Wirkung von partizipativen Projekten nur indirekt gemessen werden. Möglicherweise standen die Befragten zudem unter Druck, möglichst positiv über Beteiligung zu berichten. Die Forscher*innen regen weitere Studien an, die größere, länderübergreifende Datensätze umfassen, um die Auswirkungen von Partizipation in verschiedenen Kontexten zu untersuchen.
Kirschke, S., Glahe, J. and Kirschke, D. (2025) Exploring impacts of participatory science
communication on science, politics, and society. Front. Commun. 10:1566429. doi: 10.3389/fcomm.2025.1566429
Mehr Aktuelles aus der Forschung
Wer an einer Hochschule arbeitet, kennt das womöglich: Nicht alle haben dieselbe Vorstellung davon, was und wie kommuniziert werden sollte. Vorgaben der Pressestelle etwa können davon abweichen, was einzelne Wissenschaftler*innen für gut und richtig halten. Massimiano Bucchi von der Universität Trient und Mike S. Schäfer von der Universität Zürich analysieren in einem Essay Ursachen und Schlüsseldimensionen von Spannungen, die sich beispielsweise um Fragen des Reputationsmanagements, der akademischen Freiheit und des politischen Engagementsdrehen. Die beiden zeigen, wie Institutionen und Wissenschaftler*innen damit umgehen und plädieren für eine inklusive und transparente Kommunikationspolitik, die institutionelle Ziele mit wissenschaftlicher Autonomie in Einklang bringt.
Wie viel Einfluss haben wissenschaftspopulistische Überzeugungen und andere Einstellungen auf die Verbreitung von Falschinformationen zum Klimawandel? Welche Rolle spielt die Nutzung sozialer Medien? Ming (Bryan) Wang und Heather Akin von der University of Nebraska-Lincoln haben Daten aus einer repräsentativen Umfrage unter rund 1400 US-Amerikaner*innen ausgewertet. Dabei bestätigte sich der Einfluss kognitiver Einstellungen auf falsche Annahmen. Die Nutzung von traditionellen und sozialen Medien zeigte jedoch nur einen indirekten Effekt. Die Autor*innen schlussfolgern, dass die negativen Auswirkungen der Nutzung sozialer Medien auf falsche Vorstellungen vom Klimawandel möglicherweise überschätzt werden.
Klimawandel, die Zweite! Tenzin Tamang und Ruilin Zheng von der City University of Hong Kong haben Expert*innen-Bewertungen mit Antworten von Large language models (LLMs) der GPT-Familie verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Auswirkungen des Klimawandels im IPCC-Bericht 2023 weniger einschneidend dargestellt werden als von den LLMs. Diese Unterschiede seien noch stärker, wenn der Chatbot bei seiner Antwort in die Rolle einer*s Klimawissenschaftler*in schlüpfen soll.
Mit eingängigen Memes versuchen Wissenschaftsleugner*innen, wissenschaftliche Inhalte in Frage zu stellen. Was ist die beste Art, darauf zu reagieren? Hannah Little von der University of Liverpool und Justin Sulik von der LMU München haben auf der Plattform X Antworten auf das Anti-Evolutions-Meme „Warum gibt es noch Affen?“ untersucht. Das Ergebnis: Alle Studienteilnehmenden fanden diejenigen Antworten verständlicher, wirksamer und überzeugender, die in Textform erklärten, warum die Argumentation des Memes irreführend sei. Antworten, die das ursprüngliche Meme nachahmten, wurden schlechter bewertet. Die Studienergebnisse sprechen dafür, dass Memes als Antwort auf wissenschaftsleugnende Posts kontraproduktiv sein könnten.
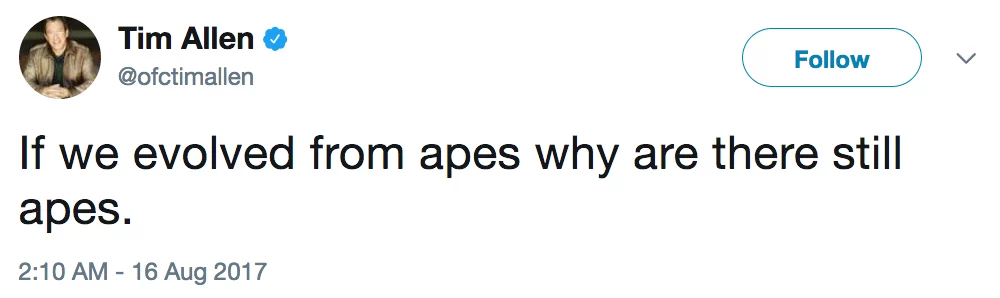
Wie sieht es mit Satire als Mittel der Wissenschaftskommunikation aus? Studienergebnisse eines Forschungsteams rund um Sara K. Yeo von der University of Utah mahnen auch hier eher zur Vorsicht. Die Wissenschaftler*innen haben in einem Experiment die Wirkung verschiedener Audioclips zum Thema Erneuerbare Energien getestet. Es zeigte sich: Wissenschaftler*innen, die darin Satire verwendeten, wurden als weniger glaubwürdig wahrgenommen.
Weiter geht’s mit der Energiewende, diesmal auf TikTok. Wie kann dort Wissenschaftskommunikation aussehen? Claudia Frick und Eva-Maria Grommes von der Technische Hochschule Köln haben mit Alice Watanabe von der Universität Hamburg den Kanal @energiewende.erklaert untersucht. Vor dem Hintergrund der Konzepte der transformativen und der post-normalen Wissenschaft analysieren sie, wie Eva-Maria Grommes, die den Kanal selbst betreibt, auf interaktive Art und Weise über Wissenschaft kommuniziert und dabei Debatten außerhalb des Wissenschaftssystems anstößt.