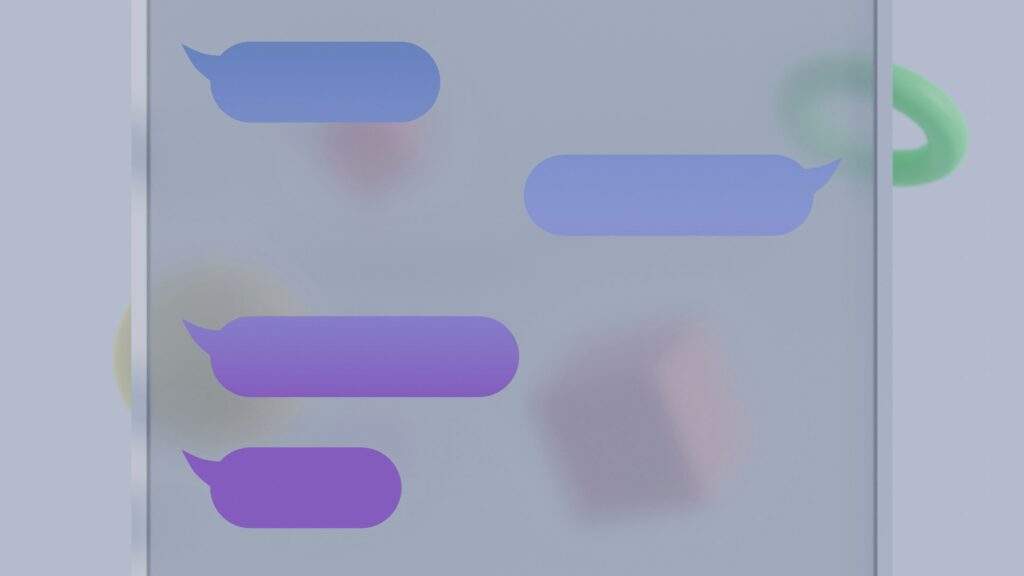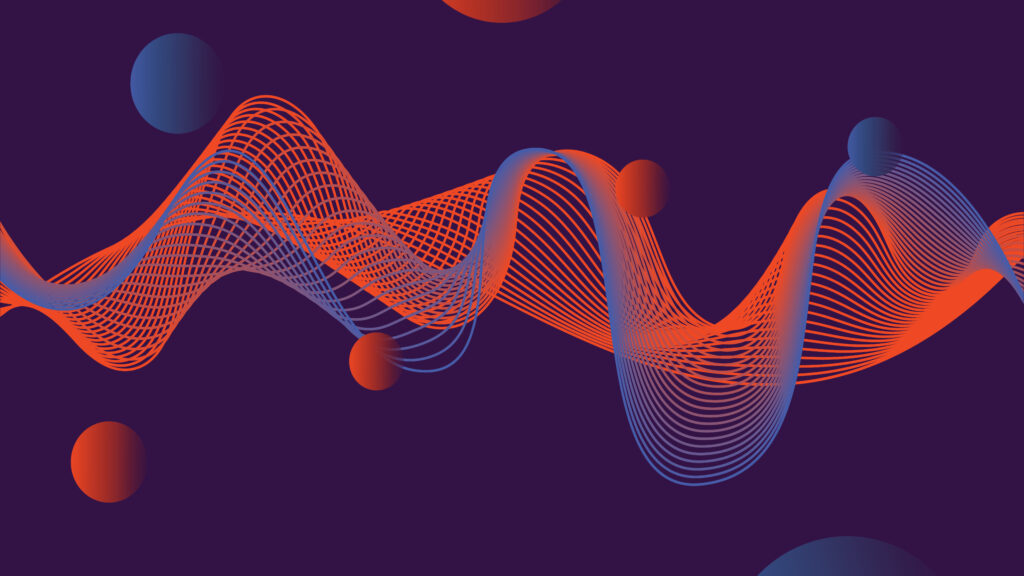Wissenschaft basiert auf Daten. Was aber passiert, wenn diese nicht mehr zu Verfügung stehen? Warum das Abschalten öffentlicher Datenbanken in den USA gravierende Auswirkungen auf die Forschung und auch auf die demokratische Gesellschaftsordnung hätte, erklärt Katrin Böhning-Gaese vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig (UFZ).
„Das Fundament unserer Wissensgesellschaft wird erodiert“
Im Zuge der Attacken auf die Wissenschaft in den USA ist die Sorge groß, dass der Zugang zu wissenschaftlichen Daten eingeschränkt wird. Was bedeutet das für Sie am Umweltforschungszentrum in Leipzig?

Allgemein ist das wirklich dramatisch und besorgniserregend, weil damit das Fundament unserer Wissensgesellschaft erodiert wird. Wenn Daten nicht mehr zur Verfügung gestellt werden oder nur in veränderter Form, dann erodiert das den Prozess der Entscheidungsfindung. Für uns am UFZ bedeutet das konkret, dass wir als Wissenschaftseinrichtung in die Bresche springen und die Daten erst einmal sichern. Bei den Ozean- und Klima-Satellitendaten sind es vor allem die marinen Helmholtz-Institute, die die Entwicklungen mit Argusaugen beobachten.
Das UFZ hat sich diverser Datenbanken zu Chemikalien angenommen, die die Environmental Protection Agency, die EPA, in den USA zur Verfügung stellt. Wenn diese Daten abgeschaltet würden und wir kein Backup hätten, würde das UFZ eine massive Datengrundlage verlieren. Das betrifft alle Bereiche, die mit Chemikalien arbeiten. Diese Wissenschaftler*innen greifen fast täglich auf diese Daten zu. Das ist so, als ob uns bei der wissenschaftlichen Arbeit der Boden unter den Füßen weggezogen wird.
Welche Bedeutung haben Daten – für die Wissenschaft, aber auch für die Gesellschaft?
Vordergründig sind Daten die absolute Grundlage für jegliche wissenschaftliche Bewertung und gesellschaftliche Entscheidung. Wir sammeln Daten, die standardisiert sein sollten und unabhängig erhoben werden – möglichst ohne politische Interessen. Wissen wird von den Forschenden idealerweise als „Honest Broker“, also als ehrliche Vermittler*innen allen zur Verfügung gestellt, ob Wissenschaft, Gesellschaft, Politik oder Industrie.
Dabei brauchen wir eine saubere Trennung zwischen Wissenschaft und Politik. Die Wissenschaft stellt Daten und Wissen zur Verfügung und die Politik nutzt dies, um Entscheidungsprozesse zu erwirken, die auf bestmöglicher Evidenz basieren. Wir haben in Deutschland auch Institutionen, die als politisch unabhängige Behörden dazu da sind, Daten zur Verfügung zu stellen – das Statistische Bundesamt zum Beispiel.
Bei welchen US-Datenbanken befürchten Sie konkret, den Zugang zu verlieren?
Es sind mehrere, die für uns eine Rolle spielen. Zum einen gibt es das CompTox Chemicals Dashboard. Darin wird jegliches verfügbare Wissen über Chemikalien in ihrer Wirkung auf den Menschen zusammengefasst und zur Verfügung gestellt. Es ist das Wikipedia der Chemikalien. Das andere ist die Ecotoxicology (ECOTOX) Knowledgebase. Dort können Sie herausfinden, welche Wirkung 12.000 verschiedene Chemikalien auf 13.000 aquatische und terrestrische Arten haben. Das ist natürlich ein Schatz ohnegleichen, weil die Daten öffentlich und kostenlos für die Weltgemeinschaft zur Verfügung stehen – das ist für die Industrie wichtig, aber eben auch für die Wissenschaft.
Wie haben Sie sich dieses Datenschatzes angenommen?
Wir haben die Daten gesichert, das ist machbar. Es geht zwar um riesige Datensätze, aber wir haben die Server und das Personal dafür. Das Problem ist, dass solche Datenbanken gepflegt werden müssen. Angenommen, die EPA würde sie abschalten und das UFZ müsste sie übernehmen, dann müsste die Hardware und Software ständig gewartet und erneuert werden. Noch kritischer ist, dass sie ständig mit neuen Daten gefüttert werden müssten. In den USA sind dazu ganze Teams angestellt. Wenn das dort nicht mehr passiert, muss es woanders gemacht werden – und für solche aufwändige Serviceleistungen wird dem UFZ das Geld fehlen. Deswegen sind wir an den Helmholtz-Zentren aktiv und versuchen, dafür kurzfristig Mittel zu sichern.
Andererseits ist das Problem so gravierend und groß, dass es eigentlich eine europäische Lösung braucht – die sicher nicht schnell geht. Deswegen ist unser Vorschlag, zweistufig vorzugehen und erstmal eine Helmholtz-Unterstützung oder eine Bundesunterstützung vom BMFTR zu bekommen und dann auf der europäischen Ebene eine langfristige Sicherung zu erwirken.
Wir sehen jetzt, dass man eine Abhängigkeit von den USA geschaffen hat, wie bei Atomwaffen oder bei der Rüstung. Wir haben uns darauf verlassen, dass die Wissenschaft in den USA Daten kostenlos für alle zur Verfügung stellt. Wenn das wegbricht, müssen wir selbst aktiv werden und dafür brauchen wir Personal und finanzielle Ressourcen.
Was sind Ihre Befürchtungen?
Die Lage ist wirklich ernst. Eine Facette ist, dass in den USA gerade die Budgets für die Umweltbehörden und die Behörden, die die Forschung unterstützen, diskutiert werden. Für die Environmental Protection Agency, die die erwähnten Services zur Verfügung stellt, ist von der Trump-Administration eine Budgetkürzung von 55 Prozent vorgeschlagen worden. Das heißt, sie müsste von einem zum anderen Jahr mit weniger als der Hälfte ihres Budgets auskommen. Wie die Behörde dann ihre Aufgaben priorisiert und was sie sich noch leisten kann, ist natürlich für mich als Außenstehende völlig offen. Das wird sicher auch intern höchst kontrovers diskutiert. Derzeit gibt es noch Verhandlungen – aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es eine substanzielle Kürzung gibt.
Welche Folgen könnte das haben?
Es könnte dazu führen, dass die Datenbanken nicht mehr zur Verfügung stehen. Damit können politische Interessen umgesetzt werden. Eine Folge könnte sein: Wenn man nicht mehr weiß, was wie giftig ist, muss die Industrie auch weniger Sorge tragen, die saubere Nutzung und den Verbleib von Chemikalien zu beachten. Das ist günstiger und man ist auf dem Markt erfolgreicher.
Eine zweite Folge könnte sein, dass das Wissen zum Teil vom öffentlichen Raum in den privaten wandert. Es wird zu Firmenwissen und steht damit nur noch Unternehmen zur Verfügung, die damit ihre Business-Modelle betreiben.
Bei aller Kritik an Wikipedia hat die Plattform zu einer unglaublichen Demokratisierung des Wissens beigetragen. Jede*r hat Zugang. Das hätte man sich vor zehn Jahren noch nicht vorstellen können. Jetzt gibt es wieder eine Gegenbewegung. Ich finde das sehr besorgniserregend.
Kamen die Entwicklungen überraschend?
Man hätte sich das vorstellen können, wenn man die vielen Papiere gelesen hätte, die Think Tanks in den USA seit der letzten Amtszeit Trumps erarbeitet haben. Ich glaube aber, es hat die Wissenschaft vollkommen vor den Kopf gestoßen, mit welcher Konsequenz die Trump-Administration das alles durchsetzt. Mit einer Kombination von „Shock and Awe“ wird die Wissenschaft eingeschüchtert.
Und ich sehe mit Sorge, dass vergleichsweise wenig Protest aus der amerikanischen Wissenschaft kommt. Einige amerikanische Wissenschaftler*innen sagen sogar: Eigentlich sind diese Kürzungen gar nicht schlecht, das hätten wir selbst machen müssen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die amerikanische Wissenschaft in der Breite eine relativ unpolitische Haltung zeigt. Dazu kommt die Angst um die eigenen Stellen und die Hoffnung, dass das Unwetter an einem vorbeizieht, wenn man sich konform verhält.
Wie schätzen Sie die Situation in Europa ein? Wie resilient ist die Wissenschaft?
So, wie ich die europäische Politik wahrnehme, sieht man sich mit den aktuellen Mehrheitsverhältnissen in Brüssel derzeit noch in der Situation, die Freiheit der Wissenschaft zu schützen, den Zugang zu Wissen zu erhalten und die Wissensgesellschaft grundsätzlich zu fördern.
Im konkreten Fall der Datenbanken sehe ich jedoch von außen keine großen Aktivitäten. Das könnte daran liegen, dass die EU gerade andere Prioritäten hat und vor allem Rüstungs- und Sicherheitsthemen adressiert. Ein großes Thema auf EU-Ebene ist auch die Frage der Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft, die gerade höher priorisiert wird.
Was würden Sie sich von der Politik wünschen?
Man muss sich bewusst machen, dass europäische Unternehmen und europäische Politik nur auf Basis einer gesunden Umwelt erfolgreich sein werden. Eine Verlangsamung des Klimawandels, resiliente Ökosysteme, lebendige Gewässer, saubere Luft: Das ist das Erfolgsmodell. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, was passiert, wenn wir das Thema Umwelt politisch nicht ernst nehmen.
Hier in Leipzig wissen das die Menschen ganz genau: Einer der drei Faktoren, die zum Sturz des DDR-Regimes beigetragen haben, war, dass die Regierung die Gesundheit der Menschen nicht sichern konnte – siehe Braunkohleabbau und Luftverschmutzung.
Die positive Nachricht ist: Wenn man sich um diese Themen kümmert und nachhaltige Lösungen und nachhaltige Technologien anbietet, kann man Erfolg haben. Es gab gerade wieder eine Übersicht vom Statistischen Bundesamt, die zeigt, dass Umsätze für den Umweltschutz 2023 gegenüber dem Vorjahr über zehn Prozent Wachstum verzeichnen; die Zahl der „Grünen Jobs“ wuchs um fast acht Prozent. Das heißt, der Bereich ist auch ein Job- und ein Wachstumsmotor.
Es ist unglaublich wichtig, sich mit Umweltthemen zu befassen. Konkret für Daten bedeutet das, dass man auch hier in die Verantwortung gehen muss. Wir reden im Vergleich zur Rüstung von Peanuts. Die Summen, die wir brauchen, um diese Datenbanken zu betreiben und sie mit Personal auszustatten, sind im Vergleich zu anderen Ausgaben der EU sehr klein.